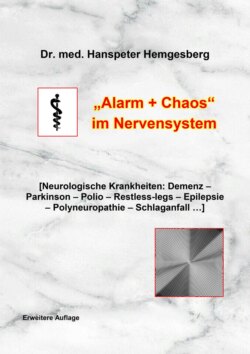Читать книгу Neurologische Krankheiten - Hanspeter Hemgesberg - Страница 54
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Symptome
ОглавлениеMeist beginnt die Erkrankung mit unspezifischen muskulären Symptomen, die die Erkrankten zunächst oftmals zum Orthopäden führen:
Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, ein Steifheitsgefühl in den Extremitäten.
In der Folge:
Die Krankheit schreitet vielmals über viele Jahre langsam fort und ist mit den derzeitigen Therapiemaßnahmen nicht aufzuhalten, aber die Symptome sind erheblich zu lindern.
Die hier skizzierten Symptome betreffen das voll-ausgeprägte Krankheits-Bild, das meist erst nach Jahrzehnten erreicht wird.
Beim einzelnen Patienten können viele Symptome ganz fehlen.
Im Einzelfall ist der Verlauf nicht vorherzusagen.
Im Verlauf der Erkrankung sind meist die typischen Leitsymptome erkennbar: Rigor, Ruhetremor, Akinese, Störung der Stellreflexe.
I. Rigor
(Muskelsteifheit, Rigidität )
Die Muskulatur wird zunehmend steif, woraus eine gebundene Körper-Haltung resultiert. Rigorbedingte Früh-Symptome sind beispielsweise eine spontan leichte Beugung im Ellbogen- und/oder Handgelenk, eine leichte Vorbeugung des Kopfes und des Oberkörpers. Schließlich werden die Schultern nach vorne gezogen, die Knie leicht angewinkelt, bereits im Stehen. Der Rigor ist in den körpernahen Muskelgruppen meist stärker ausgeprägt und hier oft schmerzhaft. Daher kommt es als Erstsymptom des Parkinson-Syndroms oft zu Schmerzen beispielsweise im Lendenbereich, dem Nacken, den Schultern oder Hüften, zumal sich an diesen Stellen auch altersbedingte degenerative Skelettveränderungen am häufigsten abspielen/manifestieren.
II. Ruhetremor
(Zittern der Extremitäten in Ruhe)
Es handelt sich dabei um ein Zittern von Armen und/oder Beinen im Ruhezustand mit einer Frequenz von zumeist 4-6 Aktionen pro Sekunde, gelegentlich auch etwas schneller. Ein Zittern ist augenfälligstes Symptom und führt daher oft zur (Fehl-)Diagnose. So ist ein Tremor bei Haltearbeit oder bei Zielbewegungen in aller Regel nicht Ausdruck eines Parkinson-Syndroms, sondern eines essentiellen Tremors und wird oft als Parkinson-Syndrom fehldiagnostiziert. Der Ruhetremor ist im Prinzip das spezifischste Symptom für eine idiopathische Parkinson-Erkrankung und kommt bei ca. 75% der Patienten mit einem idiopathischen Parkinson-Syndrom vor, bei anderen Formen des Parkinson-Syndroms nur in ca. 25%. Umgekehrt liegt, wenn man bei einem Patienten einen Ruhetremor sieht, mit 95%iger Wahrscheinlichkeit ein idiopathisches Parkinson-Syndrom vor. Bei ca. 15% fehlt der Tremor aber ganz, auch im weiteren Krankheitsverlauf.
III. Akinese
(auch Bradykinese oder Hypokinese, Bewegungsarmut)
Es handelt sich dabei um eine allgemeine Bewegungsarmut. Im Gesicht äußert sich diese als Verarmung der Mimik (Hypomimie, Maskengesicht). Die Sprache wird verwaschen, leise und die Sprachmelodie geht verloren.
Das Schlucken wird weniger, woraus beim fortgeschrittenen Parkinson-Syndrom ein Speichelfluss resultiert („Pseudohypersalivation“). Die Körper-Haltung wird steif. Beim Gehen fehlt die Rumpfrotation. Das Gangbild wird kleinschrittig und schlurfend. Die Arme pendeln beim Gehen zunehmend schlechter mit. Die Patienten haben Schwierigkeiten, sich nachts im Bett zu drehen. Das Schriftbild wird nach einigen Worten kleiner, was oft ein Frühsymptom ist („Mikrografie“). Die Feinmotorik wird beeinträchtigt, vor allem wenn schnelle motorische Bewegungsabläufe gefragt sind.
IV. Störung der Stellreflexe
(Stellreaktionen)
[= Reflexe (im Wesentlichen „Mittelhirn-abhängig“), die als „komplexe Leistung“ im Zusammenspiel von Hirnrinde, Kleinhirn & Stammganglien den Kopf und Körper aus jeder Fehlposition in eine Normalposition im Raum zurückbringen / unterschieden als Körper-, Labyrinth-, Hals- & optische Stellreflexe / Stellreflexe: d.s. die „normale“ Stellung des Kopfes und der Extremitäten herbeiführende Reflexe des Bewegungsapparates oder ‚anders‘ ausgedrückt: es handelt sich um „Balance-Reflexe“ des motorischen Systems]
Die Patienten werden zunehmend unsicher, ihre aufrechte Körperhaltung zu kontrollieren.
Zunächst werden sie etwas Gang-unsicher, können sich, wenn sie angestoßen werden, nicht mehr gut abfangen, so dass sie größere Ausfallschritte vollführen müssen. Die Wendebewegung wird unsicher, die Patienten kommen dabei ins Trippeln.
Sie haben nun Angst, zu fallen. Diese Fallangst kann sie noch zusätzlich zur motorischen Behinderung beeinträchtigen.
Im fortgeschrittenen Krankheitsstadium können sie ihre Geh- und Steh-Fähigkeit verlieren.
Neben diesen Kardinal-Symptomen kommt es im Krankheitsverlauf in individuell unterschiedlichem Ausmaß zu weiteren Symptomen, vor allem von Seiten des Vege-tativums, der Stimmung und des Gedächtnisses.
V. Vegetative Störungen
(Funktionelle/somatoforme Störungen)
Ein ständiger Speichelfluss („Pseudo-Hypersalivation“) ist Folge der Schluck-Störung; objektiv produzieren Parkinson-Patienten weniger Speichel als Gesunde.
Durch gesteigerte Talg-Produktion kommt es zu einem Salben-Gesicht.
Im fortgeschrittenen Krankheitsstadium kommt es zu Kreislauf-Regulations-Störungen (orthostatische Hypotonie). Nicht selten ist der Blutdruck im Liegen erhöht und sackt dann in aufrechter Körperhaltung ab, so dass die Patienten fälschlicherweise mit Medikamenten gegen hohen Blutdruck behandelt werden.
Blasenfunktionsstörungen behindern die Patienten im sozialen Leben erheblich. Meist steht zu Beginn ein imperativer Harndrang, der die Patienten urplötzlich überfällt. Dabei kommt es oft zu Harndrang schon bei kleinen Füllungsmengen (Pollakisurie). Schließlich schaffen sie es – auch aufgrund der Akinese – nicht mehr rechtzeitig, die Toilette aufzusuchen.
Sexualfunktionsstörungen sind häufig und betreffen sowohl die Libido wie auch die Potenz.
Es kommt auch zu Bewegungsstörungen des Magen-Darm-Trakts, die ebenfalls oftmals der Manifestation der motorischen Störung Jahre vorausgehen.
Vor allem die Verstopfung wird in ihrer Bedeutung für die Lebensqualität der Betroffenen erheblich unterschätzt. Durch die Bewegungsstörung des Magen-Darm-Trakts ist die Resorption der Medikamente eingeschränkt bzw. kann unberechenbar sein.
Temperaturregulationsstörungen führen vor allem zu einer verminderten Hitzetoleranz durch eine Störung des reflektorischen Schwitzens und der reflektorischen Gefäßerweiterung bei Wärme.
Dies kann bei fortgeschrittener Erkrankung zu lebensbedrohlichen hoch-fieberhaften Zuständen führen.
Besonders nachts kommt es zu unkontrollierten Schweißausbrüchen. Die Störung kann durch plötzlichen Entzug der Parkinson-Medikamente zu lebensbedrohlichen Krisen führen.
VI. Psychopathologische Veränderungen
(Psychische Störungen)
Die psychopathologischen Veränderungen sind für die Alltagsbehinderung der Parkinson-Patienten von ganz erheblicher Bedeutung und werden oft unterschätzt, da sie nicht so augenfällig sind wie die motorischen Phänomene.
Eine niedergedrückte Stimmung ist oft ein Frühsymptom und kann der Diagnose Jahre vorausgehen. Sie betrifft mindestens 40% der Patienten.
Bei fortgeschrittener Erkrankung kommt es auch zu kognitiven (= das Denken betreffend) Störungen, zunächst zu einer Verlangsamung der Denk-Abläufe, die man früher als „Bradyphrenie“ bezeichnete; bis es zuletzt vielmals zur regelrechten Denkhemmung/Denksperre/Denkblockade kommt.
Halluzinationen, zumeist optische, sind oft Vorboten der hirn-organischen Beeinträchtigung. Provoziert werden sie meistens zunächst durch die Medikation, vor allem durch die Dopamin-Agonisten (s.u.). Die optischen Halluzinationen können sich weiter ausprägen bis hin zu einem meist als äußerst bedrohlich empfundenen szenischen Erleben, z.B. eingekerkert zu sein.
In diesem Zustand werden die Patienten oft in panischer Angst aggressiv, was nicht selten verkannt wird und daher zu falschen therapeutischen Konsequenzen führt.
Über den Jahrzehnte dauernden Verlauf der Erkrankung entwickelt sich nicht selten eine Lewy-Körperchen-Demenz.
Eine Besonderheit der kognitiven Störungen bei der Parkinson-Erkrankung ist die oft stark fluktuierende Aufmerksamkeitsstörung mit immer wieder luziden (bewußseinsklar) Augenblicken.