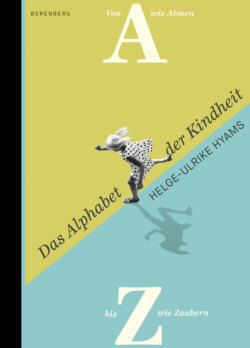Читать книгу Das Alphabet der Kindheit - Helge-Ulrike Hyams - Страница 42
Film
Оглавление»Was ist bewegender als eine Liebesgeschichte mit einem Kind?«
Roberto Benigni
Ich kenne eine Frau, die den Film Ronja Räubertochter siebenmal im Kino gesehen hat. Es musste Kino sein! Nirgends, so meint sie, gibt es einen so ekstatischen Frühlingsschrei wie in diesem Film. Nicht einmal im wirklichen Leben selbst. Warum muss eine erwachsene Frau, Pfarrerin, Mutter von Töchtern, ins Kino gehen, um sich diese Sehnsucht nach dem archaischen Frühlingsschrei zu erfüllen? Warum genügt es nicht, das wunderbare Buch von Astrid Lindgren zu lesen? Warum muss es Kino sein?
Die Antwort ist einfach: Gute Filme gehen unter die Haut. Filmemacher haben ein sensibles und gleichzeitig scharfes Sensorium für den Menschen und was ihn umtreibt. Sie wagen sich vor und erspüren den Zeitgeist oft früher als andere. Und gleichzeitig wissen sie auch, dass die Seele des Menschen konservativ ist und sich deren Urbilder über die Zeiten hinweg immer gleichen. In diesem Spannungsfeld werden hochwertige Filme gemacht, und was das jeweils Besondere ausmacht, ist die Mischung dieser beiden Pole – abgesehen von der technischen und ästhetischen Qualität der Kamera.90
Hinzukommt, dass Filmemacher eine besondere Wahrnehmungsart haben, die Dinge der Welt zu sehen, beziehungsweise nicht nur zu sehen, sondern auch innerlich aufzunehmen. Cineasten haben eine coenästhetische Wahrnehmung – wie Clowns, Musiker, Maler, Flieger, Akrobaten – und eben wie Kinder! Dem Psychoanalytiker und Kinderarzt René Spitz verdanken wir eine nähere Beschreibung dieser besonderen Art des Aufnehmens von Sinneseindrücken, die er als das früheste Kommunikationssystem des Menschen überhaupt beschreibt. Darin finden sich gebündelt »Gleichgewicht, Spannungen (der Muskulatur und andere), Körperhaltung, Temperatur, Vibration, Haut- und Körperkontakt, Rhythmus, Tempo, Dauer, Tonhöhe, Klangfarbe, Resonanz, Schall und wahrscheinlich noch eine Reihe anderer, die der Erwachsene kaum bemerkt, und die er gewiss nicht in Worte fassen kann«.91 Das sind die Zeichen und Signale, innerhalb derer sich das neugeborene Menschenkind bewegt – das ist seine Sprache. Und das ist die Sprache der oben genannten Menschengruppen (Clowns, Musiker usw.) und die der modernen Filmemacher und Schauspieler. (René Spitz hat Letztere leider unterschlagen, dabei musste ihm zumindest Charlie Chaplin gut vertraut gewesen sein). Gerade sie wollen den Betrachter nicht (nur) auf der rationalen, sprachlich geordneten Wahrnehmungsebene erreichen, sondern auch in den tieferen Schichten der Emotionen. Hier einige Beispiele:
Kein Buch über Liebe und Bindung zwischen Vater und Kind berührt uns wie Charlie Chaplins Der Vagabund und das Kind (The Kid, 1921). Keine Abhandlung über Scheidung lässt uns so mitleiden wie der Film Kramer gegen Kramer (Kramer vs. Kramer, 1979). Im französischen Film Sie küssten und sie schlugen ihn (Les 400 coups, François Truffaut, 1959) erfahren wir alles über schlechte Eltern, ignorante Lehrer, Kinosucht und die Notwendigkeit von Kinderlügen.
Die Verlassenheit und die Angst eines Kindes durchlebt man bei Oliver Twist, und zwar sowohl in dem alten englischen Meisterwerk von 1948 als auch in Roman Polanskis Verfilmung von 2005. Ein Gespür und zugleich Erschauern über die Folgen frühkindlicher Traumatisierung – hier die abrupte Trennung von den Eltern – vermittelt uns Orson Welles’ Meisterwerk Citizen Kane aus dem Jahre 1949. Eine Ahnung, wie ein nicht-erzogenes, sogenanntes wildes Kind fühlt – ja: fühlt –, bekommen wir angesichts der Regenszene in Der Wolfsjunge (L’enfant sauvage, François Truffaut, 1970).
Die Lust eines Kindes, das sich durch keine Moral- und Erziehungsregeln der Welt an seiner Entdecker- und Fragefreude einschränken lässt, erleben wir in Zazie (Zazie dans le métro, 1960) von Louis Malle. Und derselbe Regisseur bringt uns zum Weinen mit seinem Film Auf Wiedersehen, Kinder (Au revoir les enfants, 1987).
Wir erleben die grenzenlose Tiefe der Vatersehnsucht in dem brasilianischen Filmkunstwerk Station Central (Central do Brazil, 1998) von Walter Salles. Wir begeben uns in die Abgründe der hoffnungslosen und verirrten Jugendlichen in den Megastädten in Luis Buñuels Klassiker Die Vergessenen (Los Olvidados, 1950). Und schließlich sind wir zerrissen zwischen Lachen und Weinen in Roberto Benignis anrührendem Film Das Leben ist schön (La vita è bella, 1997).
Der französische Dichter Jacques Prévert, der auch Drehbücher verfasste – unvergesslich vor allem Die Kinder des Olymp92 –, beschreibt einmal die Aufregung seiner sonntäglichen Kinobesuche mit seinen Eltern, die fast einem Ritual glichen.93 Das Kino hebt, anders als das Fernsehgerät zu Hause, aus dem normalen Zeitgefüge heraus und hinein in ein anderes Zeit- und Raumgefühl. Und wirklich wertvolle Filme ähneln ein bisschen den Märchen. Sie enthalten Botschaften für jede Generation. Alt oder jung, jeder nimmt sich aus dem Film, was er für sich braucht, was seinem Geist und seiner Seele Nahrung gibt. Die Befürchtung mancher Erwachsener, Kinder könnten noch nicht alles verstehen, ist falsch. Sie holen sich genau das, wofür sie gegenwärtig empfänglich beziehungsweise reif sind. Für sie Unverständliches lassen sie beiseite, überhören und übergehen es und orientieren sich an dem, was für sie stimmig ist. Später dann, wenn diese Kinder herangewachsen sind, kann es durchaus sein, dass sie die Filme längst vergessen haben. Nicht jedoch die langen Nachmittage, an denen sie Seite an Seite mit ihren Eltern, mit Großeltern, Geschwistern oder Freunden – oder womöglich auch ganz allein – auf den roten Samtsesseln in einer anderen Welt versunken waren. Mag sein, dass sie am Ende einzig das Rot erinnern. Aber was für ein Rot!