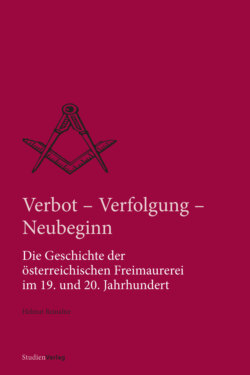Читать книгу Verbot, Verfolgung und Neubeginn - Helmut Reinalter - Страница 17
10. Neuorientierung der Historiographie
ОглавлениеDabei handelte es sich um eine Neuorientierung und um einen Perspektivenwechsel in der Geschichtsschreibung. Die fruchtbarste neue Perspektive war der Aspekt der „longue durée“, worunter man die Vorstellung verstand, dass die Triebkräfte der Geschichte in langen Zeitabläufen wirken und sich nur in ihnen erfassen lassen. Diese Theorie der langen Zeitabläufe hat auch die Annäherung zwischen der Historik und der Ethnologie oder Anthropologie gefördert, die allerdings nicht spannungsfrei verlief. Febvre und Bloch, die sich besonders mit der Kollektivpsychologie und den Wechselfällen des Geistes in der Geschichte auseinandersetzten, haben so den Weg zur Mentalitätengeschichte bereitet. Seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts rief das Thema der Mentalitäten eine Umwälzung der Historiographie hervor. An die Stelle des privilegierten „Homo politicus“ trat der „Homo humanus“. Geschichte wurde auf diese Weise allmählich, insbesondere in der französischen Geschichtsschreibung, zu einer Historischen Anthropologie. Ihr Bestreben war nicht mehr, das Handeln des irgendwie als gegebenen oder fertigen Menschen zu erklären, sondern den Prozess der Menschwerdung darzustellen, also die Prozesse zu untersuchen, durch die Menschen zu dem geworden sind, was sie jeweils waren. Damit verband sich die wichtige Frage, welchen Anteil der Mensch als denkendes, fühlendes, wünschendes Wesen an diesen Prozessen hatte. Es geht hier also um historische Subjektivität, um vergangenes Seelenleben, um vergangene Gefühle und Sensibilitäten.
Heute steht die Mentalitätengeschichte, wie bereits erwähnt, im Zentrum der Historischen Anthropologie. Ihr Spektrum ist groß und reicht von klassischen Zivilisationsgeschichten bis zu den Werken der „Intellectual History“, von Untersuchungen zur Mentalität verschiedenster sozialer Gruppierungen bis zu historisch ästhetischen Schriften, die sich auf das spezifische Lebensgefühl einer Zeit konzipieren. Dazu gehören vor allem Arbeiten zur Volkskultur, Volksfrömmigkeit und zur Sozialgeschichte der Ideen.82 Mentalitätengeschichte ist offenbar thematisch im Schnittpunkt zwischen kognitiven und ethischen Bestimmungen, zwischen bewussten Vorstellungen und praktischen Verhaltensweisen angesiedelt. Sie umfasst einen sehr weiten Bereich, der von den zu einer bestimmten Sachkultur gehörigen Praktiken und Formen des Umgangswissens und den kategorialen Formen des Denkens bis zu den kollektiven Affekten und Sensibilitäten reicht. Daher sind Mentalitäten nicht nur Vorstellungen, Einstellungen und Regeln, sondern auch gefühlsmäßig getönte Orientierungen. Mentalitäten sind die Matrices, die das Gefühl erst in seine erkennbaren und gleichzeitig benennbaren Bahnen lenken und kognitive, ethische und affektive Dispositionen umschreiben.83 Mentalitäten liegen wahrscheinlich nicht im Bereich der Ideen und des Ideologischen, weil Ideen eines Menschen austauschbar und beliebig sind. Wenn man den Menschen genauer kennen und verstehen will, muss man in die Schicht der Glaubensgewohnheiten vorstoßen, also in den Bereich seiner profunden Selbstverständlichkeiten, die er selten bewusst denkt, aber stets empfindet und lebt. Mentalitäten materialisieren sich daher in den von der Geschichtswissenschaft früher weitgehend ausgeklammerten Bereichen des Denkens, Fühlens und Handelns.
Wie die neuere Historiographie zeigt, hat die Mentalitätengeschichte mehrere wichtige Problemfelder erschlossen, wie z.B. die verschiedenen Glaubens- und Wissensformen, auch ihre Verbindung und Führung von Menschen, die Orte, Weisen und Gegenstände des Denkens bzw. der spirituellen Praxis, insbesondere die integrative Funktion des Denkens, das Verhältnis von Denken, Wissen oder Nichtwissen und die Angst, die Prozesse der Rationalisierung, den Volksglauben, den Aberglauben und die Entchristlichung, die Disziplinierung und Moralisierung, die Entwicklung des Wirtschaftsverhaltens und die Entstehung des kapitalistischen Geistes, die bürgerlichen Lebensformen, die Kommunikationsformen im allgemeinen, die Feste, das Brauchtum und die Kultur, wobei die Schwerpunkte meistens auf den kollektiven Vorstellungen und Verhaltensweisen liegen.84
Für die Rekonstruktion von zum Teil unbewussten Wahrnehmungs- und Denkstrukturen sind für die Mentalitätsgeschichte vor allem die Prozesse der Sinnproduktion durch Sprache wichtig, insbesondere der Gebrauch von Metaphern und Kollektivsymbolen. Darüber hinaus können auch die für ein Verständnis historischer Handlungen relevanten Einstellungen und Werte, die nicht explizit formuliert werden, aus der Gesamtheit aller Beschreibungen ermittelt werden, mit deren Hilfe Individuen ihre Wirklichkeitsmodelle konstruieren. Wie dieser Ansatz forschungspraktisch umgesetzt werden kann, verdeutlichen Kategorien, wie sie z.B. von Jean Piaget entwickelt und verwendet wurden. Diese Modelle sind besonders bedeutsam für die Operationalisierung der Frage, wie mentale Strukturen aufgebaut und auf welche Weise Wissen und Begriffe erworben werden.85
Da es bei historischer Forschung auch darum geht, Handlungen zu erklären, braucht die Geschichtswissenschaft Konzepte, die die Beziehung zwischen dem Wirklichkeitsmodell von Menschen und ihrem Verhalten erfassen können. In diesem Zusammenhang spielt besonders die sozialpsychologische Kategorie der „Einstellung“ eine Rolle, mit der die Bedingungsfaktoren, die Handlungen zugrunde liegen, aufgezeigt werden können. Unter dem Begriff „Einstellungen“ versteht man hier relativ lang andauernde, erworbene psychische und physiologische Bereitschaften, die Erfahrungswirklichkeit nach durchgängigen Maßstäben wahrzunehmen, zu bewerten und sich ihnen gegenüber in bestimmter Weise zu verhalten. Das Wirklichkeitsmodell eines Individuums setzt sich durch das gesamte System der „Einstellungen“ zusammen. Als System umfasst es die Summe des Wissens und der Werte und prägt auch die Art und Weise, wie neue Wahrnehmungen aufgenommen und beurteilt werden. Den „Einstellungen“ kommt dabei die Funktion der Wahrnehmungsorientierung zu, und sie haben Systemcharakter. Zu größeren Veränderungen im Wirklichkeitsmodell kommt es nur dann, wenn sich auch zentrale Einstellungen, die als subjektiv wichtig empfunden werden, zu ändern beginnen. In diesem Zusammenhang ist von entscheidender Bedeutung, dass nicht nur „Einstellungen“, sondern auch konkrete Umstände das Handeln der Menschen beeinflussen und prägen. Zwischen „Einstellungen“ und nachfolgendem Verhalten besteht zudem keine deterministische (mechanische) Beziehung, weshalb keine vorschnellen Rückschlüsse von Verhaltensweisen auf das Wirklichkeitsmodell und auf Folgerungen von Ideen zu Handlungen gezogen werden sollten. Auf diese komplexe Beziehungsgeflecht wurde in der neueren Forschung ausdrücklich hingewiesen, wobei man sich vor allem mit der Erklärung des Verhaltens von Hexenverfolgungen und Hexenprozessen in England beschäftig hat. Diesbezüglich wurde betont, dass eine Analyse des Wirklichkeitsmodells des Individuums ohne Bezug auf die Erfahrungen mit der Umwelt als unzureichend einzustufen sind.86
Diese hier aufgezeigten und kommentierten neuen Richtungen und Tendenzen in der Geschichtswissenschaft sollten auch von der genuin spezifischen masonischen Forschung stärker berücksichtigt werden, um einen wissenschaftlichen Standard sichern zu können. Sehr häufig sind masonische Forschungen im engeren Sinne Vereinsgeschichten oder Biographien, die zwar für einzelne Logen-Chroniken und Entwicklungsgeschichten Fakten enthalten, aber nur durch eine enge Kooperation mit der profanen Freimaurerforschung an Qualität und Wissenschaftlichkeit gewinnen.
Obwohl die neuere profane Freimaurerforschung auf eine beachtliche Leistung zurückblicken kann, sind heute noch zahlreiche Forschungslücken zu schließen. Dabei müsste sie sich vor allem auf folgende Themen und Aufgabenbereiche konzentrieren: Herkunft und Aufstieg der Freimaurerei, Klärung der verschiedenen Traditionen, Richtungen und Obedienzen, die Herausarbeitung der geistigen, sozialen und politischen Einflüsse der Bruderkette, die Wurzeln und die Entstehung der Hochgrade, die Bedeutung der Aufklärung, des Rationalismus und der Vernunft und deren Verhältnisse zu Mystik, Esoterik und Hermetik, die stärkere Differenzierung zwischen regulärer Freimaurerei und der para- und pseudomaurerischen Geheimbünden und die Klärung des Verhältnisses zwischen Freimaurerei und Religion, Kirche und Kultur. Es fehlen auch nach wie vor fundierte Studien zur Sozialgeschichte der Freimaurerei, zur Geschichte der freimaurerischen Historiographie und zu den bedeutsamen Freimaurerforschern.87 In methodischer Hinsicht sollte die künftige Freimaurerforschung – wie bereits betont – noch viel stärker als bisher interdisziplinäre und multiperspektivische Ansätze, neue Methoden und theoretische Überlegungen berücksichtigen. In diesem Zusammenhang ist allerdings darauf hinzuweisen, dass sich Freimaurerei und Geheimgesellschaften nicht immer mit zweckrationalen Erklärungsmustern erfassen und interpretieren lassen. Trotzdem darf die freimaurerische Geschichtsforschung den wichtigen erkenntnistheoretischen Gesichtspunkt der Rationalität und der Vernunft nicht vernachlässigen. Da die Freimaurerei ein weltweites Phänomen darstellt, müsste die Forschung bei der Klärung ihres Stellenwertes und ihrer Bedeutung im politischen, sozioökonomischen, wirtschaftlichen und kulturellen-geistigen Entwicklungsprozess der Neuzeit und Gegenwart internationale Formen der Kooperation finden, zumal nur auf einer internationalen Ebene neben regionalen, ideologischen und institutionellen Unterschieden auch übernationale Gemeinsamkeiten aufgezeigt werden können. Dies trifft auch für die engere Erforschung der österreichischen Freimaurerei zu.
______________
1 Vgl. dazu H. Reinalter, Zur Aufgabenstellung der gegenwärtigen Freimaurerforschung, in: Freimaurer und Geheimbünde im 18. Jahrhundert in Mitteleuropa, hg. von H. Reinalter, Frankfurt/M. 1983, S. 9 ff.; ders., Schwerpunkte und Tendenzen der freimaurerischen Historiographie, in: Tijdschrift voor de Studie van de Verlichtung en van het vrije Denken 3–4 (1984), S. 273 ff.; ders., Was ist Freimaurerei und masonische Forschung?, in: Aufklärung und Geheimgesellschaften, hg. von H. Reinalter, München 1989, S. 1 ff.; ders., Neue Tendenzen in der Geschichtsschreibung und ihre Bedeutung für die freimaurerische Historiographie, in: Freimaurerische Historiographie im 19. Und 20. Jahrhundert, hg. von H. Reinalter, Bayreuth 1996, S. 11 ff.; ders., Freimaurerische Forschung heute, in: Zeitschrift für Internationale Freimaurer-Forschung 1 (1999), S. 9 ff.; ders., Freimaurerische Forschungsperspektiven in Europa, in: Zeitschrift für Internationale Freimaurer-Forschung 29 (2013), S. 39 ff.; ders., Freimaurerische Forschungsperspektiven in Europa, in: Deutsche und österreichische Freimaurerforscher, hg. von H. Reinalter, Innsbruck 2016, S. 9 ff. (auch für das Folgende)
2 Vgl. dazu G. R. Kuéss, Die großen deutschen Historiker der Freimaurerei, Hamburg 1960; W. Begemann, Freimaurerei in England, 2 Bücher, Berlin 1909/1910; ders., Vorgeschichte und Anfänge der Freimaurerei in Irland, Berlin 1911; ders., Vorgeschichte und Anfänge der Freimaurerei in Schottland, 2 Bücher, Berlin 1913/1914; B. Beyer, Das Fundament der Freimaurerei, Krefeld 1947; ders., Das Lehrsystem des Ordens der Gold- und Rosenkreuzer, Graz 2008; ders., Der Kampf der großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland gegen die humanitäre Freimaurerei, Bayreuth 1927; ders., Geschichte der Großloge zur Sonne, 3 Bde., Frankfurt 1954/55; H. Boss, Die Geschichte der Freimaurerei. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte, Aarau 1894; J. G. Findel, Geschichte der Freimaurerei von der Zeit ihres Entstehens bis auf die Gegenwart, Leipzig 1878; ders., Grundsätze der Freimaurerei im Völkerleben, Leipzig 1884; L. Keller, Die Sozietät der Maurer und die älteren Sozietäten, Berlin 1904; ders., Die italienischen Akademien des 18. Jahrhunderts und die Anfänge des Maurerbundes in den romanischen und nordischen Ländern, Berlin 1905; ders., Die geistigen Grundlagen der Freimaurerei und das öffentliche Leben, Jena 1911; ders., Die Freimaurer. Eine Einführung in ihre Anschauungswelt und Geschichte, Berlin 1914; G. B. Kloss, Bibliographie der Freimaurer und der mit ihr in Verbindung gesetzten geheimen Gesellschaften, Graz 1970; ders., Die Freimaurerei in ihrer wahren Bedeutung aus den alten und ächten Urkunden der Steinmetzen, Masonen und Freimaurer nachgewiesen, Graz 1970; ders., Geschichte der Freimaurerei in England, Irland und Schottland aus ächten Urkunden dargestellt (1658–1784) Nebst einer Abhandlung über die Ancient Masons, Leipzig 1847; ders., Geschichte der Freimaurerei in Frankreich aus ächten Urkunden dargestellt (1725–1830), 2 Bände, Darmstadt 1852–1858 (Photomechanischer Nachdruck Graz 1971); E. Lennhoff, Die Freimaurer, Wien 1928; ders., Politische Geheimbünde. Ideen-Rituale-Aktionen, Wien 1931. Neuauflage München-Wien 1968; ders. (Hg.), Die Gegenwartsmaurerei. Gesicht-Geist-Arbeit. Festschrift der Großloge von Wien anlässlich des zehnjährigen Jubiläums am 08. Dezember 1928, Wien 1928, ders., Die nordamerikanische Freimaurerei. Ihr Geist, ihre Tätigkeit, ihre Tendenzen, Basel 1930; ders./O. Posner, Internationales Freimaurer Lexikon, Wien 1932.
3 H. Reinalter, Aufklärung, Humanität und Toleranz. Die Geschichte der österreichischen Freimaurerei im 18. Jahrhundert, Innsbruck-Wien-Bozen 2017.
4 L. Lewis, Geschichte der Freimaurerei in Österreich, Wien 1861; vgl. auch den Beitrag von R. Hubert über „Freimaurerische Historiographie im 19. und 20. Jahrhundert – Forschungsbilanz Österreich“, in: Freimaurerische Historiographie im 19. und 20. Jahrhundert. Forschungsbilanz-Aspekte-Problemschwerpunkte, hg. von H. Reinalter, Bayreuth 1996, S. 39 ff.
5 L. Abafi (pseud. für Ludwig Aigner) Geschichte der Freimaurerei in Österreich-Ungarn, Budapest von 1890–1899.
6 Latomia. Freimaurerische Vierteljahrs-Schrift, erschienen in Leipzig; Der Zirkel, Wien 1871–1914.
7 Der Zirkel, II. Jg. Nr. 5, 01. März 1872; Genesis des nicht-politischen Vereins „Humanitas“ in Wien, in: Arthur Storch (pseud. Für Franz Julius Schneeberger), Skizzen über Freimaurerei und Odd-Fellowtum, S. 52 ff.
8 Z.B. Gustav Brabbées „Maurerische Reminiszenzen aus meinen Jugendjahren“ oder „Subrosa“, Wien 1879; vgl. auch der Zirkel, II. Jg. Nr. 3, 1.2, 1873, S. 21 ff.
9 Vgl. dazu R. Hubert, Freimaurerische Historiographie im 19. und 20. Jahrhundert, S. 41.
10 J. Goldenberg, Staat, Kirche und Freimaurerei, Wien 1878.
11 H. Wagner, Aufgaben der freimaurerischen Forschung in Österreich, in: Quatuor Coronati-Berichte 1 (1974), S. 7.
12 Vgl. dazu R. Hubert, Freimaurerische Historiographie im 19. und 20. Jahrhundert, S. 42.
13 H. Wagner, Aufgaben der freimaurerischen Forschung in Österreich, S. 7.
14 Allgemeines Handbuch der Freimaurer, 3. Völlig umgearbeitete und mit den neuen wissenschaftlichen Forschungen in Einklang gebrachte Auflage von Lennings Enzyclopädie der Freimaurerei, Leipzig 1900 (II. Band mit Artikeln über Österreich).
15 E. E. Eckert, Der Freimaurer-Orden in seiner wahren Bedeutung, Dresden 1852; H. Reinalter, Eduard Emil Eckert (1825–1866), in: Handbuch der Verschwörungstheorien, hg. von H. Reinalter, Leipzig 2018, S. 97 f.
16 Interessante Enthüllungen aus der geheimen Werkstätte der Freimaurerei mit besonderer Rücksicht auf Österreich-Ungarn, Würzburg 1888.
17 Die Freimaurer Österreich-Ungarns. 12 Vorträge, Wien 1897.
18 F. Stauracz, Die Ziele der Freimaurerei, Wien 1911, S. 27; ders., Die Loge an der Arbeit, Wien 1906, S. 39; ders., Freimauschelei. Die Ziele der Gründer und Protektoren des Vereines „Freie Schule“, Wien 1906; ders., Wesen und Ziele der Freimaurerei, Wien 1912.
19 B. Smith, Heinrich Himmler 1900–1926. Sein Weg in den deutschen Faschismus, München 1979; R. Markner, Friedrich Wichtl (1872–1921), in: Handbuch der Verschwörungstheorien, S. 334 ff.
20 F. Hergeth (pseud. für Paul Heigl), Aus der Werkstatt der Freimaurer und Juden im Oesterreich der Nachkriegszeit, Graz 1927.
21 R. Hubert, Freimaurerische Historiographie im 19. und 20. Jahrhundert, S. 44 f.
22 Vgl. dazu L. Brügel, Aus der Frühzeit der österreichischen Freimaurerei, 1848–1869. Mit bisher unveröffentlichten Aktenstücken, in: Die Gegenwartsmaurerei. Gesicht/Geist/Arbeit. Festschrift der Großloge von Wien, hg. von E. Lennhoff, Wien 1928; ders., Aus den Tagen des „guten Kaisers Franz“, in: Wiener Freimaurer-Zeitung Nr. 11 und 12 (1926).
23 O. E. Deutsch, Mozart und die Wiener Logen. Zur Geschichte seiner Freimaurer-Kompositionen, Wien 1932; E. Komorzynski, Emanuel Schikaneder, Wien 1951.
24 R. Cefarin, Kärnten und die Freimaurerei, Wien 1932.
25 E. Lennhoff/ O. Posner, Internationales Freimaurer-Lexikon, Wien 1932.
26 E. Lennhoff, Die Freimaurer, Wien 1929.
27 Vgl. dazu H. Reinalter, Eugen Lennhoff (1891–1944), in: Deutsche und österreichische Freimaurerforscher, hg. von H. Reinalter, Innsbruck 2016, S. 109 ff.
28 Z.B. J. Reis, Die österreichische Freimaurerei, Wien 1932; J. Fried, Alois Hoffmann (1760–1806), Diss., Wien 1930; B. Einleger, Die Freimaurerei als Faktor der Aufklärung von Maria Theresia bis Franz II., Diss., Wien 1930; E. Kaforka, Der Kampf zwischen Aufklärern und Obscuratnen in Wien, Diss., Wien 1931; A. Beck, Der Einfluss der Freimaurer auf die kirchlichen Reformen Josephs II., Diss., Wien 1935; O. Schott, Die Geschichte der Freimaurer in Wien von den Anfängen bis zur Gegenwart, Wien 1939; E. Schwarz, Die Freimaurer in Österreich, vor allem in Wien unter Kaiser Franz II. 1792–1809, Wien 1940.
29 E. Zellweker, Das Urbild des Sarastro. Ignaz von Born, Wien 1953.
30 Diese Baustücke befinden sich in der Baustücksammlung der Großloge von Österreich; vgl. dazu R. A. Minder, Gustav Kuéss (1895–1965) und sein Nachlass im Archiv der Großloge von Österreich, in: Quatuor Coronati-Berichte 35 (2015), S. 103 ff.
31 G. Kuéss/B. Scheichelbauer, 200 Jahre Freimaurerei in Österreich, Wien 1959; Festschrift zum 60-jährigen Bestande der Loge „Lessing zu den 3 Ringen“, Or. Wien 1897–1957, hg. von G. Kuéss, Wien 1957.
32 G. R. Kuéss, Die großen deutschen Historiker der Freimaurerei (Die Blaue Reihe 7), Hamburg 1957.
33 G. R. Kuéss, Die Vorgeschichte der Freimaurerei im Lichte der englischen Forschung (Die Blaue Reihe 11), Hamburg 1959.
34 Vgl. dazu G. K. Kodek, Die Kette der Herzen bleibt geschlossen. Mitglieder der österreichischen Freimaurer-Logen 1954–1985, Wien 2014, S. 132; R. A. Minder, Gustav Kuéss (1895–1965), S. 105 ff.
35 G. Kuéss, Zur Geschichte der Wiener Großlogen-Bibliothek und deren musealen Sammlungen (1964), in: Archiv der Großloge von Österreich, Baustücke-Sammlung.
36 G. Kuéss, Museum und Sammlungen der Großloge, in: Lessing zu den 3 Ringen. Manuskript für Brüder, Archiv der Großloge von Österreich; vgl. auch R. A. Minder, Gustav Kuéss (1895–1965), S. 107.
37 H. Obrecht, Der Kampf um die staatliche Anerkennung der Freimaurer in Österreich durch die katholische Öffentlichkeit, Diss., Wien 1950; L. Franc, Die Wiener Realzeitung. Ein Beitrag zur Publizistik der theresianischen Epoche, Diss., Wien 1952; P. Hofer, Ignaz von Born. Leben – Leistung – Wertung, Diss., Wien 1955; U. Tschurtschenthaler, Die Publizistik im josephinischen Wien und ihr Beitrag zur Aufklärung, Diss., Wien 1957; G. Junascheck, Die publizistische Tätigkeit der Freimaurer zur Zeit Joseph II. in Wien, Diss., Wien 1964; J. Sura, Die Einflussnahme der Freimaurerei auf karitative und sozialpolitische Einrichtungen in Österreich in der Zwischenkriegszeit, Diss., Wien 1991.
38 G. Kuéss/ B. Scheichelbauer, 200 Jahre Freimaurerei in Österreich, Wien 1959.
39 Vgl. dazu H. Reinalter, Zur Aufgabenstellung der gegenwärtigen Freimaurerforschung, in: Freimaurer und Geheimbünde, S. 9 ff.; ebd., Auswahlbibliographie, S. 178 ff.; É. H. Balázs/L. Hammermayer/H. Wagner/J. Wojtowicz (Hg.), Beförderer der Aufklärung in Mittel- und Osteuropa. Freimaurer, Gesellschaften, Clubs, Berlin 1979, S. 127 ff.; H. Reinalter, Aufklärung – Absolutismus – Reaktion. Die Geschichte Tirols in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, Wien 1974; ders., Franz von Gumer – ein Tiroler Freimaurer, in: Alpenregion und Österreich. Festschrift für Hans Kramer, Innsbruck 1976, S. 117 ff.; ders., Joseph von Sonnenfels und die Französische Revolution, in: Innsbrucker Historische Studien 1 (1978), S. 77 ff.; ders., Joseph II. und die Freimaurerei im Lichte zeitgenössischer Broschüren, in: Unsere Heimat 51/3 (1980), S. 193 ff.; ders., Aufgeklärter Absolutismus und Revolution. Zur Geschichte des Jakobinertums und der frühdemokratischen Bestrebungen in der Habsburgermonarchie, Wien 1980; ders. (Hg.), Jakobiner in Mitteleuropa, Innsbruck 1977; P. F. Barton, Ignaz Aurelius Fessler. Vom Barockkatholizismus zur Erweckungsbewegung, Wien 1990; E. Rosenstrauch-Königsberg, Freimaurerei im josephinischen Wien. Aloys Blumauers Weg vom Jesuiten zum Jakobiner, Wien 1975.
40 Vgl. dazu H. Reinalter, Zur Aufgabenstellung der gegenwärtigen Freimaurerforschung, S. 14 ff. (dort auch weitere Literaturhinweise).
41 Vgl. dazu den Beitrag von E. Krivanec, Die Anfänge der Freimaurerei in Österreich, in: Freimaurer und Geheimbünde im 18. Jahrhundert in Mitteleuropa, hg. von H. Reinalter, Frankfurt/M. 1983, S. 177 ff.; R. Hubert, Freimaurerische Historiographie im 19. und 20. Jahrhundert, S. 46.
42 Ausstellungskataloge des Historischen Museums der Stadt Wien: Zirkel und Winkelmaß. 200 Jahre Große Landesloge der Freimaurer, Wien 1984; Freimaurer. Solange die Welt besteht, Wien 1992; Kataloge der Dauerausstellung des Freimaurermuseums Schloss Rosenau: Die Freimaurer in Österreich. Zur Geistesgeschichte des 18. Jahrhunderts, Wien 1975; Österreichische Freimaurerlogen. Humanität und Toleranz im 18. Jahrhundert, Wien 1976; Österreichisches Freimaurermuseum Schloss Rosenau bei Zwettl, Wien 1994; Kataloge der Sonderausstellungen des Freimaurermuseums Schloss Rosenau: Verbotene Freimaurerei 1848–1918, Wien 1978; Freimaurerei um Joseph II. Die Loge zur Wahren Eintracht, Zwettl 1980; Englische Freimaurerei, Wien 1982; Idee und Ideale. Aufklärung – Klassik – Romantik, Wien 1986; Der kurze Traum. 1918–1938, Wien 1988; Bruder Wolfgang Amadeus Mozart, Wien 1990; 250 Jahre Freimaurerei in Österreich, Wien 1992.
43 Hinzuweisen wäre hier auf zwei Symposien: Ungarns langer Weg durch die Wüste. Beiträge zu einem Symposium 1992 in Budapest, in: Quatuor Coronati-Berichte 14 (1994) und Tschechische Brüder kämpften gegen die Nazis. Beiträge zu einem Symposium 1993 in Prag, in: Quatuor Coronati-Berichte 15 (1995); vgl. auch R. Hubert, Freimaurerische Historiographie im 19. und 20. Jahrhundert, S. 47.
44 Symposium 250 Jahre Freimaurerei in Österreich. Rückblick und Ausblick, hg. von F. Gottschalk und M. Lotteraner, Wien 1993.
45 Zu Helmut Reinalter vgl. die Biographien: L. Mazakarini (Hg.), Helmut Reinalter- Historiker, Philosoph, Maurer, in: Vernunft und Aufklärung versus Vernunft- und Aufklärungskritik. Festschrift für Helmut Reinalter, Wien 2010; A. Schmidt, Geschichtsschreibung im Dienst reflexiver Aufklärung. Festrede vom 7. November 2003 an der Universität Innsbruck anlässlich des 60. Geburtstags von Helmut Reinalter, in: Zeitschrift für Internationale Freimaurer-Forschung 11 (2004), S. 41 ff.; M. Fischer/ M. Gilli/ M. Jochum / A. Pelinka (Hg.), Aufklärung, Freimaurerei und Demokratie im Diskurs der Moderne. Festschrift zum 60. Geburtstag von Helmut Reinalter, Frankfurt / M. 2003, S. 7 f., S. 603 ff.; R. Benedikter, Ein moderner Freigeist in der Postmoderne. Helmut Reinalter zum 60. Geburtstag, in: Kultur, Bildung oder Geist? Skizzen zur Gestalt der europäischen Humanwissenschaften im 21. Jahrhundert, hg. von R. Benedikter, Innsbruck 2004, S. 495 ff.; J. Wallmannsberger / B. Abram (Hg.), Wissenschaft und Öffentlichkeit, Innsbruck 2018, S. 233 ff.
46 Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Marcus_G._Patka.
47 Vgl. dazu A. Önnerfors, Institutionen, Initiativen, Projekte, Zeitschriften und Publikationen der gegenwärtigen Freimaurerforschung – Versuch einer Bestandsaufnahme, in: Zeitschrift für Internationale Freimaurer-Forschung 36 (2016), S. 25 ff.
48 Bisher sind 44 Bde. erschienen.
49 Bisher 22 Bde.
50 Bisher 35 Bde.
51 Schriftenreihe der Forschungsstelle „Demokratische Bewegungen in Mitteleuropa 1770- 1848/49“, Frankfurt/M. (48 Bde.); Vergleichende Gesellschaftsgeschichte und politische Ideengeschichte (21 Bde.).
52 Vgl. dazu die Schriftenverzeichnisse in: Aufklärung, Freimaurerei und Demokratie im Diskurs der Moderne, S. 611 ff.; L. Mazakarini (Hg.), Vernunft und Aufklärung versus Vernunft- und Aufklärungskritik, S. 283 ff.; H. Reinalter, Die Zukunft der Freimaurerei, Leipzig 2018, S. 217 ff. (Freimaurerische Bibliographie von Helmut Reinalter).
53 Vgl. dazu H. Reinalter, Die Zukunft der Freimaurerei, S. 217 ff.
54 Vgl. dazu H. Reinalter, Die Zukunft der Freimaurerei, S. 219 ff.
55 Österreichische Freimaurer im Nationalsozialismus. Treue und Verrat, Wien 2010 und Freimaurerei und Sozialreform. Der Kampf für Menschenrechte, Pazifismus und Zivilgesellschaft in Österreich 1868–1938, Wien 2011.
56 Vgl. dazu https://de.wikipedia.org/wiki/Marcus_G._Patka; Schriften (Auswahl).
57 Auswahlweise seien hier erwähnt R. Hubert, Die Freimaurerei in der Zwischenkriegszeit, in: 250 Jahre Freimaurerei in Österreich. Österreichisches Freimaurermuseum Schloss Rosenau bei Zwettl, Wien 1992, S. 51 ff.; ders., Freimaurerei in Österreich 1871–1938, in: Zirkel und Winkelmass. 200 Jahre Große Landesloge der Freimaurer. 86. Sonderausstellung des Historischen Museums der Stadt Wien, Wien 1984, S. 31 ff.; ders., Die Grenzlogenzeit. Österreichische Freimaurerei 1795–1918, in: 300 Jahre Freimaurer. Das wahre Geheimnis, Ausstellungskatalog, Wien 2017, S. 90 ff.
58 A. Giese, Die Freimaurer, Wien 1991; ders., Freimaurer heute – Lebens- und Geisteshaltung der Freimaurer, Wien 2007.
59 N. Knittler, Der verlorene Koffer. Eine Geschichte der österreichischen Freimaurerei während des Nationalsozialismus, Wien (1988); ders., Der verlorene Koffer. Briefe aus der Emigration nach 1945, Wien 1988.
60 E. Semrau, Erleuchtung und Verblendung. Einflüsse esoterischen Gedankenguts auf die Entwicklung der Wiener Moderne, Innsbruck 2012.
61 G. K. Kodek, Von der Alchemie zur Aufklärung. Chronik der Freimaurerei in Österreich und den Habsburgischen Erblanden 1717–1867, Wien 2011; ders., Zwischen verboten und erlaubt. Chronik der Freimaurerei in der österreich-ungarischen Monarchie 1867–1918 und der I. Republik 1918–1938, Wien 2009; ders., Unbeirrt durch den Lärm der Welt. Chronik der Freimaurerei in der II. Republik Österreich 1945–1985, Wien 2014; ders., Brüder, reicht die Hand zum Bunde. Die Mitglieder der Wiener Freimaurer-Logen 1742–1848, Wien 2011; ders., Unsere Bausteine sind die Menschen. Die Mitglieder der Wiener Freimaurer-Logen 1869–1939, Wien 2009; ders., Die Kette der Herzen bleibt geschlossen. Mitglieder der österreichischen Freimaurer-Logen 1945–1985, Wien 2014.
62 R. A. Minder, Freimaurer Politiker Lexikon, Innsbruck 2004.
63 M. Kraus (Hg.), Die Freimaurer, 2. Aufl., Wien 2011.
64 M. H. Weninger, Loge und Altar. Über die Aussöhnung von katholischer Kirche und regulärer Freimaurerei, Wien 2020.
65 Chr. Rapp/ N. Rapp-Wimberger (Hg.), 300 Jahre Freimaurer. Das wahre Geheimnis, Ausstellungskatalog, Wien 2017.
66 Vgl. dazu den Prospekt: Freimaurerliteratur im Studienverlag, dort sind die einzelnen Reprints angeführt.
67 H. Reinalter (Hg.), Deutsche und österreichische Freimaurerforscher, Innsbruck 2016.
68 Vgl. dazu H. Reinalter, Zur Aufgabenstellung der gegenwärtigen Freimaurerforschung, in: Freimaurer und Geheimbünde im 18. Jahrhundert in Mitteleuropa, hg. von H. Reinalter, Frankfurt / M. 1983, S. 20.
69 Vgl. dazu H. Reinalter, Neue Tendenzen in der Geschichtsschreibung und ihre Bedeutung für die freimaurerische Historiographie, in: Freimaurerische Historiographie im 19. und 20. Jahrhundert. Forschungsbilanz – Aspekte – Problemschwerpunkte, S. 11 ff.
70 Vgl. dazu auswahlweise H. M. Baumgartner / J. Rüsen (Hg.), Seminar: Theorie und Geschichte. Umrisse einer Historik, Frankfurt /M. 1982; G. G. Iggers, Neue Geschichtswissenschaft. Vom Historismus zur Historischen Sozialwissenschaft, München 1978; J. Kocka (Hg.), Theorien in der Praxis des Historikers, Göttingen 1977; J. Kocka/ Th. Nipperdey (Hg.), Theorie der Geschichte. Beiträge zur Historik 3. Theorie und Erzählung in der Geschichte, München 1973; H. Reinalter, Methodenprobleme der Geschichtswissenschaft, in: Methodenfragen der Geisteswissenschaften, hg. von Philip Herdina, Innsbruck 1992, S. 277; M. Riedel, Verstehen oder Erklären? Zur Theorie und Geschichte der hermeneutischen Wissenschaften, Stuttgart 1997.
71 Vgl. dazu J. Rüsen, Historische Vernunft. Grundzüge einer Historik I, Göttingen 1983; ders., Rekonstruktion der Vergangenheit. Grundzüge einer Historik II, Göttingen 1986; ders., Für eine erneuerte Historik, Stuttgart 1976.
72 Vgl. dazu H. Reinalter, Methodenprobleme der Geschichtswissenshaft, in: Methodenfragen der Geisteswissenschaften, S. 277 ff.
73 Vgl. dazu H. Reinalter, Neue Tendenzen in der Geschichtsschreibung, S. 14 f.
74 J. Kocka, Theorien in der Praxis des Historikers, Göttingen 1977; ders., Theorien in der Geschichtswissenschaft, in: Theoriedebatte und Geschichtsunterricht, hg. von P. Leidinger, Paderborn 1982, S. 7 ff.
75 H. Reinalter, Neue Tendenzen in der Geschichtsschreibung, S. 17 ff.
76 Ebd., S. 19 ff.
77 Vgl. dazu H. Reinalter, Neue Tendenzen in der Geschichtsschreibung, S. 20.
78 W. Mommsen, Wandlungen im Bedeutungsgehalt der Kategorie des „Verstehens“, in: C. Meier / J. Rüsen (Hg.), Historische Methode. Beiträge zur Historik 5, München 1988, S. 200 ff.; H. Reinalter, Konstruktivistische Geschichtswissenschaft und Mentalitätshistorie, in: Wissenschaft und Alltag, hg. von F. Wallner, Wien 1995, S. 46 ff.
79 J. Kocka (Hg.), Max Weber, der Historiker, Göttingen 1986; H. B. Müller, Max Weber. Eine Spurensuche, Berlin 2020.
80 Vgl. dazu H.-U. Wehler, Historische Sozialwissenschaft und Geschichtsschreibung. Studien zu Aufgaben und Traditionen der deutschen Geschichtswissenschaft, Göttingen 1980; ders., Geschichte als Historische Sozialwissenschaft, Frankfurt/ M. 1977; G. G. Iggers, Neue Geschichtswissenschaft. Vom Historismus zur Historischen Sozialwissenschaft, München 1978; P. Burke, Offene Geschichte. Die Schule der „Annales“, Berlin 1991; R. Chartier, Geistesgeschichte oder histoire des mentalités, in: D. LaCapra – S.L. Kaplan (Hg.), Geschichte denken, Frankfurt / M. 1988, S. 11 ff.; G. Duby, Über einige Grundtendenzen der modernen französischen Geschichtswissenschaft, in: HZ 241 (1985), S. 543 ff.; J. Le Goff / R. Chartier / J. Revel (Hg.), Die Rückeroberung des historischen Denkens. Grundlagen der Neuen Geschichtswissenschaft, Frankfurt / M. 1990; R. Reichardt, Histoire des Mentalités, in: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 3 (1978); M. Raulff (Hg.), Mentalitäten-Geschichte, Berlin 1989; M. Raphael, Die Erben von Bloch und Febvre. Annales-Geschichtsschreibung und nouvelle histoire in Frankreich 1945–1980, Stuttgart 1994; V. Sellin, Mentalität und Mentalitätsgeschichte in: HZ 241 (1985), S. 555 ff.
81 H. Süssmuth (Hg.), Historische Anthropologie. Der Mensch in der Geschichte, Göttingen 1984; G. Gebauer/ D. Kamper / D. Lenzen / D. Mattenkott / Chr. Wulf / K. Wünsche, Historische Anthropologie, Reinbek b. Hamburg 1989.
82 Vgl. dazu H. Reinalter (Hg.), Neue Perspektiven der Ideengeschichte, Innsbruck 2015; H. Reinalter, Ideengeschichte. Tradition und Aktualität, Innsbruck 2020; A. Dorschel, Ideengeschichte, Göttingen 2010; M. Llanqe / H. Münkler (Hg.), Politische Theorie und Ideengeschichte, Berlin 2007; M. Llanqe, Geschichte der politischen Ideen, München 2012; M. Mulsow / A. Mahler (Hg.), Die Cambridge School der politischen Ideengeschichte, Frankfurt / M. 2010; B. Stollberg- Rilinger (Hg.), Ideengeschichte, Stuttgart 2010.
83 U. Raulff (Hg.), Mentalitäten-Geschichte.
84 Vgl. dazu H. Reinalter, Neue Tendenzen in der Geschichtsschreibung, S. 22.
85 Zu Piaget vgl. hier auswahlweise H. Ginsburg, Piagets Theorie der geistigen Entwicklung, Stuttgart 2004; Th. Kesselring, Jean Piaget, München 1999; I. Scharlau, Jean Piaget zur Einführung, Hamburg 2007.
86 Vgl. dazu H. Reinalter, Neue Tendenzen in der Geschichtsschreibung, S. 22.
87 Vgl. dazu H. Reinalter, Freimaurerische Forschungsperspektiven in Europa, in: Deutsche und österreichische Freimaurerforscher, Innsbruck 2016, S. 9 ff. Dieser Forschungsband enthält allerdings nur bedeutende Freimaurerforscher Österreichs, Deutschlands und der Schweiz, bildet aber eine wertvolle Grundlage zur Erweiterung auf europäische und außereuropäische Freimaurerforscher.