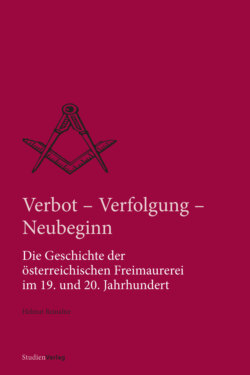Читать книгу Verbot, Verfolgung und Neubeginn - Helmut Reinalter - Страница 23
4. Die Freimaurerei in Österreich nach der Revolution und der Kulturkampf
ОглавлениеLudwig Lewis hatte 1849 leider vergeblich gehofft, dass Vorurteile des katholischen Klerus in Österreich gegen die Freimaurerei verschwinden, und sich die Auffassung bestätigen werde, dass sich die Freimaurerei von konfessionellen Fragen enthalten würde. Die katholische Presse hatte zu dieser Zeit die Freimaurerei scharf angegriffen, wobei die Polemik u.a. in Sebastian Brunners „Wiener Kirchenzeitung“ nach Beginn der Konkordatsverhandlungen zunahm.140 Die Liberalen vermochten sich im Vormärz in Österreich kaum zu artikulieren, da das Polizeisystem und die Zensur starken Druck ausübten. Sie sahen sich daher gezwungen, ihre politischen Ideen, kritischen Reflexionen und Broschüren bei ausländischen Verlagen herauszugeben. Metternich war davon überzeugt, dass auch mit einem liberalen Pressegesetz die politische Ordnung aufrecht erhalten werden könne. So richteten die Wiener Schriftsteller unter Eduard von Bauernfeld eine Petition an den Kaiser, in der sie um ein geregeltes Zensurverfahren nachsuchten. Metternich zeigte sich aber unnachgiebig. Auch in weiteren Adressen und Petitionen wurden liberale Forderungen aufgestellt, wie z.B. die nach Veröffentlichung des Staatshaushalts, nach Mitsprache der Stände, die durch das Bürgertum verstärkt werden sollten, nach Mitsprache an der Steuerbewilligung, nach der Gesetzgebung und nach mehr Öffentlichkeit in der Rechtspflege und Verwaltung. Die Studenten verlangten vor allem Presse- und Redefreiheit, Lehr- und Lernfreiheit an den Universitäten, Gleichstellung der Konfessionen und eine allgemeine Volksvertretung. Doch die Regierung war nicht bereit, auf diese Forderungen einzugehen.141 Im Zusammenhang mit der Entwicklung des Liberalismus in Österreich spielte auch die Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche eine wesentliche Rolle. Aus katholischer Sicht wurde die Freimaurerei in Österreich als treibende Kraft des Laizismus betrachtet, als Vertreterin einer reinen Diesseitskultur und als Hauptförderin der liberalen Richtung bezeichnet. Die katholische Begründung war, dass die Freimaurerei in ethischen Fragen „rein naturalistisch-humanitär … eingestellt sei und in der Metaphysik den undogmatischen Gottesbegriff mit rein subjektiver Binnenzeichnung vertrete“.142
In der Bruderkette wurden allerdings zwei Richtungen unterschieden. Die eine sah im „Allmächtigen Baumeister aller Welten“ ein Symbol des spirituellen Seinsgrunds, das sich als undogmatischer Gottesbegriff verstand, andererseits gab es auch freimaurerische Gruppen, die durchaus an einen persönlichen Gott glaubten. Bei der ersten Richtung spielte die Ethik ohne transzendente Bindung eine große Rolle, die auch als laizistisch bezeichnet werden konnte. Die Ethik aus freimaurerischer Perspektive war immer bestrebt, einen Beitrag zu einer humanistischen und ästhetisch wertvollen Verweltlichung zu leisten. Nach Beginn der Konkordatsverhandlungen gingen die Angriffe gegen die Freimaurerei etwas zurück. Das Konkordat, am 05. November mit einem kaiserlichen Patent erlassen, wurde am 13. November 1855 im Reichsgesetzblatt Nr. 195 publiziert. Damit trat es für die gesamte Monarchie in Kraft. Der Vertrag hob die wichtige Stellung der Kirche in der Monarchie hervor.143
Mit dem Beginn der liberalen Ära seit den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts bemühten sich die Freimaurer, die staatliche Wiederzulassung zu erreichen. So wurde 1865 die Eingabe zur Zulassung der Loge „Zum heiligen Joseph“ vom Ministerium Belcredi mit der Begründung abgelehnt, dass die Freimaurerei einen die Öffentlichkeit ausschließenden Charakter als Geheimbund habe. Besonders heftig trat schon vorher der Advokat Eduard Emil Eckert in zahlreichen Veröffentlichungen gegen die Freimaurer und deren staatliche Anerkennung in Österreich auf. In seinem Buch „Der Freimaurer-Orden in seiner wahren Bedeutung“ (1852)144 unterstellte er der Freimaurerei, dass diese eine Revolution gegen Kirche und Monarchie plane sowie Eigentum, Stände und Innungen in Frage stelle. Seine Schmähschrift leitete er 1852 an das sächsische Kriminalgericht weiter und hoffte, dass er die Auflösung der Freimaurerei erreichen könne. Die Verhandlungen blieben aber erfolglos. Allerdings wurde durch Erlass erreicht, dass Freimaurer als Offiziere der Armee nicht angehören durften. Die Motive für Eckerts Freimaurerhass waren wahrscheinlich darin zu suchen, dass seine Aufnahme in eine Loge abgelehnt wurde.145 Für Eckert war die Freimaurerei schlechthin „das Böse“. Seine antimasonische Agitation begann vor allem nach der Revolution von 1848/49, als er die Behauptung aufstellte, dass die Freimaurer an allen Revolutionen schuld seien. Eckerts Feldzug gegen die Freimaurerei, bei dem er sein Ziel nicht im gewünschten Sinne erreichte, ging von Dresden nach Berlin und nach seiner Ausweisung nach Prag und Wien, wo er die Redaktion der „Historisch-Politischen Blätter“ übernahm. Seine erneuten Hetzschriften gegen die Freimaurerei wurden später von Erich Ludendorff in seiner Offensive gegen die Bruderkette benutzt. Da er im Jänner 1866 in einem Wiener Krankenhaus Selbstmord beging, wurde von den Gegnern der Freimaurerei behauptet, dass er von den Brüdern ermordet worden sei.146
Im Jahre 1858 gab es zahlreiche Schreiben des Chefs der Obersten Polizeibehörde in Wien über freimaurerische Angelegenheiten bzw. Umtriebe.147 Das Mistrauen der Polizeibehörde über die Freimaurerei muss in diesem Jahr besonders ausgeprägt gewesen sein. In den diversen Schreiben finden sich auch Auszüge aus den Logen-Verzeichnissen dieser Zeit. Im Gesetz über das Vereinsrecht vom 15. November 1867 gab es nach wie vor keine Möglichkeit für die Freimaurer, ihre rituellen Arbeiten offiziell auszuüben.
Obwohl in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sich die Auseinandersetzungen zwischen der katholischen Kirche und dem Staat steigerten, sodass Rudolf Virchow im Deutschen Reich den Begriff „Kulturkampf “ einführte, fühlte sich die Freimaurerei vom Kulturkampf nur gering betroffen. Sie begrüßte aber größtenteils die Trennung von Staat und Kirche und die Zurückdrängung des Religiösen in der Gesellschaft. Die innerkirchliche Strömung des Modernismus, wie sie in der Enzyklika „Pascendi“ beschrieben wurde, hat Papst Pius X. die Freimaurerei mit dem katholischen Glauben als unvereinbar bezeichnet. Die verschiedenen Strömungen, die als „neuer Katholizismus“ und später als „Modernismus“ benannt wurden, sah die Kirche als Auswirkungen des Liberalismus. Papst Pius IX. hatte 1864 mit dem „Erlass des Syllabus“, ein Verzeichnis der „hauptsächlichsten Irrtümer unserer Zeit“, nämlich Pantheismus, Naturalismus, Rationalismus, Indifferentismus und Liberalismus massiv kritisiert. Er bezeichnete die Freimaurerei als „Synagoge des Satans“. Das Verhältnis zwischen Kirche und Freimaurerei spitzte sich dann im Kulturkampf noch weiter zu. Diese Verurteilungen beeinflussten auch die Freimaurerei in Österreich. Der Nachfolger Papst Pius’ IX., Leo XIII., verdammte in seiner Enzyklika „Humanum genus“ die Freimaurerei als Teufelswerk und beschwor alle katholischen Bischöfe, „die unreine Seuche“ auszurotten.148 Die Gegnerschaft zur Freimaurerei erfuhr vor allem Aufwind durch den Kulturkampf, wobei sich in der Habsburgermonarchie eine modifizierte Form der Verschwörungstheorie herausbildete. Diese manifestierte sich z.B. in der polemischen Auseinandersetzung zwischen H.J. Bidermann und dem Jesuiten Johann Wieser.149 Im Kulturkampf hat sich die Verschwörungstheorie als Manipulations- und Repressionsobjekt bewiesen, da aus der Perspektive der katholischen Kirche der Liberalismus und die Freimaurerei den Bruch mit der überkommenen Sozialordnung ideologisch gerechtfertigt hätten und damit der Prozess der Aushöhlung der alten Ordnung als Verschwörung gegen Thron und Altar vor sich gegangen sei.150
______________
95 Vgl. dazu H. Reinalter, Freimaurerei, Politik und Gesellschaft. Die Wirkungsgeschichte des diskreten Bundes, Wien – Köln – Weimar 2018, S. 128 ff.
96 Vgl. dazu H. Reinalter, Freimaurerei, Politik und Gesellschaft, S. 193.
97 Vgl. zu diesem Geheimbund H. Reinalter, Der Geheimbund der Carbonari, in: Tirol – Österreich – Italien, Festschrift für J. Riedmann zum 65. Geb., Innsbruck 2005, S. 571 ff.; ders., Geheimbünde in Tirol. Von der Aufklärung bis zur Revolution 1848/49, Innsbruck 2011, S. 181 ff.
98 Zit. nach H. Reinalter, Die Freimaurer in Österreich von der Aufklärung bis zur Revolution 1848/49, in: Zirkelund Winkelmaß. 200 Jahre Große Landesloge der Freimaurer, Wien 1984, S. 7 ff., hier S. 20 ff.
99 Zum Geheimbund der Carbonari und seiner Zielsetzung vgl. H. Reinalter, Die Freimaurer, München, 7. Aufl. 2016, S. 88 ff.
100 Kärntner Landesarchiv Klagenfurt, Topographische Sammlung Zenegg, Fasz. 7/1, Carbonari, Freimaurer, geheime Gesellschaften, vol. 1–2.
101 Vgl. H. Reinalter, Geheimbünde in Tirol, S. 184 f.
102 Allgemeines Verwaltungsarchiv Wien (AVA), PH2632/1821.
103 Ebd.
104 Ebd.; zit. auch bei H. Reinalter, Geheimbünde in Tirol, S. 185 f.
105 Vgl. dazu S. Steiger-Moser, Anton David Steiger, Edler von Amstein. Der Gründer der Wildensteiner Ritterschaft zur Blauen Erde, in: Quatuor Coronati-Berichte H. 32 (2012), S. 217 ff.
106 Vgl. H. Reinalter, Johannisfreimaurerei, in: Freimaurerei. Geheimnisse – Rituale – Symbole. Ein Handbuch, Leipzig 2017, S. 123 f.
107 S. Steiger-Moser, Anton David Steiger, Edler von Amstein, S. 217 ff.
108 Vgl. dazu H. Reinalter, Geheimbünde in Tirol, S. 184 f.
109 Vgl. auch für das Folgende H. Reinalter (Hg.), Demokratische und soziale Protestbewegungen in Mitteleuropa 1815–1848/49, Frankfurt / M. 1986, S. 77 ff.
110 Zentrales Staatsarchiv Merseburg, Historische Abteilung II, Außenministerium 2.4.1.T. Nr. 8150, Nr. 8151 (heute Geheimes Staatsarchiv, Berlin-Dahlem, Preußischer Kulturbesitz); vgl. dazu auch H. Reinalter, Revolution und Verschwörungstheorie in Briefen und Berichten Metternichs, in: Innsbrucker Historische Studien 9 (1986), S. 115 ff.
111 H. Ritter von Srbik, Metternich. Der Staatsmann und der Mensch 1, München 1925, S. 388.
112 Vgl. dazu H. Reinalter, Revolution und Verschwörungstheorie, S. 115.
113 Vgl. ebd., S. 116.
114 Brief Metternichs an Wittgenstein, Wien, 21. Mai 1833, abgedruckt bei H.J. Schoeps (Hg.), Neue Quellen zur Geschichte Preußens im 19. Jahrhundert, Berlin 1968, S. 174 f.
115 Ebd., S. 175.
116 Zentrales Staatsarchiv Merseburg, Außenministerium, 2. 4. 1. I. Nr. 8150, vol. 5–6 (Abschrift); zitiert auch bei H. Reinalter, Revolution und Verschwörungstheorie in Briefen und Berichten Metternichs, S. 117.
117 H. Reinalter, Revolution und Verschwörungstheorie in Briefen und Berichten Metternichs, S. 119 f.
118 Ebd., S. 120.
119 Vgl. dazu M. Rietra (Hg.), Jung Österreich. Dokumente und Materialien zur liberalen österreichischen Opposition 1835–1848, Amsterdam 1980.
120 Zit. nach L. Brügel (F. Burger?), Aus den Tagen des „guten Kaisers Franz“. Die bespitzelte Freimaurerei, in: Wiener Freimaurer-Zeitung 11 (1926), S. 25 ff., S. 27.
121 Zit. nach L. Brügel, Aus den Tagen des „guten Kaisers Franz“, S. 35 ff.
122 Ebd., S. 36.
123 Ebd., S. 30 ff., S. 31; weiters auch Allgemeines Verwaltungsarchiv Wien (AVA), Polizeihofstelle 3676/1821, über den 8. Grad der Freimaurerei, Sedlnitzky an den Kaiser 1. Mai 1821.
124 Zum Verein vgl. W. Brauneder, Leseverein und Rechtskultur, Wien 1992; H. Reinalter, Der juridisch-politische Leseverein, in: Österreichisches Vereins- und Parteienlexikon, hg. von A. Pelinka und H. Reinalter, Innsbruck 2002, S. 82 ff.
125 H. Reinalter, Geheimbünde in Tirol, S. 185 f.; ders., Liberalismus und Kirche in Österreich im 19. Jahrhundert, in: Der deutsche und österreichische Liberalismus, hg. von H. Reinalter und H. Klueting, Innsbrucker Historische Studien 26. Bd., Innsbruck 2010, S. 149 ff.
126 Vgl. dazu H. Reinalter, Die bürgerliche und demokratische Opposition in der Habsburgermonarchie nach 1815, in: Demokratische und soziale Protestbewegungen in Mitteleuropa, S. 102 ff.
127 H. Reinalter, Die Geschichte der frühen Demokratie in Europa, Innsbruck 2018, S. 63 ff. auch S. 68 ff.; ders., Die bürgerliche und demokratische Opposition in der Habsburgermonarchie, S. 103 f.
128 Vgl. dazu H. Reinalter, Freimaurerei und Demokratie im 18. Jahrhundert, in: ders., Aufklärung und Moderne, Innsbruck 2008, S. 265 ff.; ders., Freimaurerei, Politik und Gesellschaft, S. 147 ff.
129 Vgl. dazu S. Lasz, Ein greiser Gelehrter. Erinnerung an Dr. Ludwig Lewis, Budapest 1887.
130 Vgl. dazu H. Reinalter, Die Freimaurerei in Österreich im 19. und 20. Jahrhundert, in: Freimaurer und Geheimbünde im 19. und 20. Jahrhundert in Mitteleuropa, hg. von H. Reinalter, Innsbruck 2016, S. 130 f.
131 S. Lasz, Ein greiser Gelehrter, S. 27 f.
132 Ebd., S. 30.
133 Vgl. dazu E. Schönmann, 1848, in: Quatuor Coronati-Berichte Heft 1 (1974), S. 17 ff.
134 L. Brügel, Aus der Frühzeit der österreichischen Freimaurerei. 1848 bis 1869, in: Die Gegenwartsmaurerei, S. 64 ff., hier S. 66.
135 Ebd., S. 66.
136 Ebd.
137 L. Lewis, Geschichte der Freimaurerei in Oesterreich im allgemeinen und der Wiener Loge zu St. Joseph insbesondere, Wien 1861; vgl. auch L. Brügel, Aus der Frühzeit der österreichischen Freimaurerei, S. 66.
138 L. Brügel, Aus der Frühzeit der österreichischen Freimaurerei, S. 66 f.
139 Vgl. dazu L. Lewis, Geschichte der Freimaurerei in Oesterreich im Allgemeinen und der Wiener Großloge zu St. Joseph insbesondere; E. Schönmann, 1848, in: Quatuor Coronati Berichte 1 (1974), S. 17 ff.; R. Hubert- F. Zörrer, Die österreichischen Grenzlogen. Freimaurerei in Österreich 1869–1918, in: Quatuor Coronati-Jahrbuch 20 (1983), S. 145; H. Obrecht, Der Kampf um die staatliche Anerkennung der Freimaurerei, S. 32 ff., S. 50 ff.; H. Reinalter, Die Freimaurerei in Österreich, in: Zirkel und Winkelmaß. 200 Jahre Großloge von Österreich, Wien 1984, S. 22.
140 Vgl. dazu P. Leisching, Freimaurertum und Katholizismus, in: Die Habsburgermonarchie 1848–1918, Bd. 4, Die Konfessionen, Wien 1985, S. 152 ff.
141 H. Reinalter, Liberalismus und Kirche im 19. Jahrhundert, in: Der deutsche und österreichische Liberalismus, Innsbrucker Historische Studien 26. Bd., Innsbruck 2010, S. 149 ff.
142 E. Lennhoff/O. Posner/ D.A. Binder, Internationales Freimaurer Lexikon, S. 496 f. ; H. Reinalter, Freimaurerei, Politik und Gesellschaft, S. 158 ff.
143 E. Weinzierl-Fischer, Die österreichischen Konkordate von 1855 und 1933, Wien 1960, S. 79 ff.; K. Vocelka, Verfassung oder Konkordat? Der publizistische und politische Kampf der österreichischen Liberalen um die Religionsgesetze des Jahres 1868, Wien 1978.
144 E.E. Eckert, Der Freimaurer-Orden in seiner wahren Bedeutung, Dresden 1852.
145 S. dazu H. Reinalter (Hg.), Handbuch der Verschwörungstheorien, Leipzig 2018, S. 97 f.
146 F. Bausenwein, Das Pestübel der modernen Gesellschaft oder der tote Illuminatenbund und der lebendige Freimaurerorden, Preßburg 1874.
147 Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Brevi-Manu Akten des Chefs der Obersten Polizeibehörde betreffend Freimaurer.
148 H. Reinalter, Die Freimaurer, München, 7. Auf., 2016, S. 207; M. H. Weninger, Loge und Altar. Über die Aussöhnung von katholischer Kirche und regulärer Freimaurerei, Wien 2020, S. 302f.
149 H. J. Bidermann, Zur Geschichte der Aufklärung in Tirol, Innsbruck 1828; J. Wieser, Tirol und die Aufklärung, Graz 1869; vgl. weiters auch J. Fontana, Der Kulturkamp in Tirol, Innsbruck 1972; H. Reinalter, Geheimbünde in Tirol, Bozen 1982, S. 121 f.
150 Vgl. dazu H. Reinalter, Die Freimaurerei in Österreich im 19. und 20. Jahrhundert, S. 133 f.