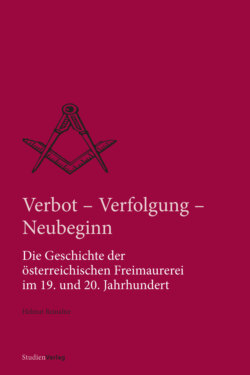Читать книгу Verbot, Verfolgung und Neubeginn - Helmut Reinalter - Страница 27
3. Weitere Logengründungen
ОглавлениеNach der Konstituierung der Loge „Zukunft“ folgten rasch weitere Logengründungen nach demselben Schema: 1874 die Loge „Socrates“ (Der Verein „Einigkeit“), 1875 die „Eintracht“ (Der Verein „Pestalozzi“), 1876 die Loge „Schiller“ (Verein „Bildung“, eine Bauhütte, die auch Hochgrade bearbeitete), 1877 die „Freundschaft“ (Verein „Freundschaft“) und die Loge „Columbus“ (Der Verein „Freundeskreis“).174
Vorübergehend existierte auch ein „Central-Actionscomitee für Freimaurerei in Österreich“, das eine wichtige Rolle als Koordinationsinstanz spielte. Nach der Gründung der Loge „Columbus“ kam es zunächst zu keinen weiteren Logengründungen. Die Bauhütten dieser Zeit, waren bemüht, ihr Selbstverständnis durch bewusste Auseinandersetzung mit Fragen der Gegenwart zu überdenken und neu zu formen. Dabei war auch die caritative Tätigkeit der Freimaurerei beachtlich: „Die äußere Mission besteht in der Unterstützung aller gemeinnützigen nationalen Einrichtungen und bildender Anstalten, wie der Förderung aller internationalen Werke, welche die friedliche Concurrenz der Nationen fördern, zwischenvolklichen Verkehr erleichtern oder Dissonanzen friedlich ebnen helfen“.175 So begann die Freimaurerei gleich nach der Gründung der ersten Grenzloge mit einigen sozialen Initiativen, wie die Stiftung des „Ersten österreichischen Findelkinder-Asyls“ 1872 durch die Loge „Humanitas“, das 1875 ein eigenes Haus im Kahlenberger Dorf erhielt. Die Loge „Socrates“ engagierte sich für die Einrichtung der „Feriencolonien“ für Stadtkinder. Gegründet wurde auch das Wöchnerinnenheim „Lucina“, ein Rekonvaleszentenheim für arme Frauen. Darüber hinaus wurden auch bei Katastrophen und Unglückfällen spontane Hilfestellungen geboten.176 Die letzte Grenzloge „Fortschritt“ wurde 1917 gegründet. Hier eine kurze Zusammenstellung der Grenzlogengründungen in chronologischer Reihenfolge: „Socrates“ 1874, „Schiller“ 1875, „Eintracht“ 1875, „Freundschaft“ 1877, „Humanitas“ 1882, „Zukunft“ 1884, „Treue“ 1888, „Goethe“ 1892, „Lessing“ 1897, „Pionier“ 1899, „Kosmos“ 1907, „Zur Wahrheit“ 1913, „Gleichheit“ 1914, „Fortschritt“ 1917.177
Bis kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges wuchs die Zahl der Grenzlogen auf 14 an. Die Loge „Gleichheit“ spaltete sich von der Bauhütte „Eintracht“ ab. Hier muss es innerhalb der Loge „Eintracht“ zu Spannungen gekommen sein, die wohl mit der Ausrichtung der damaligen Freimaurerei zusammenhingen.178 In dieser Zeit nahmen auch die Auseinandersetzungen zwischen den Traditionalisten und den aufklärerischen Aktivisten mit der Betonung der freimaurerischen Außenarbeit zu. Die Brüder, die den Aktivismus förderten, beeinflussten um die Jahrhundertwende die geistige Mobilität in der Bruderkette. So wurde nicht nur das Ritual kritisch hinterfragt, sondern auch angeblich der „kindliche Symbolismus“ kritisiert. Die Brüder waren bemüht, durch geistige Aktivitäten die Logen zu modernisieren, obwohl auch die Traditionalisten unter den Brüdern nicht gering waren. Die aktivistische Richtung war besonders stark ausgeprägt in den Logen „Pionier“ und „Socrates“. In den Grenzlogen wurden daher auch wichtige Baustücke gehalten, die sich mit philosophischen, medizinischen, ökonomischen und literarischen Themen beschäftigten. Besonders intensiv befassten sich die Brüder mit Themen wie z.B. „Freimaurerei und Sozialismus“, „Bürgerlicher Liberalismus“, „Die Frauenfrage“, „Industriepolitik“ und „Ethik“.179
War die erste Phase der Grenzlogen eine Zeit der Konsolidierung und Standortbestimmung, so entwickelte sich die Freimaurerei in den 1890er Jahren zu einer geistigen Kraft, die sich in der kritischen Reflexion der gesellschaftlichen Probleme und im verstärkten Einsatz in Bildungs- und Erziehungsfragen manifestierte. In dieser Aufbruchsstimmung entstanden neue Grenzlogen bis 1888 und dann 1898 insgesamt vier Bauhütten, nämlich „Treue“, „Goethe“, „Lessing“ und „Pionier“, von denen besonders die beiden letztgenannten gemeinsam mit der Loge „Socrates“ zu den Vorreitern eines starken freimaurerischen Aktivismus zählten.180 Die Loge „Lessing“ wurde am 23. Jänner 1898 gegründet. Die rituellen Arbeiten fanden aber nur selten in Preßburg, dafür aber häufiger in Wien statt. Emil Roth hatte verschiedene Eingaben der Freimaurerei zur gesetzlichen Anerkennung in Österreich gemacht, die allerdings erfolglos blieben. Die „Glanzzeit“ dieser Loge begann nach dem Ersten Weltkrieg, als Persönlichkeiten wie Ferdinand Hanusch und Julius Tandler Mitglieder dieser Loge wurden. Auch die karitative Arbeit wurde in dieser Loge mit großem Eifer vorgenom men und nahm durch die größeren Mittel bedeutendere Dimension an. Diese wurde durch eine intensivere Beschäftigung mit aktuellen Zeitfragen ergänzt, wobei besonders Themen wie Sozialreformen, Schulreformen und Erziehungsprobleme im Vordergrund standen. Die soziale Frage, die Armut großer Bevölkerungsteile, rückte immer stärker in das Zentrum masonischer Diskussionen. Dieser sozialreformerische Aktivismus fand seinen Niederschlag im Programm der 1898 gegründeten Loge „Pionier“: „Man müsst in thatkräftiger Arbeit, Licht und Aufklärung in den breiten Maßen des Volkes verbreiten, Socialreformen anregen und … propagieren.“181 In den erhaltenen Statuten der Bruderlade und der Sterbecasse heißt es u.a.:
„Die Brr.: der g.: u.: v.: (Loge) ‚Pionier‘ gründen eine Bruderlade zum Zwecke der Gewährung von Unterstützungen an hilfsbedürftige Brr.: der (Loge) sowie deren Witwen und Waisen. Der Bruderladenfond wird gebildet:
1. Aus dem Betrage von 80 Kronen für jede Aufnahme, sowie aus den fünfundzwanzigpercentigen Einnahmen von Beförderungen und Erhebungen;
2. aus dem Beitrage von 50 Kronen für jede Affiliation;
3. aus dem periodischen Beitrage des S.: d.: W.: in der Höhe von 25% sämmtlicher Einnahmen desselben;
4. aus dem 20%igem Betrage von allen Monatsgeldern;
5. aus den aufgelaufenen Zinsen der Sterbecasse;
6. aus freiwilligen Spenden und eventuellen Vermächtnissen.“182
In der Loge „Socrates“ stieß der Sozialismus auf besonderes Interesse. Zu den umstrittensten Projekten der Bauhütte „Pionier“ zählte die Gründung der „Freie Schule“, eine Institution, die später zu einer Einrichtung der Sozialdemokratie geworden war. Die Loge ging dabei von dem Gedanken aus, dass in den bestehenden Schulen der großen Bedeutung der Wissenschaften kaum Rechnung getragen wurde und dadurch die Gefahr einer Halbbildung entstehe. Die „Freie Schule“ sollte daher eine Verbindung zwischen Volksschule und Volkshochschule herstellen.183 Durch ihre Kritik am bestehenden Schulsystem steigerte sich die Spannung zwischen katholischer Kirche und Freimaurerei, die schon seit Beginn der Grenzlogenzeit bestand.
Nicht wenige Brüder gehörten auch verschiedenen reformerischen Vereinen an und engagierten sich dort im Sinne freimaurerischer Anliegen. Insbesondere traten sie für Friedensbemühungen ein. 1911 erhielt der Freimaurer und Publizist Alfred Hermann Fried sogar den Friedensnobelpreis.184 Fried (1864–1921) hatte die Grundlage der modernen, grenzüberscheitenden Friedensbewegung geschaffen. Seine Ziele teilte er mit Bertha von Suttner in konsequenter Weise.185 Er stammte aus einer jüdischen Familie und besuchte die Schule bis zu seinem 15. Lebensjahr. Nach einer Buchhändlerausbildung arbeitete er in diesem Bereich ab 1883 in Berlin. Später trat er mit Publikationen an die Öffentlichkeit und wurde 1881 zum bekennenden Pazifisten. Zehn Jahre später engagierte er sich intensiv für die Friedenspropaganda, und ab 1882 war er gemeinsam mit Bertha von Suttner Herausgeber der pazifistischen Zeitschrift „Die Waffen nieder!“. In ihr und in der ab 1899 erscheinenden Zeitschrift „Die Friedenswarte“ entwickelte er seine pazifistischen Ideen. 1882 hatte er bereits die Deutsche Friedengesellschaft mitbegründet, und 1894 besuchte er regelmäßig die internationalen Friedenkongresse und interparlamentarischen Konferenzen in Brüssel, Budapest, Kristiania und Wien. Über diese bereitete er Berichte für die deutschsprachige Presse vor und trug auch zu deren Verbreitung bei. Von 1896 bis 1900 redigierte er die „Monatliche Friedenskorrespondenz“, die sich als Zeitschrift der Deutschen Friedensgesellschaft verstand und übernahm 1899 die Redaktion der Zeitschrift „Die Waffen nieder!“. Noch im selben Jahr gründete er das Komitee zur Kundgebung für die Friedenskonferenz in Berlin, und 1902 nahm er an der Eröffnung des Kriegs- und Friedensmuseums in Luzern teil. Ab 1903 war er auch Mitglied des Internationalen Friedensinstituts und gehörte seit 1908 der Grenzloge „Socrates“ in Pozsony als Mitglied an.186
Diese Beispiele verdeutlichen, dass die österreichische Bruderkette schon vor dem Ersten Weltkrieg pazifistisch, sozialreformerisch und internationalistisch tätig war.187 Großen Wert legte die Freimaurerei in dieser Zeit nicht nur auf die individuelle Arbeit des Bruders an der Persönlichkeitsformung, auf die Symbolik und Ritualistik, sondern auch auf die Außenarbeit, auf die Verbreitung freimaurerischen Ideenguts in Wort und Schrift, auf die Förderung kultureller Aktivitäten, auf die humanitäre Arbeit der Logen mit Unterstützung entsprechender Institutionen und auf die Logenmitarbeit in profanen Vereinen.
Vom 26.-30. September 1896 fand in Trient – wie bereits angedeutet – ein internationaler antifreimaurerischer Kongress statt, der den Anlass dazu bildete, dass sich mehrere Persönlichkeiten trafen, um in einem geschlossenen Kreis 1896 Vorträge über die Geschichte und Wirksamkeit der Freimaurerei in der Monarchie zu untersuchen. Zu diesen Persönlichkeiten zählten: Karl Graf Chorinsky, Nikolaus Moriz Graf Esterházy, Dr. Victor v. Fuchs, Dr. Simon Hagenauer, Josef Alex. Freiherr von Helfert, Emerich Graf Hunyady, Karl Koller, Dr. Josef Porzer, Friedrich Graf Schönborn, Johann Erbprinz von und zu Schwarzenberg, Ernst Graf Sylva-Tarouca, Koloman Graf Széchényi, P. Paulus M. Toggenburg, P. Franz X. Widmann S. J., Wilhelm Graf Wolkenstein und Ferdinand Graf Zichy.188 Die einzelnen Vorträge befassten sich mit folgenden Themen: Freimaurerische Prinzipien und Logen-Systeme (Johann Michael Raich), Österreichs Freimaurerei bis zum Tode Maria Theresias (Josef Alexander Freiherr von Helfert), Die Freimaurerei unter Josef II. (Victor von Fuchs), Freimaurerische Berühmtheiten (P. Anton Forstner S. J.), Freimaurerei und Französische Revolution (Wilhelm Freiherr von Berger), Die Jakobiner in Ungarn (Nikolaus Moriz Esterházy-Csákvár), Von Kaisers Franz Verbot der Logen bis 1848 (Ferdinand Buquoy), Freimaurerische Aktionen von 1849–1866 (Ernst Sylva-Tarouca), Die ungarische Freimaurerei seit 1867 (Karl Koller), Die Freimaurerei in den Reichsratsländern (Friedrich Schönborn), Das Gesamtbild (Ferdinand Zichy). Die Schlussworte sprach Kardinal Fürsterzbischof Anton Gruscha. Noch im Verlauf dieser Vortragsreihe wurde vorgeschlagen, die Vorträge zu veröffentlichen, was auch durch den Herder-Verlag geschah. Im Schlusswort betonte Gruscha: „Unter dem überwältigenden Eindrucke eines mächtigen Appells, der soeben an uns alle gerichtet ward, schliessen die Vorträge. Es ist ein Appell, der nicht nur in dieser Stunde gehört werden wollte, sondern der eine thatkräftige Fortsetzung der nunmehr eingeleiteten Action verlangt gegenüber dem gemeinsamen Gegner – der Freimaurerei. Vom Beginn der Veranstaltung dieser Action hat der Episcopat seine freudige Anerkennung jenen Männern ausgesprochen, die diesen Entschluss gefasst und denselben mit Muth und Ausdauer auf streng historischer Grundlage erfolgreich ausgeführt haben. Mit vollem Vertrauen kommt auch der Episcopat der Zukunft dieser Action entgegen; er hofft mit Recht, dass auch alle ferneren Schritte unter Gottes Beistand von gleichem Erfolge begleitet sein werden.“189
Gruscha antwortete auf die Frage, ob ein gläubiger Christ Freimaurer sein könnte, mit einem eindeutigen Nein. Die ganze Publikation diente der Antifreimaurerei. Gruscha vertrat die Auffassung, dass die katholische Kirche die einzige wirksame Gegenmacht zu dem weitausgebreiteten Geheimbund der Freimaurer sei. Die Kirche müsse sich für den Kampf gegen die Freimaurerei rüsten, ein Kampf, der den Sieg für den Glauben bringen sollte: „Wir sind … berufen als Bauleute, zu bauen an den Mauern der Stadt Gottes im christlichen Familien- und Staatenleben auf Erden. Mit der einen Hand wollen wir die Arbeit thun, wollen wir bauen, mit der anderen Hand das Schwert halten, wehren dem Feinde, immer aber eingedenk der göttlichen Mahnung: ‚Wenn der Herr das Haus nicht baut, so arbeiten die Bauleute vergebens.‘„190 Aus den Vorträgen und dem Schlusswort des Vortragsbandes spürte man deutlich die große Ablehnung der humanitären Freimaurerei. Sie war noch eine Nachwirkung des Kulturkampfes.
______________
151 Vgl. R. Hubert, Freimaurerei in Österreich 1871–1918, in: Zirkel und Winkelmaß. 200. Jahre Große Landesloge der Freimaurer, S. 32; F. Zörrer/R. Hubert, Die „Grenzlogenzeit“ 1871–1918, in: 250 Jahre Freimaurerei in Österreich, Ausstellungskatalog Zwettl 1992, S. 37 ff.; L. Lewis, Geschichte der Freimaurerei in Österreich; H. Obrecht, Der Kampf um die staatliche Anerkennung der Freimaurerei in Österreich, S. 106 ff.
152 Vgl. die betreffenden Baustücke im Großlogenarchiv in Wien.
153 Vgl. dazu die Akten im AVA, Z. 1846/21.Juli 1868 und Z. 1330/23. April 1869; H. Obrecht, Der Kampf um die staatliche Anerkennung der Freimaurerei in Österreich, S. 106 ff.; vgl. auch H. Reinalter, Die Freimaurerei in Österreich im 19. und 20. Jahrhundert, in: Freimaurerei und Geheimbünde im 19. und 20. Jahrhundert in Mitteleuropa, S. 132; Niederösterreichisches Landesarchiv St. Pölten, Präsidialakten 1868–1871.
154 Niederösterreichisches Landesarchiv, Niederösterreichische Statthalterei – Präsidium, Zl. 593 1872.
155 AVA, Z./2306; vgl. auch H. Obrecht, Der Kampf um die staatliche Anerkennung der Freimaurerei in Österreich, S. 107; L. Brügel, Aus der Frühzeit der österreichischen Freimaurerei, S. 68 ff.
156 L. Brügel, Aus der Frühzeit der österreichischen Freimaurerei, S. 68.
157 H. Obrecht, Der Kampf um die staatliche Anerkennung der Freimaurerei in Österreich, S. 108.
158 Zit. nach H. Obrecht, Der Kampf um die staatliche Anerkennung der Freimaurerei in Österreich, S. 108.
159 Vgl. dazu: Verbotene Freimaurerei 1848–1918, Österreichisches Freimaurermuseum, Schloss Rosenau, Zwettl, Katalog zur Sonderausstellung 1978–1979, Wien 1978, S. 6 f.
160 Vgl. dazu Loge Humanitas – Chronik des Überlebens, in: Quatuor Coronati-Berichte 17 (1997).
161 Vgl. dazu L. Brügel, Aus der Frühzeit der österreichischen Freimaurerei, S. 70 ff.
162 Die wichtigsten Akten über die Grenzlogen befinden sich im Ungarischen Staatsarchiv (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára) in Budapest; über die Humanitas 1871–1886 vgl. Ungarisches Staatsarchiv, P. 1081, 4. XII; G. Kuéss – B. Scheichelbauer, Die Geschichte der Loge Humanitas im Orient Wien, Wien 1951, S. 11; Die Geschichte der Ger.: u.: Vollk.: Loge „Humanitas“ im Or.: Wien. Aus Anlass ihres 80jährigen Bestandes im Jahre 1951, Wien o.J.; Attila Pók hat mir ein Manuskript über „die verbotene Österreichische Freimaurerei unter der Herrschaft von Franz Joseph“ zur Verfügung gestellt; s. weiters A. Pók, Der „unpolitische Verein Humanitas“. Eine Fallstudie des Wirkens der Zivilgesellschaft in der dualistischen Habsburgermonarchie, in: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. Születésnapjára Szerkesziette Kovács Zoltán és Püski Levente, Debrecen 2010, S. 263 ff.; H. Obrecht, Der Kampf um die staatliche Anerkennung der Freimaurerei in Österreich, S. 108 ff.
163 Der Zirkel 1871–1918, von 1918–1938 als Wiener Freimaurer-Zeitung erschienen; vgl. auch H. Reinalter, Die Freimaurerei in Österreich im 19. und 20. Jahrhundert, S. 130. – Wichtige Unterlagen zur Grenzlogenzeit befinden sich auch im Archiv der Großloge von Österreich und zu den erwähnten Zeitschriften in der Bibliothek der Großloge. Für Hinweise danke ich besonders Manfred Pittioni.
164 Vgl. dazu die Hefte des Zirkels in der Bibliothek der Großloge von Wien und M. G. Patka, Patriotismus oder Pazifismus? Die Wiener Freimaurer-Zeitschrift „Der Zirkel“ im Ersten Weltkrieg, in: Quatuor Coronati-Berichte 39 (2019), S. 75 ff.
165 Statuten des nicht-politischen Vereines „Humanitas“, Grenzlogen, Archiv der Großloge Wien, dort befindet sich auch ein Mitglieder-Verzeichnis 1869/1870.
166 Vgl. dazu die Gedenkschrift zum 75. Stiftungsfest der Loge „Zukunft“, verfasst von Br.: Artur Zerzawy (MS).
167 Ebd., 8 ff.
168 Diese Hinweise verdanke ich Attila Pók.
169 Aus den Statuten der Symbolischen Großloge von Ungarn, Archiv der Großloge von Österreich.
170 Vgl. R. Hubert, Freimaurerei in Österreich 1871–1938, S. 34; zu den Bauhütten der Grenzlogenzeit s. G. K. Kodek, Zwischen verboten und erlaubt. Chronik der Freimaurerei in der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867–1918 und der I. Republik 1918 -1938, Wien 2009.
171 Allgemeine österreichische Freimaurer-Zeitung 15. 11. 1874, 19.03., 19.06. 1875; vgl. auch H. Reinalter, Die Freimaurerei in Österreich im 19. und 20. Jahrhundert, S. 133.
172 Vgl. das Zitat bei F. Graf Zichy, Das Gesamtbild, in: Die Freimaurerei Österreich-Ungarns, Wien 1897, S. 382; H. Reinalter, Die Freimaurerei im 19. und 20. Jahrhundert, S. 133; ders., Liberalismus und Kirche, S. 156 ff.
173 Ungarisches Staatsarchiv, P. 1081, 7. XXIII.; Vgl. R. Hubert, Freimaurerei in Österreich, S. 35; vgl. auch das MS. von N. Knittler, Die Geschichte der Loge „Zukunft“ aus dem Blickwinkel des Jahres 1938, S. 12 ff., im Archiv der Großloge von Österreich.
174 Ungarisches Staatsarchiv, P. 1081, 7. XXIII., XXIV.; R. Hubert, Freimaurerei in Österreich, S. 35 f.; vgl. dazu den Katalog zur Sonderausstellung „Verbotene Freimaurerei 1848–1918“ im Österreichischen Freimaurermuseum Schloss Rosenau bei Zwettl, Wien 1978; eine Tafel im Archiv der Großloge verzeichnet alle Grenzlogen mit dem Gründungsdatum.
175 Vom Blau-weiß-Goldenen Banner, Wien 1877, S. 85; zit. auch bei H. Reinalter, Die Freimaurerei in Österreich im 19. und 20. Jahrhundert, S. 135.
176 Humanitas 1882, S. 175 ff.; G. Kuéss – B. Scheichelbauer, Die Geschichte der Loge Humanitas im Orient Wien, S. 161 ff.
177 Ungarisches Staatsarchiv, P. 1081; ich danke Attila Pók für seine Mithilfe im Ungarischen Staatsarchiv; vgl. auch das Baustück von Günther K. Kodek, Die Gründungen von Logen und freimaurerischen Kränzchen in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie und der 1. Republik (1886–1938) im GL-Archiv Wien; G. Hellwagner, 120 Jahre Loge „Lessing zu den drei Ringen“. Das Wirken ihrer Brüder und ihr Vermächtnis, in: Quatuor Coronati-Berichte 38 (2018), S. 60 ff.; A. Nader, Die Grenzloge „Lessing zu den drei Ringen“, in: ebd., S. 83 ff.; G. Friedrich, 1869–1874 – Der turbulente Wiederbeginn der Freimaurer in der Loge „Humanitas“, in: Quatuor Coronati-Berichte 39 (2019), S. 169 ff.; G. Friedrich / R. Nagiller, Wendepunkt 1874/75. Mit Bruderzwist in die Zukunft, in: ebd., S. 213 ff.; zur Loge „Kosmos“ vgl. 40 Jahre Loge Kosmos im Orient Wien, hg. von der humanitären Vereinigung Kosmos, Wien 2013.
178 Vgl. dazu das Protokoll zur Geschichte der Loge „Gleichheit“, Grenzlogen, Archiv der Großloge von Wien, MS.
179 Vgl. dazu die entsprechenden Baustücke von Brüdern im Großlogenarchiv in Wien.
180 Vgl. dazu R. Hubert, Freimaurerei in Österreich, S. 38 f.
181 Der Zirkel I (1900); zit. auch bei H. Reinalter, Die Freimaurerei in Österreich im 19. und 20. Jahrhundert, S. 135.
182 Statuten der Bruderlade und einer Sterbecasse, Grenzloge „Pionier“, Archiv der Großloge in Wien, S. 36 ff.
183 Ebd.
184 Zu Fried vgl. W. Göhring, Verdrängt und vergessen. Friedensnobelpreisträger Alfred Hermann Fried, Wien 2006; R. Hubert, Ein exemplarisches Freimaurerleben. Versuch über Br.: Alfred Hermann Fried, in: Quatuor Coronati-Berichte 6 (1977), S. 31 ff.
185 Vgl. dazu B. Hamann, Bertha von Suttner. Ein Leben für den Frieden, München 1991.
186 Vgl. W. Göhring, Verdrängt und vergessen; H. Reinalter, Fried, Alfred Hermann (1864–1921), in: Freimaurerische Persönlichkeiten in Europa, hg. von H. Reinalter, Innsbruck 2014, S. 48 f.; E. Lennhoff / O. Poser / D. A. Binder, Internationales Freimaurer-Lexikon, München 2006, S. 316; B. Tuider, Alfred Hermann Fried, Pazifist im Ersten Weltkrieg. Illusion und Vision, Saarbrücken 2010; H. Wehberg, Art. Fried, Alfred Hermann, in: Neue Deutsche Biographie Bd. 5, Berlin 1961, S. 411 f.
187 Vgl. dazu auch M. G. Patka, Freimaurerei und Sozialreform. Der Kampf für Menschenrechte, Pazifismus und Zivilgesellschaft in Österreich 1869–1938, Wien 2011.
188 Die Freimaurerei Österreich-Ungarns. Zwölf Vorträge am 30. und 31. März und 01. April 1897 zu Wien gehalten, Wien 1897.
189 Ebd., S. 383.
190 Ebd., S. 387.