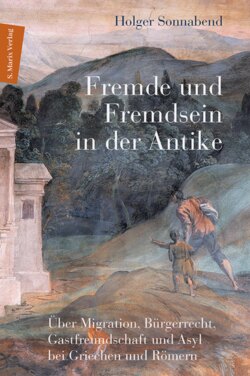Читать книгу Fremde und Fremdsein in der Antike - Holger Sonnabend - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Eine antike Klima- und Umwelttheorie
Оглавление»Dass Griechen über Barbaren herrschen, ist recht und billig, nicht aber Barbaren über Griechen. Die einen nämlich sind Sklaven, die anderen Freie.«
So sprach im 4. Jahrhundert v. Chr. der berühmte griechische Universalgelehrte Aristoteles (Politik 1252 b8). Er formulierte damit kurz und knapp die Konsequenz aus einer Lehre, die nachweisen sollte, dass die Menschen nicht alle gleich seien. Um 430 v. Chr. erschien unter dem Namen des berühmten Arztes Hippokrates – aber sicher nicht aus seiner eigenen Feder – eine Schrift über den Einfluss von Klima und Umwelt auf die Konstitution und die Mentalität der Menschen. Der Autor leitete die von ihm postulierte Verschiedenheit der Völker von dem Klima und den relevanten Umweltfaktoren in den jeweiligen Regionen der Welt ab. Das Klima in Europa schwanke zwischen Hitze und Kälte. Daraus resultiere ein robuster Körper, geistige Beweglichkeit, Tapferkeit und Freiheitsliebe. Das Klima in Asien sei von einer großen Gleichförmigkeit gekennzeichnet. Weil es keine Schwankungen zeige, seien die Menschen schlaff, träge, ängstlich und daher auch bereit, sich Despoten zu unterwerfen. Diese Theorie war politisch höchst willkommen. Nun hatte man den »wissenschaftlichen« Beweis, dass Europäer den Asiaten überlegen waren. Freie Europäer befehlen, geknechtete Asiaten gehorchen.
Aristoteles entwickelte diese Lehre weiter (1327 b21 ff.), indem er eine Grenzlinie durch Europa zog. Menschen im Norden Europas seien mutig, aber hätten keinen Sinn für Geist und Kunst. Sie verfügten nicht über das Talent, ihre Nachbarn zu beherrschen. Die Menschen in Asien seien intelligent und hätten künstlerische Begabung, aber sie seien furchtsam und lebten daher in ständiger Sklaverei.
Und was ist mit den Griechen? Sie leben genau in der Mitte zwischen den Nordeuropäern und Asiaten. Sie teilen alle Vorzüge und sind frei von allen Nachteilen. Mutig, intelligent, befähigt zu Staatlichkeit und zum Herrschen. Die Römer haben diese Lehre später übernommen – nur mit dem Unterschied, dass sie sich selbst als Maß aller Dinge sahen und die Griechen in die zweite Reihe versetzten.
Wer sich gegenüber den Persern freundlich zeigte, riskierte, in den Verdacht der Kollaboration und des Abfalls von griechischen Werten zu geraten. Die Griechen sprachen in diesem Fall von Medismos – der Hinwendung zu den Sitten der Meder, wie die Perser alternativ genannt wurden. In der Realität schätzten viele aristokratische Griechen den ausschweifenden, repräsentativen Lebensstil der persischen Oberschichten und versuchten, diesem nachzueifern. Dem Spartaner Pausanias wurde vorgeworfen, sich persisch zu kleiden und mit einer persischen Leibgarde zu umgeben. Er soll sogar dem persischen Großkönig angeboten haben, ihm die Herrschaft über die Griechen zu verschaffen, wenn er ihm seine Tochter zur Frau gebe.
Dieser Vorwurf war unberechtigt. Allem Anschein nach war Pausanias einigen seiner griechischen Gegner zu mächtig und einflussreich geworden, sodass sie eine Intrige starteten. Dass sie bei dem Versuch, ihn zu diskreditieren, gerade in die Schublade »Perserfreund« griffen, spricht aber Bände, was die Haltung zu den Persern während der Perserkriege und nach den Perserkriegen angeht. Der Begriff »Perser« war zu einem politischen Schimpfwort geworden.
Dass es in der Realität auch anders aussehen konnte, beweist eine wirklich schöne Episode, von der der griechische Historiker Xenophon berichtet (4,1,39). Sie handelt von dem spartanischen König Agesilaos und einem jungen persischen Adligen. Sie spielt gut hundert Jahre später, zu Beginn des 4. Jahrhunderts v. Chr., als Agesilaos militärische und diplomatische Aktionen in Kleinasien durchführte. Einmal traf er mit dem persischen Statthalter Pharnabazos zu einer Besprechung zusammen. Als das Gespräch beendet war, geschah etwas Unerwartetes:
»Pharnabazos bestieg sein Pferd und ritt davon. Aber sein Sohn, den er von der Parapita hatte, noch jugendlich und schön, blieb zurück und lief auf Agesilaos zu mit den Worten:
›Agesilaos, ich mache dich zu meinem Gastfreund.‹
›Und ich nehme es an.‹
›Denke also daran‹, sagte er.
Und darauf gab er seine Lanze – er hatte eine sehr schöne – dem Agesilaos. Der nahm sie an, zog den wunderschönen Schmuck ab, der an dem Pferd seines Schreibers Idaios angebracht war, und reichte ihm den als Gegengeschenk. Da sprang der junge Mann auf sein Pferd und jagte dem Vater hinterher.«
So harmonisch und freundschaftlich verliefen die Kontakte zwischen Griechen und Persern aber nur im Ausnahmefall. Gastfreundschaften dieser Art, durch ritualisiertes Handeln wie den Austausch von Geschenken begründet, schlossen die griechischen Eliten eher untereinander. Die meisten griechischen Spitzenpolitiker verfügten über ein breites Netzwerk persönlicher Kontakte zu Führungspersonen in anderen griechischen Stadtstaaten. Aber eine Freundschaft mit einem Perser war doch etwas anderes – zumal in Zeiten, in denen das politische Klima zwischen Griechenland und Persien sich dem Tiefpunkt näherte.
Auch Herodot konnte oder wollte sich der nach den Perserkriegen politisch geforderten Barbaren-Interpretation nicht entziehen. In der jüngeren Forschung hat man viel Energie in das Bestreben investiert, ihn zu einer weltoffenen Ikone und einem von Vorurteilen freien, global denkenden Kosmopoliten zu stilisieren. Richtig daran ist, dass er sich mehr als andere für fremde Völker, deren Sitten, Gebräuche, Lebensformen interessierte. Um sie kennenzulernen, unternahm er viele Reisen. So hat er in dieser Hinsicht auch einige Informationen über die Perser zusammengetragen und präsentiert sie seinem griechischen Publikum gerne und ausführlich (1,133–136).
Banales …
»Unter allen Tagen hält nach dem Brauch ein jeder den besonders in Ehren, an dem er geboren ist. An ihm muss ein reicheres Mahl als gewöhnlich aufgetragen werden. Da lassen die Reichen auftragen Rind und Pferd und Kamel und Esel, im Stück im Ofen gebraten, die Armen aber tragen kleines Vieh auf. Speisen aus Getreide sind wenig im Gebrauch, desto mehr Nachspeisen, die nacheinander vorgesetzt werden. Deshalb sagen die Perser auch, die Griechen müssten hungrig sein, wenn sie mit der Hauptspeise Schluss machten, weil ihnen ja nichts Ordentliches mehr vorgesetzt werde. Setzte man ihnen was vor, würden sie kaum Schluss machen mit dem Essen.«
… wechselt darin mit Erstaunlichem:
»Es ist ihre Gewohnheit, die ernstesten Angelegenheiten in betrunkenem Zustand zu beraten. Das Ergebnis, zu dem sie dabei gelangen, trägt der Herr des Hauses, in dem sie beraten, am folgenden Tag, wenn sie nüchtern sind, noch einmal vor. Befinden sie es auch nüchtern für gut, so handeln sie danach. Wenn sie aber eine Sache nüchtern beraten haben, so prüfen sie es im Rausch nach.«
Manches wird gönnerhaft für gut befunden (»Das ist ein Brauch, den ich lobe«), Kritik wird nicht geübt. Eigentlich ist Herodot von den Persern und ihrer Kultur fasziniert – doch unter den neuen Vorzeichen in der Zeit nach den Perserkriegen war dies nicht mehr erwünscht. Auch Herodot muss diesem neuen Denken Rechnung tragen. Wenn er in seinem Vorwort die Taten von Griechen und Barbaren erwähnt, so ist dieses und trennend und nicht verbindend. König Xerxes, der die militärischen Unternehmungen der Perser in Griechenland persönlich leitete, wird von ihm alles andere als freundlich beschrieben.
Acht Jahre nach der Schlacht von Salamis sorgte in Athen ein Theaterstück für Furore. Der Autor katapultierte sich damit in die erste Riege der griechischen Tragiker. Das Stück des Aischylos trug den Namen Die Perser – eine dramatische Auseinandersetzung mit der Seeschlacht von Salamis, in der die Griechen der persischen Flotte eine schwere Niederlage bereitet hatten.
Römische Marmorbüste des Aischylos, 30 v. Chr., nach einem griechischen Bronzeoriginal, 340–320 v. Chr., Archäologisches Nationalmuseum Neapel
Dem griechischen Publikum präsentierte Aischylos das Thema aus einer ungewöhnlichen Perspektive. Nicht etwa jubelnde Griechen, sondern trauernde Perser beherrschen die Szene. Schauplatz ist die persische Königsresidenz Susa. Hier informiert ein Bote über den Ausgang der Schlacht. Allgemeines Gejammer und Geklage ist die Folge. Dramaturgisch geschickt findet die Handlung vor dem Grab des verstorbenen Königs Dareios statt, der kurz aus dem Reich der Toten auftauchen darf und einen beeindruckenden Auftritt hat. Eine prominente Rolle spielt Atossa, die Mutter des unglücklichen Königs Xerxes, der am Schluss als in ein zerrissenes Gewand gehüllter, gedemütigter Kriegsheimkehrer auf der Bühne erscheint.
Aischylos wird heute sehr gelobt für seine Darstellung der Perser in den Persern. Nicht zuletzt deswegen gehört das Werk konstant zum Repertoire moderner Theater. Er degradiert, so wird gesagt, die Perser nicht zu reinen Statisten, zu Objekten eines Triumphs der Griechen. Er belässt ihnen ihre Würde. Die Perser klagen, aber sie klagen stilvoll. Und er widersteht der Versuchung, aus dem Sieg von Salamis eine grundsätzliche Überlegenheit der Griechen über die Barbaren abzuleiten. Die Griechen siegten bei Salamis nicht, weil sie besser waren, sondern weil die Götter auf ihrer Seite standen. Die Götter bestraften den ehrgeizig-skrupellosen König Xerxes, weil er Griechenland erobern wollte und weil er für viele Freveltaten verantwortlich war. Der Störfaktor Xerxes brachte das gottgewollte Gleichgewicht der Mächte in Unordnung.
Aber wurde Aischylos mit den Persern tatsächlich zu einem Anwärter auf einen (imaginären) Preis für Frieden, Freundschaft und Verständigung in der Antike? Aischylos dachte nicht an den Beifall des 21. Jahrhunderts. Er dachte an die Gunst der Gegenwart, und das bedeutete für einen griechischen Bühnenautor, beim Publikum Erfolg zu haben. Theateraufführungen wurden im antiken Griechenland als Wettbewerbe durchgeführt. Es wurden hintereinander meist drei Stücke gespielt, dann stimmte eine Jury (die sich gerne von den Reaktionen des Publikums beeinflussen ließ) über die Platzierung ab. Aischylos hatte mit den Persern Erfolg, er kam auf Platz eins. Er traf also den Geschmack des Publikums. Acht Jahre nach Salamis war die Erinnerung an dieses Großereignis, das patriotisch gefeiert worden war, noch sehr frisch. Sympathiewerbung für tapfere Perser wäre hier fehl am Platz gewesen. Die Menschen, die in einem Theater in Athen das Stück sahen, waren gewissermaßen live dabei, wie die Nachricht von der Niederlage bei den erfolgsverwöhnten, siegessicheren Persern im fernen Susa einschlug.
Das Jammern und Klagen am persischen Königshof rief beim Publikum nicht Bewunderung und Respekt hervor, sondern Stolz auf sich selbst – eine Wirkung, die Aischylos einkalkuliert hatte. Im Leiden der Perser feierten die Griechen ihren Erfolg – über die »Barbaren«, denn so lässt Aischylos die Perser in dem Stück sich selbst bezeichnen. Im Übrigen war Aischylos von seiner eigenen Biografie her kein unbedingter Freund der Perser. Bei Marathon und Salamis hatte er aktiv für die Griechen gekämpft. Sein Bruder war bei Marathon ums Leben gekommen. Auf seinem Grabstein ließ er eine Inschrift anbringen, die seine Tapferkeit in der Schlacht von Marathon rühmt. So sind seine Perser auch Reflex seiner ganz persönlichen Erfahrungen mit den Persern.
Spezial: Fremde unerwünscht! Die Olympischen Spiele der Antike
Olympia – ein internationales Völkerfest. Das ist der Anspruch, seit 1896 die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit stattfanden. In der Antike waren die Olympischen Spiele, die alle vier Jahre im heiligen Hain von Olympia stattfanden, zunächst eine exklusive Angelegenheit für Griechen – genauer: für junge männliche Athleten griechischer Herkunft. Barbaren waren nicht zugelassen. Wer bei Olympia dabei sein wollte, musste gegenüber den Organisatoren den Nachweis erbringen, dass er Grieche war, etwa durch Sprachkenntnisse, die Zugehörigkeit zu einer griechischen Stadt oder die Verbundenheit mit der griechischen Religion. Nicht zugelassen waren anfangs Athleten aus Makedonien. Die Bewohner dieser Landschaft im Gebiet des Olymps galten den Griechen, obwohl sie mit ihnen ethnisch verwandt waren, als Barbaren. König Alexander I., ein Vorfahr des großen Alexander, empfand diese Zurückweisung als Diskriminierung. Mit großem Gefolge erschien er, wie Herodot (5,22) berichtet, in Olympia und marschierte schnurstracks dorthin, wo die Läufer sich auf ihren Wettbewerb vorbereiteten, ganz offensichtlich in der Absicht, mitzulaufen. Die Begeisterung der anderen Sportler, einen veritablen König im Teilnehmerfeld zu sehen, hielt sich jedoch in engen Grenzen, sie forderten seinen Ausschluss mit der Begründung, der Wettkampf sei nicht für fremde, sondern nur für griechische Athleten gedacht. Das war ein Fall für die Schiedsrichter, sie verlangten, dass der König eine griechische Herkunft nachweise. Alexander war gut vorbereitet und legte dar, dass er von seinen Vorfahren her aus der griechischen Stadt Argos stamme. Diese Begründung wurde akzeptiert, Alexander trat an – und gewann? Das wäre des Guten dann doch zu viel gewesen. Aber die Wettkampfrichter waren weise genug, salomonisch zu entscheiden, dass er genauso schnell gelaufen war wie der Sieger.
Später, als die Römer die Herrschaft über Griechenland übernahmen, wurde die Schranke zwischen Griechen und Barbaren aufgehoben. Schließlich waren in der Sicht der Griechen auch die Römer Barbaren. So stand die Teilnahme an den Olympischen Spielen jetzt allen offen. Bis zum Verbot der Spiele durch den römischen Kaiser Theodosius 393 n. Chr. waren die Spiele nun eine internationale Angelegenheit.