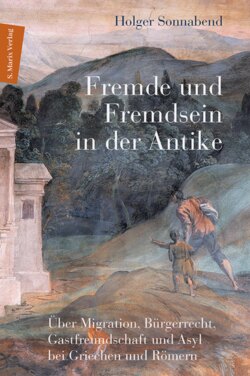Читать книгу Fremde und Fremdsein in der Antike - Holger Sonnabend - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6. Leben mit Fremden – Leben als Fremde
Оглавление»Es kommt wegen der Größe der Stadt aus aller Welt alles zu uns herein.« Perikles bei Thukydides 2,38
»Aus ganz Hellas wandten sich die Verdrängten und Flüchtlinge, immer die Mächtigsten, nach Athen als an einen sicheren Ort, wurden dort Bürger und machten so schon seit ältester Zeit die Stadt noch größer und volkreicher …«
Thukydides 1,2
Für die Griechen war nicht jeder Fremde gleich fremd. Sie nahmen eine deutliche Unterscheidung zwischen griechischen Fremden und nichtgriechischen Fremden vor. Wer kein Grieche war, war ein Barbar. Wer Grieche war, aber einem anderen Stadtstaat angehörte, war kein Barbar, aber doch ein Fremder. Zwar schufen die Griechen durch die Faktoren Abstammung, Sprache, Religion und Lebensformen eine kulturelle Identität, mit der sie sich von Persern, Libyern, Ägyptern oder anderen Völkern – den »Barbaren« eben – abgrenzten. Jedoch bildeten sie in der Antike zu keinem Zeitpunkt eine rechtliche oder gar staatliche Einheit. Die Griechen waren sich selbst ziemlich fremd, sie waren auch in Griechenland fast überall Fremde. Das lag an den politischen Strukturen der klassischen Zeit. Griechenland bestand aus etwa 700, meist sehr kleinen Stadtstaaten, von den Griechen »Poleis« genannt. Jede Polis war autonom und frei, mit eigenen Gesetzen, eigenem Bürgerrecht, eigenen politischen Funktionären, eigenem Kalender, eigener Währung. Sie definierte sich als Personenverband und nicht über das Territorium, in dem die Menschen lebten. So gab es die Athener, die Spartaner, die Korinther, die Thebaner. Schneller als ein antiker Grieche konnte man kaum zum Fremden werden: Er musste nur seine Stadt verlassen, über einen Berg ins nächste Tal gehen, die Grenzen der Nachbarstadt überschreiten – und schon war er ein Fremder.
Kam man nur zu Besuch oder um geschäftliche Angelegenheiten zu regeln, kehrte man anschließend in die eigene Stadt zurück und war kein Fremder mehr. Anders aber verhielt es sich mit jenen Menschen, die für länger oder sogar auf Dauer oder sogar für immer in einer fremden Stadt lebten. Am besten sind in dieser Hinsicht die Verhältnisse in der Polis Athen bekannt. In klassischer Zeit entwickelte sich die Stadt in Attika zu einem der wichtigsten urbanen Zentren in Griechenland. Hierher strömten viele Fremde, Nichtgriechen wie auch Griechen. Sie wurden angelockt von den wirtschaftlichen Möglichkeiten, welche die pulsierende Metropole bot, wie auch von deren kulturellem Glanz.
Wurden sie von der Bevölkerung mit offenen Armen empfangen? Die Politiker jedenfalls sendeten freundliche Signale aus. Allen voran der berühmte Solon. Seine Glanzzeit hatte er vor 2600 Jahren, zu Beginn des 6. Jahrhunderts v. Chr. Er war ein wahres Multitalent: Politischer Reformer, Wegbereiter der athenischen Demokratie, Gesetzgeber, Lyriker, einer der Sieben Weisen der Antike. Mehr passte nicht auf die historische Visitenkarte. Das Ziel, das letztlich hinter all seinen Aktivitäten und all seinem Eifer stand, war Stabilität der politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in Athen. Zuvor hatte es eine Serie von Bürgerkriegen und Konflikten gegeben, ein tiefer Spalt war durch die Gesellschaft gegangen. Ein ganzes Paket von Gesetzen und Maßnahmen sollte dazu dienen, die bedrohte Ordnung wiederherzustellen und die Menschen dafür zu gewinnen, sich für das Wohlergehen und das Funktionieren des Staates einzusetzen.
In diesen Rahmen gehört auch ein bemerkenswertes Gesetz über den Zuzug von Fremden und die Verleihung des Athener Bürgerrechts an Fremde, eine Art antiker Staatsbürgerschaft (Plutarch, Solon 24,4). Unter zwei Voraussetzungen sollten Fremde einen Anspruch haben, in die Bürgergemeinschaft der Athener aufgenommen zu werden: Wenn sie für immer aus ihrer Heimat verbannt worden waren oder wenn sie bereit waren, mit ihrer ganzen Familie nach Athen überzusiedeln, um dort ein Handwerk oder Gewerbe zu betreiben. Willkommen waren also, wie der zweite Punkt zeigt, Migranten, die in der Lage waren, das wirtschaftliche Leben in Athen weiter anzukurbeln. Warum aber zeigte sich Athen offen für Menschen, die man aus ihrer Heimat vertrieben hatte? Vertreibungen waren in dieser Zeit in der Regel das Ergebnis von politischen Unruhen und Bürgerkriegen. Wer auf diese Weise nach Athen kam, war ein Flüchtling – weil er die Heimat entweder freiwillig oder gezwungenermaßen verlassen hatte. Wenn Solon Flüchtlingen und Vertriebenen den Weg nach Athen ebnete, so stand dahinter nicht die Hoffnung, für die Verleihung eines Menschenrechtspreises infrage zu kommen. Vielmehr stand im Vordergrund das ganz rationale und pragmatische Kalkül, mit den politischen Flüchtlingen Menschen Schutz und Sicherheit zu gewähren, die in der Konsequenz alles darangeben würden, sich in ihrer neuen Heimat, wenn auch nicht in führender Position, politisch und gesellschaftlich zu engagieren.
Humanitäre Gründe spielten bei Solon also keine Rolle, maßgeblich war der Wunsch, von den Fremden zu profitieren – wirtschaftlich und politisch. Menschlichkeit im modernen Sinne war ohnehin selten bis gar nicht im Spiel, wenn sich Menschen im antiken Griechenland um antike Fremde kümmerten. Meistens bis immer standen dahinter subjektive Interessen. Unter Solon ging die Rechnung auf, wie die weitere Entwicklung zeigt. Die eingebürgerten Fremden bildeten zusammen mit der einheimischen Bevölkerung das wirtschaftliche Rückgrat des demokratischen Staates Athen. Ihre Stellung war deutlich besser als die der rechtlosen Sklaven, bei denen es sich ebenfalls meistens um Fremde handelte, deren Zuzug nun allerdings alles andere als freiwillig war. Es handelte sich bei ihnen um Kriegsgefangene, die vor allem in der Landwirtschaft und im Bergbau eingesetzt wurden.
Doch war die Einbürgerung von Fremden nicht der Normalfall. Überhaupt wurde die Verleihung des Bürgerrechts an Fremde in der Zeit nach Solon restriktiver gehandhabt. Im Normalfall wurde ihnen die Eintrittskarte in die Bürgergemeinschaft der Athener vorenthalten. Sie bekamen in Athen den Status von Metoikoi, wörtlich »Mitwohnende«. Andere Städte gingen ähnlich vor, fanden nur andere Begriffe für die Fremden, die dauerhaft bei ihnen lebten. Ein Metoikos war, anders als die Sklaven, persönlich frei. Anders als die Bürger hatte er, wie seine ganze Familie, keinerlei politische Rechte. Vom politischen Leben, das in der Demokratie der Athener besonders intensiv war, blieben sie vollständig ausgegrenzt. Weder durften sie wählen noch sich an den Abstimmungen über Gesetze beteiligen.
Die Akropolis von Athen, 2008
Für die Zuordnung in die Gruppe der Metoikoi war ein genaues bürokratisches Prozedere vorgeschrieben. Bis zu 30 Tage durfte sich ein Fremder in der Stadt aufhalten, ohne sich bei den Behörden melden zu müssen. Er galt für diese Zeit als Xenos, was sowohl »Fremder« als auch »Gast« bedeutete. Nach 30 Tagen hatte er sich in die Liste der Metoikoi einzutragen. Die Aufnahme, die regelmäßig gewährt wurde, da es keine Zugangsbeschränkung gab, war gleichbedeutend mit der dauerhaften Aufenthaltsberechtigung. So konnten die neuen Athener, die keine wirklichen Athener waren, nun ihren Geschäften nachgehen und sich ein neues Leben aufbauen, sahen sich aber zugleich einigen Restriktionen ausgesetzt. Nicht allein, dass sie politisch keinerlei Rechte hatten. Sie mussten auch eine besondere Kopfsteuer, Metoikion genannt, zahlen. Sie war nicht sehr hoch und diente vor allem dazu, die Ausgrenzung der Fremden deutlich zu machen. Ein Bürger hatte keine regelmäßigen Steuern zu zahlen, sondern wurde von Zeit zu Zeit, bei Bedarf, zur Zahlung von Sonderabgaben verpflichtet. Vor Gericht durften Fremde nicht selbstständig auftreten, sondern hatten sich einen Interessenvertreter zu wählen. Der gravierendste Unterschied zu den Bürgern bestand darin, dass die Fremden keinen Grundbesitz erwerben durften. Diese Bestimmung folgte der Logik, warum man Fremde prinzipiell mit offenen Armen empfing: Sie sollten sich um Handel, Gewerbe und Handwerk kümmern und auf diese Weise die athenische Wirtschaft ankurbeln.
Weniger Rechte, dafür aber gleiche Pflichten – unter diese Kategorie fällt die Praxis, Fremde zum Militärdienst heranzuziehen. In Athen gab es, wie in den anderen griechischen Stadtstaaten, keine Berufsarmee und kein stehendes Heer. Wenn Krieg ausbrach – in der klassischen Zeit alles andere als eine Seltenheit –, zogen die Bürger ins Feld, an ihrer Seite Metoikoi, die, wenn sie sich militärisch bewährten, zur Belohnung das Bürgerrecht erhalten konnten. Nach dem verlustreichen Peloponnesischen Krieg, den die griechischen Supermächte Athen und Sparta 27 Jahre lang führten, von 431 bis 404 v. Chr., kamen mehr und mehr Söldner zum Einsatz, die in der Fremde rekrutiert wurden. Militärisch waren sie ein Gewinn, doch litten sie unter einem notorisch schlechten Ruf, den sie sich auch deswegen erwarben, weil sie, befreit von der Disziplin ihrer Herkunfts-Gesellschaften, sich in der Fremde in einer rechts- und moralfreien Zone wähnten und häufig auch genauso verhielten.
Bunte Truppe
Der Historiker Thukydides über das militärische Aufgebot, das die Athener 415 v. Chr. nach Sizilien schickten (6,43):
»Und nun war es so weit, dass die Athener von Kerkyra (Korfu) in See stachen und hinüber fuhren nach Sizilien. Trieren waren es im Ganzen 134 sowie zwei Fünfzigruderer aus Rhodos. Davon kamen 100 aus Athen – 60 Schnellfahrer, die anderen Truppenschiffe –, die übrige Flotte aus Chios und von den anderen Verbündeten; Gepanzerte insgesamt 5100, davon Athener 1500 nach der Liste und 700 von den Ärmeren als Schiffsbesatzung. Die anderen waren mit aufgebotene Hilfsvölker, teils von den Untertanen, aber auch 500 aus Argos und 250 aus Mantineia und Söldner. Schützen im Ganzen 480, wovon 80 aus Kreta waren, 700 Schleuderer aus Rhodos und Plänkler aus Megara, von den Verbannten 120 und ein Lastschiff für Pferde mit 30 Reitern.«
Die Athener nahmen Fremde aus wirtschaftlichen Gründen gerne auf, schlossen sie aber rigoros aus ihrer Bürgergemeinde aus. Für den Umstand, dass griechische Stadtstaaten wie Athen an einer hohen Bevölkerungszahl, nicht aber an einer hohen Bürgerzahl interessiert waren, waren strukturelle Gründe verantwortlich. In Theorie und Praxis galt die Regel: Eine Polis darf nicht zu groß sein. Die Polis lebte von der politischen Partizipation der Bürger. Das erforderte eine Limitierung der politisch Berechtigten, denn Politik funktionierte nach Meinung der Griechen nur im intensiven Austausch und in kommunikativer Atmosphäre. Im Idealfall sollten sich alle persönlich kennen. Zu viele Fremde würden das System zerstören. Der Universalgelehrte Aristoteles, auf dessen imposanter Visitenkarte auch der Eintrag »Staatstheoretiker« steht, sagte, zehn Menschen seien für einen Staat zu wenig, hunderttausend zu viel (Nikomachische Ethik 1170 b31). »Wer könnte«, so fragte er rhetorisch, »Stratege einer übergroßen Masse oder wer ein Herold sein, wenn er nicht eine Stimme wie Stentor hätte?« (Politeia 1326 b5) – also wie jene Figur des griechischen Mythos, die im Rahmen des Trojanischen Krieges mit gewaltigen phonetischen Fähigkeiten auftritt.
Die meisten griechischen Stadtstaaten erfüllten das Anforderungsprofil des klugen Wissenschaftlers. Nur die Kultur- und Wirtschaftsmetropole Athen fiel aus der Rolle. In ihrer Glanzzeit im 5. Jahrhundert v. Chr. lebten hier geschätzt etwa 250 000 Menschen – nicht alle in der Stadt selbst, sondern auch in dem zugehörigen agrarisch geprägten Umland von Attika. Dies war jedenfalls der Zustand, nachdem Athen durch den Sieg gegen die Perser zur wichtigsten Stadt in Griechenland aufgestiegen war. Nach dem verheerenden Krieg gegen Sparta zwischen 431 und 404 v. Chr. (der »Peloponnesische Krieg«) sank die Einwohnerzahl aufgrund hoher Verluste signifikant. Von den 250 000 Bewohnern der Glanzzeit besaßen ca. 30 000 – knapp über 10 % – das Bürgerrecht. Andere Schätzungen gehen – zu hoch – von bis zu 50 000 Bürgern aus. Dabei handelte es sich um die politisch vollberechtigten Männer über 18 Jahren. Frauen und Kinder blieben also ausgeschlossen, wie auch die Sklaven und die Fremden – auch wenn diese, wie die Metoikoi, dauerhaft ortsansässig waren. Deren Zahl dürfte zwischen 25 000 und 35 000 gelegen haben. Das heißt: Gemessen an der Gesamtbevölkerung von 250 000 machten die Fremden einen Anteil von mindestens 10 % aus. Es gab in Athen im 5. Jahrhundert v. Chr. daher genauso viele Fremde wie Bürger. Im 4. Jahrhundert v. Chr. waren die Verhältnisse nicht viel anders. Um 340 v. Chr. wurde eine Volkszählung durchgeführt. Dabei kam heraus (Athenaios 272c), dass damals in Athen 21 000 einheimische Vollbürger lebten, während die Zahl der (männlichen) Metoikoi bei 10 000 lag. Ein Drittel aller athenischen Haushalte waren »fremde« Haushalte.
Metoikoi und ihre Herkunftsorte
Die Fremden, die dauerhaft in Athen lebten, kamen aus 380 Städten und Orten zwischen Sizilien und Kleinasien. Die größte Gemeinde stellten Zuwanderer aus der Handelsmetropole Milet im Westen der heutigen Türkei. Auf Platz zwei lagen Griechen aus der Stadt Herakleia am Schwarzen Meer. Nach Ausweis der Grabinschriften kamen viele auch aus Ägypten, Thrakien und Zypern.
Der Anspruch auf überschaubare Verhältnisse war ein Grund für die fehlende Bereitschaft zur Integration von Fremden in die politische Gemeinschaft, die Mentalität des Polisbürgers ein weiterer. Das Bürgerrecht galt als exklusives Privileg, auf das man stolz war und das man nicht gerne Fremden anbot. Die Polis verstand sich als ein geschlossener Personenverband. Es galt das Prinzip der Abstammung. In der Regel musste ein Elternteil seine Herkunft aus der jeweiligen Stadt nachweisen, egal, ob Vater oder Mutter. Die Athener, die sich gerne ihrer Weltoffenheit rühmten, waren in dieser Hinsicht noch restriktiver. 451/50 v. Chr. wurde auf Betreiben des Perikles ein Gesetz beschlossen, wonach das Athener Bürgerrecht auf Kinder beschränkt wurde, deren beide Elternteile aus Athen stammten.
Perikles selbst bewies dabei eindrucksvoll, dass für einen Politiker gelegentlich andere Maßstäbe gelten als für jene Menschen, die von ihren Gesetzen betroffen sind. Er verliebte sich in eine Frau namens Aspasia, die aus Milet stammte. Sie war eine Griechin, aber nach den von den Athenern aufgestellten Regeln eine Fremde. Als er sie kennenlernte, war Perikles verheiratet – ordnungsgemäß mit einer Athenerin. Wie der Biograf Plutarch lapidar mitteilt, waren sie aber nicht glücklich miteinander, und Perikles überließ sie großzügig einem anderen Mann. Wahrscheinlich war der wirkliche Grund der Trennung das Erscheinen der Aspasia, die dem um gut 25 Jahre älteren Perikles den Kopf verdreht hatte. Über den rechtlichen Status der Verbindung sind in der modernen Forschung viele Diskussionen geführt worden. Eine reguläre Ehe führten Perikles und Aspasia vermutlich nicht, denn mit einer offiziellen Heirat hätte er gegen die Prinzipien seiner eigenen Bürgerrechtspolitik verstoßen, die ihm bei der athenischen Bevölkerung viele Sympathien eingebracht hatte. Der Sohn, den Aspasia bald zur Welt brachte und dem die Eltern den Namen Perikles gaben, wurde demzufolge von den Gegnern des Perikles in der Diktion wenig freundlich, in der Sache aber durchaus zutreffend als »Bastard« bezeichnet. Nach rechtlichen Kategorien war die Verbindung zwischen Perikles und Aspasia also so etwas wie ein Konkubinat. Da half es auch nicht, dass Perikles, wenn er morgens zur Arbeit ging, seine Aspasia vor der Haustür zum Abschied »zärtlich küsste«, wie professionelle Voyeure zu bezeugen wussten.
Perikles war ein kluger Politiker, doch die Umsetzung der neuen Verordnung hatte er sich wahrscheinlich einfacher vorgestellt. Denn nun erhob sich eine wichtige Frage: Ab wann sollte das Gesetz Gültigkeit haben? Waren Athenerinnen oder Athener, die nur über einen aus Athen stammenden Elternteil verfügten, nun plötzlich keine Athenerinnen und Athener mehr? Mussten sie sofort aus den Listen der Bürger gestrichen werden? Die Nagelprobe folgte auf dem Fuß. Ein auswärtiger Potentat – die Rede ist vom »König von Ägypten«, das damals allerdings unter persischer Herrschaft stand – vermachte dem Volk von Athen, wie Plutarch (Per. 37) berichtet, ein Geschenk von 40 000 Scheffel Weizen. Dem »Volk von Athen«? Das konnten nur die Bürger sein. Aber wer war nach dem Gesetz des Perikles nun plötzlich kein Bürger mehr?
Porträtbüste der Aspasia, Gefährtin des Perikles, 5. Jh. v. Chr., Vatikanische Museen, Rom
»Als das Getreide unter die Bürger verteilt werden sollte, gab es infolge dieses Gesetzes plötzlich eine Menge von Prozessen gegen die nicht vollbürtigen Athener, die bis dahin unbemerkt geblieben und übersehen worden waren. Mancher fiel auch falscher Anklage zum Opfer. Gegen 5000 wurden auf diese Weise überführt und in die Sklaverei verkauft. Die Zahl derer, die aufgrund der Prüfung das Bürgerrecht behielten und als Athener bestätigt wurden, betrug 14 040.«
In die Sklaverei verkauft – das war ein merkwürdiges, sogar tragisches Schicksal. Eben noch fühlten sich die Betroffenen als athenische Bürger, gut aufgehoben in jenem Staat, den sie als den ihrigen ansahen. Und nun waren sie auf einen Schlag rechtlose Fremde in einem anderen Staat, wohin man sie als Sklaven verkauft hatte.