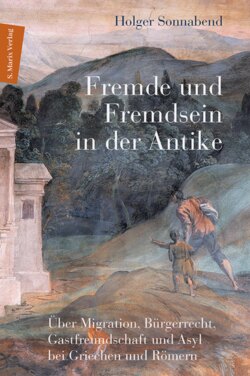Читать книгу Fremde und Fremdsein in der Antike - Holger Sonnabend - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5. Exotische Fremde – Ethnografie und Mythos
ОглавлениеDas Fremde hatte es in der Antike leichter, wenn es weiter entfernt lag. Je exotischer, desto besser. Von fernen Fremden war man fasziniert, weil man ihnen, anders nahen Fremden, entspannt und offen begegnen konnte. Diese Haltung hat die Antike nicht exklusiv gepachtet, sondern scheint so etwas wie eine anthropologische Konstante zu sein – wenn man nur daran denkt, wie Europa im Mittelalter und der Frühen Neuzeit dem Fernen Osten oder in der Neuzeit der karibischen Inselwelt begegnet ist. Fremde Völker, fremde Sitten und fremde Landschaften dienen dabei immer auch als Projektionsflächen eigener Wünsche und Sehnsüchte. Und sie befriedigen die Neugier und lassen staunen.
So wurden in der griechischen Geografie und Ethnografie die Völker am Rande der Oikumene, der bewohnten, vom Weltmeer, dem Okeanos, umgebenen Landmasse, zu wundersamen Gesellschaften stilisiert. Exotische Fremde wurden im – aus griechischer Sicht – äußersten Süden, Osten, Norden und Westen angesiedelt. Je ferner, desto exotischer. Ein typisches Beispiel für die klassische Zeit wird von dem auch in dieser Hinsicht sehr auskunftsfreudigen Herodot geliefert (4,185). Dort, wo der griechische Schriftsteller des 5. Jahrhunderts v. Chr. die in Libyen lebenden Menschen porträtiert, nimmt er seine Leser und Hörer mit auf eine Reise zu den Garamanten und Troglodyten, zwei exotischen Völkern in Nordafrika:
»Von Augila aus kommen nach zehn weiteren Tagen des Weges wieder ein Salzhügel und Wasser und viele fruchttragende Dattelpalmen, wie bei den anderen. Auch da wohnen Menschen, die heißen Garamanten, ein mächtig großes Volk. Sie tragen Erde auf das Salz und säen dann. Hier kommt der Höhenzug der Lotophagen am nächsten. Von denen bis hierher sind es 30 Tage. Bei ihnen gibt es auch die rückwärts weidenden Rinder. Rückwärts weiden sie deswegen: Ihre Hörner sind nach vorne gebogen, darum gehen sie rückwärts, wenn sie weiden. Vorwärts können sie nämlich nicht, denn sonst würden sie mit ihren Hörnern in den Boden stoßen. Sonst unterscheiden sie sich gar nicht von anderen Rindern, nur hierin und dann dadurch, dass ihre Haut sehr stark und haltbar ist. Diese Garamanten machen Jagd auf die aithiopischen Troglodyten, und zwar mit Viergespannen. Die aithiopischen Troglodyten nämlich haben die schnellsten Beine von allen Menschen, von denen uns darüber berichtet wird. Diese Höhlenbewohner ernähren sich von Schlangen und Eidechsen und anderem solchem Gewürm. Es gibt bei ihnen eine Sprache, die ist keiner anderen ähnlich, sondern sie kreischen wie Fledermäuse.«
Das sind seltsame Informationen, die Herodot über die Fremden verbreitet. Ein gemeinsamer Nenner bei der Betrachtung des exotischen Fremden aber ist, neben dem Wundersamen und Ungewöhnlichen, der Naturbezug dieser Völker. Sie sind ein urtümliches Gegenmodell zu den (tatsächlich oder vermeintlich) zivilisierten Völkern. Sie können sogar ein Vorbild sein. Die Libyer am Tritonsee, berichtet Herodot (4,189), verehren nicht, wie alle anderen, die Sonne und den Mond, sondern die griechischen Gottheiten Athene, Triton und Poseidon. Den Tritonsee haben die Griechen über die Argonauten-Sage (Jason auf der Suche nach dem Goldenen Vlies) in ihren geografischen und kultischen Horizont einbezogen. Bekannt geworden ist er ihnen während der Großen Kolonisation, als griechische Siedler und Abenteurer auf der Suche einer neuen Heimat auch der afrikanischen Küste Besuche abstatteten.
Doch die Libyer haben nicht nur genommen, sondern auch gegeben. Genauer gesagt: Es waren die libyschen Frauen, die griechischen Frauen in Sachen Kleidung und Mode als Vorbild dienten, und auch die akustische Begleitung kultischer Handlungen war libyscher Herkunft, wie Herodot wissen will (4,189): »Ich habe auch die Vermutung, dass das helle Schreien (ololyge) beim Opfern dort zuerst aufgekommen ist. Denn die libyschen Frauen verwenden es reichlich und verwenden es schön.« Um aber bei den stolzen Griechen nicht den Eindruck zu erwecken, man habe zu viel von den barbarischen Libyern übernommen, fügt der Autor zur Beruhigung hinzu (4,198): »Ich meine aber, auch in seiner Leistung ist Libyen nicht so bedeutend, dass man es mit Europa oder Asien gleichstellen kann.«
Zwischen den Garamenten und den Troglodyten tauchen bei Herodot die Lotophagen auf – eine griechische Bezeichnung für die »Lotosesser«, denen bereits Homer in der Odyssee ein literarisches Denkmal gesetzt hatte (9,82–105). Seine Irrfahrten führten den griechischen Trojahelden und seine Begleiter an die Gestade dieses Volkes. Wie würden sie als Fremde empfangen werden? Zwei seiner Leute schickte Odysseus als Kundschafter voraus. Das Ergebnis dieses Besuches war erfreulich und unerfreulich. »Die Lotophagen beleidigten nicht im geringsten unsere Freunde, sie gaben den Fremdlingen Lotos zu kosten.« Die Gefährten freuten sich über den freundlichen Empfang, beachteten aber nicht die Risiken und Nebenwirkungen des Genusses der Lotospflanze:
»Wer nun die Honigsüße der Lotosfrüchte gekostet,
Dieser dachte nicht mehr an Kundschaft oder an Heimkehr,
Sondern sie wollten stets in der Lotophagen Gesellschaft
Bleiben und Lotos pflücken und ihrer Heimat entsagen.«
Odysseus aber war wie immer zur Stelle, und befreite die Gefährten aus ihrer misslichen Lage, indem er »die Weinenden mit Gewalt wieder ans Ufer zog«. Herodot lokalisiert dieses bemerkenswerte Volk der Lotosesser im östlichen Nordafrika. Damit gehört er zu den antiken Vorläufern jener unermüdlichen Schar von Forschern und Abenteurern, die viel Energie in die vom historischen Standpunkt aus relativ aussichtslose Idee investiert haben, die Schauplätze der homerischen Odyssee mit konkreten Orten innerhalb oder gar außerhalb der Mittelmeerwelt in Verbindung zu bringen. Die Lotophagen als Volk hat es nicht gegeben, sie gehören dem Reich der Fantasie an, ebenso wie das erstaunliche Volk der Enotokoiten – Menschen, die so große Ohren hatten, dass sie sich im Schlaf damit zudecken konnten, oder die wundersamen Kynokephaloi, Menschen, die mal in Indien, mal in Afrika angesiedelt wurden, einen Hundekopf hatten und wie die Enotokoiten passenderweise ihre physiognomische Erscheinung auch gleich als Volksnamen trugen. Die Garamanten und Troglodyten indes sind real – ein Beweis dafür, wie unbefangen selbst ein versierter Historiker wie Herodot wirkliche und fiktive Völker miteinander kombinierte. Das Ferne in diesem Sinne ist häufig mehr Fantasie als Realität. Manchmal geht die Realität in Fantasie oder die Fantasie in Realität über. Wenn die Fantasie auf die Realität trifft, können sich bemerkenswerte Konstellationen ergeben.
Ein fester Begriff im griechischen Repertoire exotischer Völker waren die Aithiopes. Die Vokabel aithiops bedeutet im Griechischen »dunkel, schwarz, verbrannt«. Als »Äthiopier« bezeichneten sie alle Menschen mit dunkler Hautfarbe – auch diejenigen im heutigen Libyen, die Herodot als Troglodyten identifiziert und denen er so schmeichelhafte Komplimente zu ihren stimmlichen Qualitäten machte. Wer in der Antike einer Homer-Lesung beiwohnte (immer die erste literarische Referenz, wenn es um frühe Zustände und Entwicklungen bei den Griechen geht), musste nicht lange warten, bis die Äthiopier erwähnt wurden. Sie tauchen gleich im ersten Buch der Ilias auf (1,423–425). Dort sind sie die Gastgeber der olympischen Götter:
»Zeus ging gestern zum Mahl der unsträflichen Äthiopen
An des Okeanos Flut, und die Himmlischen folgten ihm alle.
Aber am zwölften Tag dann kehrt er heim zum Olympos.«
Nicht jedem Volk der Antike widerfuhr die Ehre, von der Götterfamilie zum freundlichen Gastmahl aufgesucht zu werden. So werden die »unsträflichen« (man kann auch sagen »untadeligen«) Äthiopier in das erste Werk der europäischen Literaturgeschichte mit einer deutlich positiven Note eingeführt. Im Nachfolgewerk, der Odyssee, tauchen die Äthiopier noch früher auf, gleich im 22. Vers des ersten Buches. Bei ihnen hält sich der Odysseus zürnende Gott Poseidon auf, schon wieder speisend, während der Rest der Götterfamilie auf dem Olymp über das Schicksal des irrfahrenden Trojahelden beratschlägt. »Die äußersten Menschen« werden die Äthiopier hier genannt, ganz am Rande der bewohnten Welt lebend. Das ferne Dasein garantiert ihnen die Sympathien der Griechen und stilisiert sie zu einem idealisierten Naturvolk, bei dem die Götter gerne zum Essen vorbeischauen. In direkter Nachbarschaft zu den Griechen hätten sie es schwerer gehabt.
Bemerkenswerterweise spricht Homer an keiner Stelle von der dunklen Hautfarbe der Äthiopier. Homer schrieb seine Epen am Ende des 8. Jahrhunderts v. Chr. Dunkelhäutige Menschen hatten die Griechen aber schon lange vorher kennengelernt, in der mykenischen Zeit, als sie im ostmediterranen Raum ein enges Netz an Handelskontakten knüpften. Und vor ihnen waren es die Minoer auf Kreta gewesen, die über Ägypten Beziehungen zu Afrika pflegten. Dabei gab es genug Gelegenheiten und auch Möglichkeiten, Menschen mit dunkler Hautfarbe zu begegnen. Die frühen Griechen prägten aufgrund dieser Beziehungen, lange vor Homer, den Namen Äthiopier und meinten damit dunkelhäutige Menschen. Bei Homer haben sie ihre Farbe verloren – eine Folge des Umstandes, dass in den Jahrhunderten zuvor, nach dem Zusammenbruch der Mykenischen Kultur, keine nennenswerten Kontakte zu Ägypten und damit zu anderen Völkern Afrikas bestanden. Die Fremden sind weder weiß noch schwarz, sondern einfach nur noch die Äthiopier am Rande der Welt, bei denen gelegentlich die Götter zu Gast sind. Und dann eine weitere Wende: Schon in der Zeit Homers, der noch alte Konventionen verwaltet, aber verstärkt danach gehen die Griechen im Zuge der Großen Kolonisation wieder in die weite Welt hinaus, begegnen auch wieder den »richtigen« und nicht mehr nur den »mythischen« Äthiopiern – und schon erhalten sie ihre Farbe wieder, wie Texte, aber auch Vasenbilder mit der Darstellung von schwarzen Menschen zeigen. Bilder von Fremden können sich, so lehrt dieses Beispiel, ändern – je nach Situation und Intensität der Kontakte.