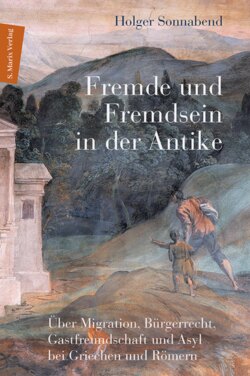Читать книгу Fremde und Fremdsein in der Antike - Holger Sonnabend - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PROLOG: BEREICHERUNG ODER BEDROHUNG? EINE ANTIKE DISKUSSION ÜBER FREMDE IN ROM
ОглавлениеRom an einem Tag des Jahres 48 n. Chr. Der Sitzungssaal des römischen Senats auf dem Forum Romanum ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Das ehrwürdige Gremium der Senatoren diskutiert über eine brisante Frage. Die Gemüter sind erhitzt, die Emotionen kochen hoch, noch mehr als üblich. Es geht um einen Antrag, eingebracht von prominenten Persönlichkeiten aus Gallien. Schon lange ist das heutige Frankreich Teil des Römischen Reiches. Es war 100 Jahre zuvor von dem berühmten Feldherrn Iulius Caesar in seinem nicht minder berühmten »Gallischen Krieg« unterworfen worden. Inzwischen haben viele Bewohner des Landes das römische Bürgerrecht erhalten. Rom ist großzügig, wenn es darum geht, Fremde zu römischen Bürgern zu machen – nicht aus einer humanitären Grundhaltung heraus, sondern weil die Regierenden der Ansicht sind, dass ein Staat sich besser lenken lässt, wenn die Bewohner das Gefühl haben, gleichberechtigt zu sein. So sind viele Menschen, die im Römischen Reich leben, zwar von der Herkunft her Syrer, Ägypter, Griechen oder Germanen, doch im rechtlichen Sinne sind sie Römer – Herkunftsfremde und Rechtsrömer in einer Person.
Integration ist in Rom politisch gewollt. Doch was jetzt, im Jahre 48 n. Chr., auf der Tagesordnung des Senats steht, geht vielen, insbesondere den Vertretern der alten Adelsfamilien, entschieden zu weit. Der Antrag der Gallier lautet: Wir verlangen Zugang zu den hohen politischen Ämtern. Weil in Rom mit dem Amt traditionell auch der Anspruch auf einen Sitz im Senat verbunden ist, stünde ihnen damit auch der Weg in die Regierung offen. Gallier in römischen Schlüsselpositionen? Gallier als Konsuln, Praetoren, Tribunen? Viele Senatoren, die sich einiges auf ihren Stammbaum einbilden, verfallen in einen Zustand der Schockstarre, bevor sie heftig zu protestieren beginnen. Die Vorstellung, im Senat einen gallischen Sitznachbarn zu haben, und möge er auf dem Papier auch Römer sein, bereitet ihnen eine gehörige Portion Bauchschmerzen. Die Sache ist so wichtig, dass sie dem Kaiser vorgetragen wird. Die Kritiker fassen ihm gegenüber ihre Bedenken zusammen:
»Italien ist nicht so heruntergekommen, dass es seiner Hauptstadt nicht selbst einen Senat zur Verfügung stellen könne.«
»Früher sind die verwandten Völker mit geborenen Römern zufrieden gewesen, und man braucht sich der alten Republik doch nicht zu schämen.«
»Sogar jetzt noch wird an die Vorbilder erinnert, die entsprechend der alten Sitte römisches Wesen, um Tapferkeit und Ruhm bemüht, geschaffen haben.«
»Erfreuen sollen sich die Gallier an der Bezeichnung ›Bürger‹. Die Insignien der Senatoren und die Ehrenzeichen der hohen Beamten dürfen sie nicht zum Gemeingut machen.«
Was sagt der Kaiser zu diesen Argumenten? Der Kaiser merkt: Es gibt kein wirkliches sachliches Argument. Wir brauchen sie nicht, heißt es von den Kritikern, und: Das haben wir noch nie so gemacht. Die Senatoren aus Italien fürchten offenbar die Konkurrenz und ihre politischen Privilegien. Sie berufen sich auf eine abstrakte, aber zentrale römische Institution, den mos maiorum, die »Sitte der Vorfahren«. Was früher richtig war, kann heute nicht falsch sein.
Der Kaiser, dem die Gegner diese Argumente vortragen, heißt Claudius. Seit sieben Jahren im Amt, ist er als Nachfolger des berüchtigten Caligula bemüht, einen soliden, sachlichen Regierungsstil zu pflegen. Was er den versammelten Senatoren sagt, wissen wir ganz genau – dank einer Inschrift mit dem Text der Rede, die sich in Lyon, dem antiken Lugdunum, befindet und die von den glücklichen Galliern aufgestellt wurde, um die Ausführungen des Kaisers für alle Zeiten zu dokumentieren (Corpus Inscriptionum Latinarum 13,1668). Der Kaiser ergreift das Wort. Auch er spricht von der Vergangenheit, deutet sie aber ganz anders. Verschnörkelt und holprig im Stil, wie es seine Art ist, aber in der Sache unmissverständlich führt er aus:
»Ich bitte euch, daran zu denken, wie viele Neuerungen in dieser Stadt eingeführt wurden.
Einstmals hatten Könige diese Stadt in ihrem Besitz. Es gelang ihnen jedoch nicht, die Herrschaft über sie Nachfolgern aus ihrem Haus zu übertragen. Fremde traten an ihre Stelle und sogar Ausländer, sodass Numa, der aus dem Sabinerland kam, auf Romulus folgte. Er war uns zwar benachbart, aber war damals ein Mann von auswärts. […]
Sicher führte man einen neuen Brauch ein, als der vergöttlichte Augustus, mein Großonkel, und mein Onkel Tiberius Caesar den Willen äußerten, die gesamte Blüte der Kolonien und Landstädte von überall her, das heißt die besten und wohlhabendsten Männer, sollte in diesem Senat einen Sitz erhalten. […]
Wie? Ist uns nicht ein Senator aus Italien lieber als einer aus den Provinzen? … Meiner Ansicht nach darf man nicht einmal Menschen aus den Provinzen zurückweisen, sofern sie nur das Ansehen der Kurie erhöhen können. […]
Wenn jemand bei den Galliern auf den Umstand schaut, dass sie dem vergöttlichten Iulius Caesar in einem zehnjährigen Krieg zu schaffen machten, dann möge er zugleich ihre 100-jährige unerschütterliche Treue dem entgegenstellen und ihren Gehorsam, der in vielen Krisen von uns mehr erprobt worden ist.«
Die Lehre, die wir aus der Vergangenheit ziehen müssen, lautet nach Ansicht des Kaisers: Fremde haben für Rom zu allen Zeiten Gutes bewirkt. Er führt große Namen ins Feld, als Zeugen dafür, dass Rom schon immer offen für fremde Menschen war: Romulus, den mythischen Stadtgründer und ersten König von Rom; Numa (Pompilius), den zweiten König von Rom; Augustus, den ersten römischen Kaiser; Tiberius Caesar, den zweiten Kaiser.
Die Worte des Kaisers geben den Ausschlag. Die Mehrheit der Senatoren beschließt, dass die fremden Gallier Spitzenämter bekleiden und in den Senat von Rom aufgenommen werden dürfen. Zwar sind nicht alle, die zustimmen, wirklich überzeugt. Aber es kann der eigenen Karriere nichts schaden, dem Kaiser einen Gefallen zu erweisen.
Die Argumente der Skeptiker hat der römische Historiker Tacitus in einem Standardwerk zur Geschichte der frühen römischen Kaiserzeit überliefert (Annalen 11,23). An gleicher Stelle (24–25) präsentiert er die inschriftlich erhaltene Rede des Kaisers Claudius in einer etwas freieren Bearbeitung und legt ihm dabei eine noch fremdenfreundlichere Haltung in den Mund, als sie der Kaiser ohnehin schon hatte:
»Meine Vorfahren, deren ältester, Clausus, ein geborener Sabiner, zugleich in die Bürgerschaft Roms und unter die Familien der Patrizier aufgenommen worden ist, mahnen mich, nach den gleichen Grundsätzen bei der Staatsführung zu verfahren, indem ich hierherhole, was sich irgendwo hervorgetan hat.
Was anderes wurde den Spartanern und Athenern trotz ihrer militärischen Übermacht zum Verhängnis, dass sie Besiegte, weil sie fremdstämmig waren, ausgrenzten? […]
Da besaß doch der Gründer unseres Staates, Romulus, so viel Weisheit, dass er die Mehrzahl der Volksstämme am selben Tag als Feinde und dann als Bürger behandelte. […]
Fremde haben über uns geherrscht. Den Söhnen Freigelassener Staatsämter zu übertragen, ist nicht, wie sehr viele meinen, etwas Neues, sondern war schon früher beim Volk üblich. […]
Da die Gallier schon durch Sitten, Bildung und Verschwägerung mit uns vermischt sind, mögen sie ihr Gold und ihre Schätze lieber hierher zu uns bringen als für sich allein zu behalten. […]
Alles, Senatoren, was man heute für uralt hält, ist einmal neu gewesen. […] Einbürgern wird sich auch die jetzige Regelung, und was wir heute durch Vorbilder verteidigen, wird einst zu den Vorbildern gehören.«
Die Aufnahme der Gallier in den römischen Senat ist ein markantes Beispiel für eine positive Einstellung gegenüber Fremden in der Antike. Die Gegner der Aufnahme waren Vertreter der einheimischen Eliten, die durch den Eintritt von Fremden in die politischen Führungszirkel um ihre Macht und ihre Privilegien fürchteten. Sie hatten aber keine Chance, ihre Wünsche durchzusetzen. Kaiser Claudius als oberste Autorität entschied anders. Er hatte keine humanitären Motive. Ihm ging es um den Nutzenaspekt. Er schätzte das wirtschaftliche und politische Potenzial der Fremden. Und er hoffte, in den Fremden Verbündete zu finden, weil sie ihm zu Dank verpflichtet waren. Sie konnten ihm das mitunter schwierige Geschäft des Regierens erleichtern, wenn sie sich im Senat für ihn einsetzten. Der historische Berichterstatter Tacitus, sonst nicht unbedingt ein Freund von Fremden, argumentierte nicht staatspolitisch, sondern in eigener Sache. Seine Familie stammte wahrscheinlich aus Gallien, und er war zu einer späteren Zeit selbst Mitglied des römischen Senats. Die Haltung des Kaisers Claudius bedeutete für ihn eine Unterstützung und Legitimierung der eigenen politischen Position.
Seine positive Haltung gegenüber Fremden brachte Claudius viel Kritik ein, auch später noch, nach seinem Tod, wie eine eigenartige Quelle aus der Regierungszeit seines Nachfolgers Nero dokumentiert. Sie stammt aus der Feder Senecas, Neros einflussreichem Berater, der dank dieser Tätigkeit im direkten Umfeld der Macht Millionär wurde und in der Attitüde des stoischen Philosophen seine nicht ganz so begüterten Zeitgenossen für die Idee zu begeistern versuchte, das höchste Glück in Genügsamkeit und Askese zu sehen. Ein paar Monate nach Neros Herrschaftsantritt 54 n. Chr. veröffentlichte Seneca eine Satire mit dem Titel Apocolocyntosis. In dieser genialen Verballhornung der Praxis, römische Kaiser nach ihrem Tod durch die Apotheose, die Entrückung zu den Göttern, zu ehren (der Titel bedeutet »Verkürbissung«), hat sich der verstorbene Kaiser Claudius vor den himmlischen Göttern zu verantworten. Doch zunächst muss die Seele den Körper verlassen, sie findet aber keinen Ausgang. Schuld daran ist die Schicksalsgöttin Clotho. Sie möchte dem Kaiser noch etwas Zeit geben, »bis er auch noch die paar Leutchen, die übrig geblieben sind, mit dem Bürgerrecht beschenkt hätte«. Erklärend sagt der Erzähler an dieser Stelle: »Claudius hatte sich nämlich in den Kopf gesetzt, alle Griechen, Gallier, Spanier, Britannier in der Toga zu sehen.« Clotho fährt fort: »Aber da nun laut Beschluss noch einige Ausländer als Saatgut für später bleiben sollen und du befiehlst, es solle so sein, so sei’s denn.« (3,3) Etwas später tritt die Göttin Febris auf. Sie ist für Krankheiten zuständig, insbesondere für fiebrige Infekte. Ihr Heiligtum befand sich in Rom auf dem Palatin, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Residenz des Kaisers. Insofern war sie Expertin für alles, was den – häufig kränkelnden – Claudius betraf. Und nun betreibt sie Aufklärung. Claudius – ein Römer? Nein, er ist in Lugdunum (heute Lyon) geboren, er ist also »ein lupenreiner Gallier«, und »deswegen hat er auch, wie es sich für einen Gallier gehört, Rom eingenommen«. Ein tiefer Griff in die Geschichte: 387 v. Chr. hatten Gallier die Stadt Rom gestürmt. Und nun lud der »Gallier« Claudius seine »Landsleute« dazu ein, im Senat Platz zu nehmen. Bei dieser Argumentation interessierte es nicht, dass Claudius in Wirklichkeit einer alten Römerfamilie entstammte. Dass er in Lyon geboren wurde, war reiner Zufall, weil sein Vater Drusus zu diesem Zeitpunkt dort in militärischer Mission seine Zelte aufgeschlagen hatte.
Die hohe Politik folgt eigenen Gesetzen, auch, wenn es um Fremde geht. Anders sieht es im normalen Alltag aus. Das Rom der Kaiserzeit war ein Schmelztiegel der Völker und Kulturen. Mehr als eine Million Menschen lebten in der Hauptstadt des Imperiums. Viele von ihnen kamen aus dem Osten der Mittelmeerwelt – aus Griechenland, Anatolien, Persien, Judäa, Syrien, Ägypten.
Iuvenal mag die Fremden nicht. Vor allem die aus dem Orient sind ihm zuwider. Iuvenal ist Dichter. Daher hat er die Gelegenheit, seiner Aversion gegen die Fremden ein breiteres Forum zu verschaffen. Er schreibt Satiren. In Rom handelt es sich dabei, anders als im heutigen Verständnis, um eine spezielle dichterische Form und nicht um eine mit pointierten Zuspitzungen arbeitende Kunstgattung. Was er sagt, meint er auch so. Seine Passion sind die Verhältnisse in der Großstadt Rom – der Alltag, die Menschen, ihre Sorgen und Nöte in der Kaiserzeit, zu Beginn des 2. Jahrhunderts n. Chr.
In der dritten Satire geht es um die Fremden. Ein Freund namens Umbricius ist des Treibens in der Hauptstadt überdrüssig und sehnt sich nach Ruhe und Entspannung. Er will den Moloch Rom verlassen und sich in das anmutige Cumae am Golf von Neapel zurückziehen. Gegenüber seinem Freund Iuvenal präzisiert der Großstadtmüde seine Motive für die Flucht.
Ihn stört viel – die Betriebsamkeit, der Lärm, die Geschäftemacher, die Gefahr von einstürzenden Häusern und Bränden, die Schlaflosigkeit, der Verkehr. Vor allem aber stören ihn die vielen Fremden (Sat. 3, 58 ff.).
»Welches Volk heute bei unseren Reichen am beliebtesten ist und vor wem ich vor allem die Flucht ergreife, will ich eilends bekennen, und Scheu soll mich nicht hindern: ich vermag nicht, ihr Mitbürger, das griechische Rom zu ertragen. Freilich, welchen Teil der Hefe bilden schon die Achäer?
Schon längst ist der syrische Orontes in den Tiber gemündet und hat mit sich geführt die Sprache, die Sitten, die schrägen Saiten samt dem Tibiabläser sowie die einheimischen Trommeln und die Mädchen, die man heißt, sich beim Circus feilzubieten: auf denn zu ihnen, die ihr eine ausländische Hure mit ihrer bunten Mitra schätzt!
Dein Bauer von einst, Bürger, zieht die schnellen Schleicher an und trägt an ölglänzendem Hals die Siegermedaillen.
Der eine verließ das hochgelegene Sikyon, der andere wieder Amydon, dieser Andros, jener Samos, ein weiterer Teil Tralles oder Alabanda, sie streben zum Esquilin oder zu dem nach der Weide benannten Hügel, um das Herzstück der großen Häuser zu werden und deren Herren.
Ihr Geist ist flink, die Dreistigkeit verwegen, die Rede stets parat und brausender als die des Isaeus. Gib an, für wen du ihn hältst, jede Art Mensch hat er mit sich zu uns gebracht: Grammatiker, Rhetor, Geometer, Maler, Masseur, Wahrsager, Seiltänzer, Arzt, Zauberer, auf alles versteht sich ein hungerndes Griechlein, in den Himmel wird er, befiehlst du es, sich erheben.«
Der Text enthält, neben römischen Lokalitäten wie dem Circus Maximus, wo die Wagenrennen stattfanden, dem Esquilin, einem der Sieben Hügel Roms, und dem Viminal, dem »nach der Weide benannten Hügel«, viele Fremdbegriffe: Achäer als Synonym für die Griechen, den Orontes (der antike Name des Flusses Nar el Asi), in Rom Inbegriff für Syrien; die Tibia, ein orientalisches Blasinstrument; die Mitra, ein orientalisches Kopfband; Isaeus für einen damals sehr bekannten Syrer, der in Rom als Stegreifredner auftrat.
Der syrische Orontes ist in den Tiber gemündet – eine berühmte Metapher: Der syrische Fluss hat sich nicht nur mit dem römischen Fluss vermischt, er hat ihn sogar verdrängt. Zielscheibe des Zorns sind die »Griechen« – unter diesem Sammelbegriff werden alle Menschen vereint, die aus dem Osten kommen. Nachdem Alexander der Große die griechische Welt bis zum Indus ausgedehnt hatte, war die griechische Kultur eine Weltkultur geworden. Griechen lebten in Anatolien, Ägypten, Syrien, bildeten mit der einheimischen Bevölkerung eine mal mehr, mal weniger homogene neue Kultur.
Wer kam nach Rom? Gelegenheitsarbeiter, Musiker, Prostituierte, Zauberer, Masseure – wenn man Umbricius Glauben schenken will, alles Tätigkeiten, die nach römischem Empfinden in der Skala geachteter Berufe nicht ganz weit oben rangierten. Aber warum sind sie gekommen? »Um das Herzstück der großen Häuser zu werden und deren Herren«. Sie biedern sich, so der Vorwurf, bei den Reichen und Mächtigen an, um, so der weitergehende Vorwurf, diese in Zukunft zu beerben. Die Einheimischen, so die Furcht des Umbricius, werden das Nachsehen haben.
Politiker waren für Fremde, Normalmenschen waren gegen Fremde. Geht diese einfache Gleichung auf, wenn man die Verhältnisse in der Antike betrachtet? Die beiden kontrastiven Fälle aus der römischen Kaiserzeit zeigen schon einmal den Rahmen dessen auf, was an Positionen möglich war. Sind die Menschen von Natur aus so gepolt, dass sie Fremde entweder als Gefahr oder als Bereicherung empfinden? Oder sind dafür die Verhältnisse, Umstände, Bedingungen, Situationen verantwortlich?
Die Antike, lautet ein viel zitierter Satz des Altertumsforschers Uvo Hölscher, ist das uns »nächste Fremde«. Bessere Voraussetzungen, etwas über das Verhältnis zu Fremden und zum Fremden zu erfahren, kann es eigentlich nicht geben. Natürlich meinte Hölscher damit nicht die zeitliche Nähe. In dieser Hinsicht hat die Antike wenig Chancen, Aktualität für sich beanspruchen zu dürfen. Gemeint war der Satz in kultureller und mentaler Hinsicht. Die Antike ist fremd genug, um unsere Denkgewohnheiten und unsere Verhaltensweisen kritisch zu überprüfen und gegebenenfalls auch infrage zu stellen. Und sie ist nahe genug, um für uns heute auch noch relevant zu sein. Was Umbricius über die Migranten aus Syrien sagte, ist nicht exklusiv antik, sondern gehört, wie man weiß, auch heute zum verbalen Repertoire derjenigen, die mit dem Zuzug von Fremden Probleme haben. Da ist die Antike uns sehr nahe, ebenso, wenn dafür geworben wird, Zuwanderung als Bereicherung zu empfinden. Fremd ist sie wiederum dann, wenn man die unterschiedlichen politischen Systeme in Betracht zieht oder auch die religiösen Verhältnisse. In der Antike wurde niemand wegen seiner religiösen Einstellung an den Pranger gestellt. Juden und später Christen wurden verfolgt, aber nicht wegen ihres Glaubens.
Zusammen mit den Griechen bilden die Römer das Rückgrat der antiken Geschichte. Griechen und Römer stehen deshalb auch im Mittelpunkt der Darstellung – wohl wissend, dass es auch ergiebig sein kann, die Rolle der Fremden etwa bei den Ägyptern, den Babyloniern, den Persern oder anderen antiken Kulturen unter die Lupe zu nehmen. Entscheidend für die Konzentration auf die Klassiker Griechenland und Rom ist die Quellenlage. Quellen mit Aussagen und Informationen über die Einstellung zu Fremden fließen sehr üppig, sowohl was schriftliche als auch bildliche Darstellungen angeht. Sie ermöglichen es, ein umfassendes und zugleich anschauliches Bild zum Thema »Fremde und Fremdsein in der Antike« zu zeichnen.