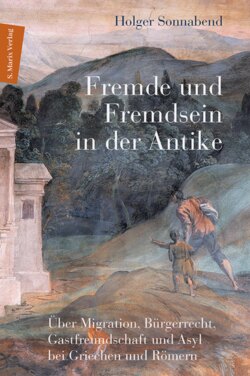Читать книгу Fremde und Fremdsein in der Antike - Holger Sonnabend - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеI.
GRIECHENLAND
1. Besuch bei Polyphem: Gastfreundschaft im antiken Griechenland
»Schon bei Homer heißt es …« lautet eine gern verwendete Formulierung, wenn es darauf ankommt, etwas als sehr alt und doch auch bereits wichtig zu etikettieren. Mit Recht: Denn mit Homer, dem ersten Dichter der Griechen, beginnt die Geschichte der europäischen Literatur. Über die gesamte Antike hinweg zählte er zu den populärsten, am meisten bewunderten und gelesenen Autoren. Alexander dem Großen diente er bei seinem Feldzug gegen die Perser und bei der Eroberung Asiens als Nachtlektüre. Bei den Römern war, jedenfalls in den Kreisen der Gebildeten, die Kenntnis der Werke Homers Pflicht.
In einem merkwürdigen Kontrast zu Homers Ruhm steht der Umstand, dass über ihn als Person so gut wie nichts bekannt ist. Der erste und größte Dichter der Griechen ist bis heute, trotz mancher, auch sehr gewagter, Versuche der Identifizierung, ein Phantom geblieben. In der Antike stritten gleich sieben Städte um das Privileg, Homers Geburtsort gewesen zu sein, wobei am Ende das griechische Smyrna, das heutige Izmir in der östlichen Türkei, am erfolgreichsten Argumente für sich sammelte. Als Troja vor einiger Zeit in akademischen Kreisen für heftige Streitigkeiten sorgte, konnte sogar die – freundlich formuliert – gewagte These Beachtung finden, Homer sei kein Grieche gewesen, sondern ein anatolischer Schreiber in assyrischen Diensten. Solche Spekulationen können angestellt werden, weil der bekannteste Autor der Antike zugleich der unbekannteste Autor der Antike ist.
Immerhin kann man seine beiden Hauptwerke, die Ilias und die Odyssee, relativ genau datieren (wobei es wiederum berechtigte Zweifel gibt, ob der unter dem Namen Homer bekannte Dichter wirklich als Autor beider Werke gelten kann): Sie stammen aus der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts v. Chr., genauer: aus der Zeit um 720 v. Chr. Sie gehen zurück auf ältere, mündlich tradierte Stoffe und wurden in der Zeit Homers erstmals schriftlich fixiert – gleich nachdem die Griechen von den Phöniziern deren Schrift übernommen hatten. Weil die beiden Epen die frühesten literarischen Quellen der griechischen Geschichte darstellen, sind sie auch die frühesten Schriftquellen für den Umgang der Griechen mit Fremden.
Der Trojanische Krieg
Die Ilias ist das Epos des Trojanischen Krieges. Dessen Ablauf kann kurz so zusammengefasst werden: Fürsten und Adlige aus ganz Griechenland schließen sich zu einer Militäraktion gegen die Stadt Troja zusammen – auch Ilion genannt, daher der Titel Ilias. Hintergrund ist der Raub der Helena, der Frau des Herrschers von Sparta, die der trojanische Königssohn Paris in seine Heimatstadt entführt hatte. Die Belagerung dauert zehn Jahre und endet mit der Eroberung und Plünderung Trojas durch die Griechen.
Die Ilias behandelt nicht den ganzen Krieg. Dank der mündlichen Überlieferung konnte dessen Ablauf beim Publikum als bekannt vorausgesetzt werden. Homer schildert die letzten 51 Tage, im Mittelpunkt steht der Zorn des besten griechischen Kriegers Achill, der, weil er sich von dem Oberbefehlshaber Agamemnon in seiner Ehre getroffen fühlt, in einen vorübergehenden Kampfstreik tritt, um am Ende wieder dominant und entscheidend in das kriegerische Geschehen einzugreifen. Der Trojanische Krieg, so wie ihn Homer schildert, ist keine historische Realität, sondern Fiktion. Den historischen Hintergrund bilden Raub- und Plünderungszüge, die mykenische Griechen um 1200 v. Chr. in den östlichen Mittelmeerraum unternahmen. Auch Ilion/Troja geriet auf diese Weise in das Visier jener kriegerischen, nach der Burg Mykene auf der nördlichen Peloponnes bezeichneten Kultur. Homer schildert die Ereignisse aus der Rückschau, fast fünf Jahrhunderte später, mit der Konsequenz, dass er auch Zustände und Verhältnisse seiner eigenen Zeit in die Vergangenheit projiziert. Manches, was er als mykenisch ausgibt, gehört in seine eigene Gegenwart. Der Trojanische Krieg spielt sich nicht nur, aber auch vor dem Hintergrund der Vorstellungswelt der homerischen Zeit ab.
Die Ankunft von Helena und Paris in Troja, dargestellt von links nach rechts: Paris, Helena, Aphrodite, Troilos und Priamos, Ausschnitt einer rotfigurigen Vasenmalerei, apulisch, um 430/330 v. Chr.
Diese Feststellung hilft, ein merkwürdiges Phänomen zu erklären. Denn der Krieg, den die Griechen bei Homer gegen die Trojaner führten, war nicht ein Krieg von Griechen gegen Fremde, sondern ein Krieg unter Griechen. Die Trojaner heißen Priamos, Hektor, Paris oder Andromache – alles griechische Namen. Historisch korrekt wären luwische Namen gewesen. Denn die im Nordwesten der heutigen Türkei angesiedelten Trojaner waren nicht, wie bei Homer beschrieben, gewissermaßen Griechen 2.0. Sie gehörten zur Völkerfamilie der in Anatolien und Nordsyrien beheimateten Luwier, die wiederum mit den Hethitern verwandt waren.
Warum also machte Homer aus den Trojanern Griechen? Weil es zu seiner Zeit, also im 8. Jahrhundert v. Chr., noch nicht die definitive Einteilung der Welt in Griechen auf der einen und Barbaren auf der anderen Seite gab. Und außerdem spielt sich die Handlung der Ilias in den höheren Kreisen der Könige, Fürsten und Aristokraten ab. Die Trojaner repräsentieren in dem Epos jene Werte und Ideale, die auch die vornehmen Griechen für sich in Anspruch nahmen. Die Ilias liefert ein Szenario an heldenhaften Menschen mit heldenhaften Tugenden. In dieses Schema passten Fremde aus Anatolien nicht hinein. Ihnen traute man nicht zu, so vornehm wie die Griechen zu sein, und so wurden aus Luwiern Griechen.
Mit Odysseus auf großer Fahrt
Auch das zweite, Homer zugeschriebene Werk, die Odyssee, spielt nicht wirklich in der Zeit, in die es vom Dichter versetzt worden ist. Die Odyssee ist die Geschichte des griechischen Trojakämpfers Odysseus, im Epos als listenreich apostrophiert, was der König von Ithaka vor Troja eindrucksvoll unter Beweis stellte, als ihm die Idee mit dem Trojanischen Pferd kam. Nach dem Ende des Krieges aber zog er sich den Zorn der Götter zu, die seine Heimreise blockierten und ihn zu zehn Jahre dauernden Irrfahrten auf dem Meer verurteilten, bei denen er viele teils haarsträubende Abenteuer zu bestehen hatte. Odysseus ist der literarische Prototyp des Fremden. Die Situationen, in die er während der Irrfahrten gerät, zeigen die realen Gefahren, Risiken, aber auch Chancen des Fremdseins in der Zeit Homers auf, als die Griechen sich aufmachten, die Küsten des Schwarzen Meeres und des Mittelmeeres zu erkunden, auf der Suche nach einer neuen Heimat. Diese sogenannte Große Kolonisation, die in der Mitte des 8. Jahrhunderts v. Chr. einsetzte, führte die Griechen bis weit in das westliche Mittelmeergebiet, bis nach Sizilien, Südfrankreich und Spanien. Anlass genug, jenes Seemannsgarn zu produzieren und zu verbreiten, das in der Odyssee zu den Abenteuern eines einzigen Protagonisten komprimiert wird.
In vielen Szenen bekommt Odysseus zu spüren, was es heißt, ein umherreisender Fremder zu sein – mit negativen, aber auch positiven Folgen. So kommt er in das Land der Phaiaken. Sie leben glücklich auf einer einsamen Insel. Odysseus strandet dort als Schiffbrüchiger. Ohne, dass er sich zu erkennen gibt, wird er vom König und dessen Tochter freundlich empfangen. Die Bevölkerung aber ist misstrauisch, sie meidet den Fremden. Die Erklärung liefert die Göttin Athene. Sie gibt Odysseus den Rat, sich von den Menschen fernzuhalten (7,31 f.): »Blicke niemanden an, noch frage jemanden. Denn sie dulden die Fremden nicht gern.«
Das Volk hat keine Erfahrung mit Fremden. Jeder, der nicht zur Gemeinschaft gehört, wird ausgegrenzt. Dahinter steht die für archaische Gesellschaften typische Haltung, im Fremden den Träger und Verbreiter unheimlicher, unbekannter Kräfte zu sehen. So kapselt man sich lieber ab. Der König und seine Tochter sind Repräsentanten einer schon etwas weiteren Entwicklungsstufe. Sie pflegen die Tugend der Gastfreundschaft, jedoch nicht aus humanitären Motiven heraus, sondern, weil sie die Vorstellung haben, durch freundliche Aufnahme diese negativen Kräfte des Fremden zu bändigen. Bezeichnend für dieses Stadium im Umgang mit Fremden ist die Tatsache, dass die Bezeichnung für »Fremder« und »Gast« identisch ist. Für beide verwenden die Griechen den Begriff xenos. Davon ist das heute allgegenwärtige Wort Xenophobie abgeleitet, meist unpräzise als »Fremdenhass« übersetzt. Genauer ist die Übersetzung »Fremdenangst«.
Die therapeutische Funktion der Gastfreundschaft bei der Überwindung von Ressentiments gegenüber Fremden illustriert eine weitere Episode in der Odyssee. Sie gibt zudem Einblick in die ritualisierte Form der Kontaktaufnahme zu dem Fremden. Als Odysseus endlich in die Heimat Ithaka zurückkehrt, verkleidet er sich zur Vorsicht als Bettler. Nicht einmal sein alter Sauhirt Eumaios erkennt ihn in dieser Aufmachung. Doch er bittet ihn in seine bescheidene Hütte, versorgt ihn mit Brot und Wein. Odysseus will sich bedanken, doch der Sauhirt will keinen Dank (14,56–58): »Es wäre ein Unrecht, einen Fremden zu missachten, auch wenn er noch geringer wäre als du: Sie alle kommen von Zeus.«
Ein neuer Gedanke: Der Fremde erhält eine Schutzgarantie, denn er steht unter göttlichem Schutz. Kein Geringerer als der oberste Gott Zeus persönlich ist jene Instanz, die diesen Schutz gewährleistet. In dieser Eigenschaft wird er von den Griechen Zeus Xenios genannt. Wer einen Fremden nicht freundlich aufnimmt, achtet den Gott nicht und begeht einen religiösen Frevel. Nicht umsonst wählt Homer für diese Szene einen Sauhirten und einen (verkleideten) Bettler. Die Pflicht zur gastlichen Aufnahme gilt auch gegenüber Menschen, die in der sozialen Skala nicht ganz oben rangieren. Und der Sauhirt Eumaios gehört zwar nicht zu den Repräsentanten der Oberschicht, hält sich aber selbstverständlich an die Regeln der Gastfreundschaft. Sie sind allgemein verbindlich.
Dass es auch ganz anders laufen kann, zeigt eine dritte Episode aus der Odyssee. Odysseus landet an einer Küste, die von den riesenhaften, grobschlächtigen Zyklopen bewohnt wird. Einer von diesen einäugigen, unzivilisierten Gestalten ist Polyphem, ein Sohn des Gottes Poseidon. Odysseus kommt mit seinen Begleitern in die Höhle des Zyklopen, und dieser verstößt nun eklatant gegen alle Regeln des göttlich garantierten Gastrechts. Der Riese weiß nicht, was sich gehört, er ist unfreundlich und sorgt nicht für seine Gäste. Als er grob fragt, mit wem er es eigentlich zu tun hat, erteilt ihm der erboste Odysseus eine verbale Lektion in Sachen Gastfreundschaft gegenüber Fremden (9,269–271): »Habe Respekt vor den Göttern! Wir Armen flehen dich um Hilfe an. Ist doch Zeus der Rächer für Schutzflehende und Fremde – Zeus Xenios, der die Fremden, die man achten muss, begleitet.«
Den Riesen beeindrucken diese Worte nicht. Im Gegenteil: Er verschließt die Höhle mit einem Felsen und frisst, bevor er sich zur Ruhe legt, zwei der Gefährten des Odysseus. Spätestens jetzt ist diesem klar, dass der Zyklop kein primärer Verfechter der hehren Prinzipien der Gastfreundschaft ist. Dank seines nie versiegenden Listenreichtums gelingt es ihm, sich und seine Gefährten aus der Gefahr zu befreien. Der einäugige Zyklop wird geblendet und bleibt in ohnmächtiger Wut zurück. Die Lehre, die von der Polyphem-Geschichte ausgehen soll: So ergeht es dem Ungeheuer (und wer so handelt, kann eigentlich nur ein Ungeheuer sein), weil es das heilige Gesetz der Gastfreundschaft verletzt.
Die Blendung des Polyphem durch Odysseus und seine Gefährten, schwarzfigurige Malerei auf einer Schale aus Kyrene, 6. Jh. v. Chr.
Ein anderes Gesetz gibt es in dieser frühen Phase der griechischen Geschichte noch nicht. Es gibt keine Rechtssätze, die den Umgang mit Fremden regeln. So muss der Gott Zeus einspringen, in dessen Obhut sich die Fremden begeben und dabei hoffen, dass die Menschen, denen sie in der Fremde begegnen, sich diesem göttlichen Gesetz ebenfalls verpflichtet fühlen.