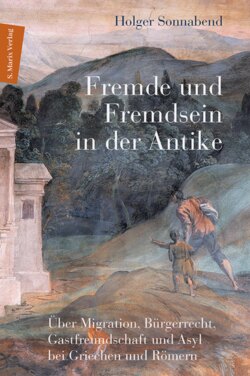Читать книгу Fremde und Fremdsein in der Antike - Holger Sonnabend - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7. Unter göttlichem Schutz: Asyl bei den Griechen
ОглавлениеSollen sich Fremde in der Fremde so verhalten wie die Einheimischen? Oder sollen sie in der Fremde ihre gewohnte Kultur und Mentalität beibehalten? Je nach Standpunkt spricht man von gelungener oder nicht gelungener Integration.
Alle, die die erste Option bevorzugen, sollten sich Alkibiades zum Vorbild nehmen. Über den Athener, der im 5. Jahrhundert v. Chr. zu den schillerndsten Figuren in der griechischen Politik gehörte, weiß sein antiker Biograf Plutarch zu berichten (Alkibiades 23):
»Es war, wie man sagt, eine seine vielen Begabungen und Talente, die Menschen dadurch zu gewinnen, dass er sich ihnen anzugleichen, ihren Neigungen und Lebensformen anzupassen vermochte, indem er sich schneller wandelte als ein Chamäleon … In Sparta war er ein großer Sportler, einfach und ernsthaft, in Ionien war er üppig, vergnügt und leichtfertig, in Thrakien ein heftiger Zecher und Reiter, und wenn er bei dem [persischen] Statthalter Tissaphernes war, stellte er durch seinen verschwenderischen Prunk den persischen Luxus in den Schatten.«
In Sparta ein Spartaner, in Ionien ein Ionier, in Thrakien ein Thraker, in Persien ein Perser – Alkibiades wusste, mit welchem Lebensstil er bei seinen jeweiligen Gastgebern Sympathien sammelte. Allerdings ging es ihm, wenn er sich den jeweiligen Verhältnissen anpasste, ganz und gar nicht darum, den fremden Kulturen Respekt zu bezeugen. So war er nicht gestrickt. Alkibiades interessierte nur Alkibiades. Er war der Typus von Politiker, der bei allem, was er tut, an sich und seinen Vorteil denkt. Die Anpassung an andere Sitten und Gebräuche war ein taktisches Mittel, um seine politischen Ziele zu erreichen. Dabei scheute er gelegentlich auch nicht davor zurück, das Gastrecht grob zu missbrauchen.
Plutarch berichtet von einer Affäre mit Timaia, der Ehefrau des Königs Agis von Sparta (Alkibiades 23). Als der königliche Gemahl einmal außer Landes war, stürzte sie sich in ein amouröses Abenteuer mit Alkibiades, mit der Folge, dass einige Monate später ein Kind zur Welt kam. Agis rechnete nach und kam zu dem Ergebnis, dass er selbst unmöglich der Vater sein konnte:
»Er verließ sich vor allem auf die Berechnung der Zeit. Bei einem Erdbeben sei er voller Schrecken aus der Schlafkammer von der Seite seiner Frau hinaus gerannt und sei dann zehn Monate nicht mehr mit ihr zusammen gewesen.«
Es gibt berechtigte Zweifel an der Echtheit der Geschichte. Wahrscheinlich war sie von Gegnern des Alkibiades in die Welt gesetzt worden. Sie zeigt aber zumindest, was man ihm alles zutraute.
Alkibiades lebte in Sparta als Asylant. Er hatte bei den Spartanern Zuflucht gesucht, weil er in seiner Heimatstadt Athen in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden war. Die Spartaner, eigentlich Konkurrenten der Athener, nahmen den prominenten Gast auf und gewährten ihm politisches Asyl.
»Aus Furcht vor seinen Feinden und sich ganz von seinem Vaterland lossagend, schickte er nach Sparta und bat, ihm Sicherheit und Vertrauen zu schenken. Er werde ihnen größere Dienste leisten und ihnen mehr hilfreich sein, als er ihnen als Feind früher geschadet habe.«
Das geschah nicht uneigennützig. Man befand sich im Krieg mit Athen und erhoffte sich von dem prominenten Gast nützliche Ratschläge, die die Spartaner auch prompt erhielten. Auch bei ihnen stellte Alkibiades seine Fähigkeit zur völligen Anpassung unter Beweis und präsentierte sich als vollkommener Spartaner:
»Er gab sich in seiner Lebensweise ganz lakonisch, so dass sie, wenn sie sahen, wie er sich die Haare lang wachsen ließ, kalt badete, dem groben Brot zusprach und die schwarze Suppe aß, nicht denken konnten, dass dieser Mann jemals einen Koch in seinem Haus beschäftigt, einen Parfümeur seines Anblicks gewürdigt oder einen milesischen Mantel an seinem Leib geduldet haben sollte.«
Die Grundidee des Asyls bei den Griechen bestand darin, einen verfolgten Fremden unter göttlichen Schutz zu stellen. Der Begriff ist von dem griechischen Verb sylao abgeleitet, was so viel bedeutet wie »etwas herausnehmen, etwas gewaltsam entfernen«. Die Vorsilbe a negiert den Vorgang, und so bedeutet die asylía den Schutz vor Raub von Freiheit und Eigentum. Asyl zu gewähren, war ebenso eine Verpflichtung wie die körperliche Unversehrtheit des Asylanten zu garantieren. Wer bei einem Gott Schutz suchte, hatte Anteil an der göttlichen Tabuzone. Folgerichtig waren bevorzugte Anlaufstationen für Asylanten Tempel oder der Temenos, wie man das heilige, meist weit dimensionierte Areal eines Tempels in seiner Gesamtheit bezeichnete. Die Aufenthaltsdauer war nicht begrenzt: Im Prinzip konnte ein Asylant »ewig«, bis an sein Lebensende, im Tempel bleiben. Solche Fälle sind allerdings nicht überliefert. Absoluter Rekord waren die 19 Jahre, die der spartanische König Pleistoanax in einem Zeus-Heiligtum im Lykeion-Gebirge in Arkadien zubrachte (Thuk. 5,16), wo er die Hälfte des Tempelareals bewohnte. Anlass war der Vorwurf gewesen, er habe sich, als er mit einem Heer der Spartaner nach Attika gezogen war, von dem athenischen Politiker Perikles bestechen lassen und den Feldzug abgebrochen. Die erbosten Spartaner verurteilten ihn zur Zahlung einer hohen Geldsumme, die der König nicht aufzubringen vermochte, und daraufhin habe er sich in die Obhut des Gottes Zeus begeben. Nach 19 Jahren kehrte er in die Heimat zurück, aufgrund eines göttlichen Spruches der Pythia in Delphi, der sicher nicht ohne tatkräftige Hilfe seiner Anhänger zustande gekommen war.
Das Asylrecht, das aufgrund allgemeiner Konvention befolgt wurde, war den Griechen heilig. Wer es verletzte, galt als Frevler. Um 640 v. Chr. versuchte der Athener Kylon, ein Olympiasieger, in seiner Heimatstadt eine Tyrannen-Herrschaft zu errichten. Er besetzte mit seinen Freunden die Akropolis, wurde dort aber von seinen Gegnern belagert (Thuk. 1,126):
»Sie rückten mit dem ganzen Aufgebot von den Dörfern her gegen sie an und legten sich um die Akropolis, um sie einzuschließen. Auf die Dauer war freilich den meisten diese Belagerung zu aufreibend. Sie zogen ab und gaben den neun Archonten Auftrag und Vollmacht, die Bewachung und alles nach bester Einsicht zu ordnen … Aber Kylon und seine Mitbelagerten waren wegen des Mangels an Nahrung und Wasser übel dran. Er selbst und sein Bruder konnten fliehen, die anderen in ihrer Bedrängnis, und da einige schon an Hunger starben, setzten sich als Schutzflehende an den Altar auf der Akropolis. Als die mit der Wache beauftragten Athener sie im Heiligtum hinsterben sahen, befahlen sie ihnen, aufzustehen, sie würden ihnen nichts tun. Dann führten sie sie ab und töteten sie.«
Plutarch (Solon 12) liefert weitere Details:
»Die Mitverschworenen Kylons, die am Altar der Göttin Athene Schutz gesucht hatten, wurden überredet, herabzukommen und sich vor Gericht zu stellen. Sie banden einen Faden an das Bild der Göttin und hielten sich daran fest. Als sie aber beim Herabsteigen am Heiligtum der Erhabenen Göttinnen vorüberkamen und der Faden von selbst riss, schritten Megakles und seine Mitarchonten zu ihrer Verhaftung, weil ihnen die Göttin ihren Schutz versage. Diejenigen, die sich außerhalb eines Heiligtums befanden, wurden gesteinigt, diejenigen, die sich zu Altären geflüchtet hatten, wurden abgeschlachtet. Nur diejenigen, die sich schutzflehend vor den Frauen der Archonten niedergeworfen hatten, wurden freigelassen.«
So groß war das Vertrauen in die schützende Wirkung des Göttlichen, dass die Asylanten sich an einem mit dem Bild der Göttin verbundenen Faden festhielten. Sie wurde auch von den Gegnern respektiert – bis der Faden riss. Keinerlei Erbarmen hatte man mit den Menschen, die nicht an einem Altar Zuflucht gesucht hatten. Gegen jedes religiöse Gesetz wurden aber auch diejenigen getötet, die sich an den Altären der Götter sicher fühlten.
Eine Überlebensgarantie hingegen waren die Frauen der Archonten, der obersten Zivilbeamten. Dass die Bedrohten den Kontakt zu ihnen suchten und sich vor ihnen niederwarfen, gehörte zu einem Ritual, das die Griechen unter dem Namen Hikesie kannten. Es regelte die Art und Weise, wie sich Menschen, die verfolgt wurden, verhalten sollten, wenn sie Schutz suchten. Dabei entwickelten die Griechen ein umfangreiches Repertoire an Gesten und symbolhaften Handlungen, das offenbar von allen verstanden wurde. Eine Favoritenstellung nahm der direkte Kontakt zu einem sakralen Gegenstand wie einem Altar oder einem Götterbild ein. Wichtig war dabei die sitzende Haltung, mit der die Schutzsuchenden Demut, Unterwerfung und Ernsthaftigkeit ihres Anliegens signalisierten. Als früheste Auskunftsinstanz für dieses Prozedere fungiert einmal mehr Homer. In der Odyssee nimmt der nach seinen unfreiwilligen Irrfahrten in die Heimat zurückgekehrte Odysseus grausame Rache an den Männern, die während seiner Abwesenheit seine Ehefrau Penelope belästigt hatten. Einer von ihnen namens Phemios überdachte rasch die lebensrettenden Möglichkeiten, die ihm in dieser bedrohlichen Situation zur Verfügung standen (Od. 22,331 ff.): 1. Er konnte aus dem Haus des tobenden Odysseus nach draußen fliehen und sich vor den Altar des Zeus setzen, »wo der Vater Laertes und Odysseus viel der Rinderlenden geopfert.« 2. Er konnte sich vor Odysseus auf den Boden werfen und flehend dessen Knie berühren. Phemios entschied sich für die zweite Option:
»Darum stellte er gleich die gewölbte Leier am Boden
Zwischen dem Mischkrug hin und dem silberbeschlagenen Sessel,
Und er kam und warf sich Odysseus zu Füßen und rührte
ihm die Knie und flehte und sprach die geflügelten Worte:
›Kniefällig fleh’ ich, Odysseus, verschone mich, habe Erbarmen!‹«
Seine Bemühungen waren von Erfolg gekrönt: Odysseus begnadigte den Flehenden – allerdings auch, weil der leidenschaftliche Sänger eine erfolgreiche Kostprobe seiner musikalischen Künste ablieferte.
Das Berühren von Menschen, von denen man sich Hilfe erhoffte, war bei dem Verfahren der Hikesie ein wichtiges Element. Hände und Knie waren dabei die populärsten Objekte. Manche Schutzflehende begnügten sich nicht damit, das Knie des Gegenübers lediglich zu berühren, sondern umschlangen es mit beiden Armen. In der Antike passierte wenig ohne Grund, schon gar nicht bei solchen ritualisierten Handlungen: Das Knie galt den Griechen als Sitz des Lebens oder der Lebenskraft und genoss gegenüber den anderen Körperteilen insofern eine privilegierte Position.
Göttliche Mahnung
»Diese töte nicht mit Eisen, noch tue Unrecht den Schutzflehenden, denn sie sind stets heilig und rein.«
Spruch des Zeus mit dem Beinamen Hikesios (»Beschützer der Schutzflehenden«) in Dodona, adressiert an die Athener mit der Aufforderung, sich nicht an spartanischen Asylanten zu vergehen (Paus. 7,25,1)
Aber hatte jeder Asylbewerber oder jeder Schutzflehende Anspruch auf Rettung und Hilfe? Also auch Verbrecher und Kriminelle? In dieser Frage gab es unterschiedliche Positionen. Es gibt keine Unterschiede, sagten die Befürworter. Der Schutz der Götter ist für alle da. Nein, antworteten die Kritiker. Wer getötet, gemordet, gestohlen hat, hat seinen Anspruch auf Schutz verwirkt. Eine vermittelnde Position empfahl: Nur wer aus Versehen einen anderen Menschen getötet hat, darf um Asyl bitten. Und was ist mit den Sklaven? Sklaven waren rechtlos, keine Menschen, sondern Sachen. Was war, wenn ein Sklave seinem Herrn entfloh und in einem Tempel um Asyl bat? Die Sklaverei war in den antiken Gesellschaften fest verwurzelt. Ein entlaufener Sklave fand keine Fürsprecher. Er durfte sich zwar in die Obhut eines Gottes begeben, doch damit war nicht etwa automatisch das Recht auf Freiheit verbunden.
Das Asylrecht war ein antikes Grundrecht – jedoch kein staatlich garantiertes Recht. Erst in hellenistischer Zeit, ab dem Ende des 4. Jahrhunderts v. Chr., wurde die Gewährung des Asyls zum vertraglichen Gegenstand zwischen einzelnen Staaten. Davor war das Asyl ein religiöses und kein politisches Recht. Wer gegen das göttlich geschützte, heilige Asylrecht verstieß, musste daher auch keine politischen oder rechtlichen Sanktionen befürchten. Es gab keine Strafe für Menschen, die Hilfesuchenden Hilfe verweigerten oder gar gewaltsam gegen sie vorgingen. Aber zum Glück gab es da noch die Götter. Ihnen vertrauten sich die Schutzsuchenden an, und sie waren es, die jene sanktionierten, die es wagten, das heilige Asylrecht zu verletzen. Das bekamen die Spartaner im Jahre 464 v. Chr. zu spüren. Der antike Historiker Diodor (11,63,1–4) berichtet:
Tempel von Segesta auf Sizilien, 2015
»In diesem Jahr erfasste die Spartaner eine große und außergewöhnliche Katastrophe. Gewaltige Erdbeben ereigneten sich in der Stadt. Häuser fielen komplett zusammen, und mehr als 20 000 Spartaner wurden getötet. Da die Stadt über einen langen Zeitraum hinweg erschüttert wurde und viele Häuser einstürzten, wurden viele Menschen von den einstürzenden Mauern begraben und erschlagen, und eine große Menge des Inventars der Häuser wurde vernichtet.«
Naturkatastrophen waren nach der Meinung der meisten antiken Menschen keine geologischen oder physikalischen Vorgänge. Sie waren ein Zeichen oder eine Strafe der Götter. In Sparta im Jahr 464 v. Chr. war der Fall klar: Die Götter hatten die Spartaner bestraft, weil sie einen religiösen Frevel begangen und das Asylrecht missachtet hatten (Thuk. 1,121,8):
»Die Spartaner hatten einst schutzflehende Heloten aus dem Poseidon-Tempel am Tainaron vertrieben und getötet. Das halten sie selbst für die Ursache des großen Erdbebens in Sparta.«
Tainaron, das Kap an der Südspitze der Peloponnes, war Schauplatz eines grausamen Verbrechens gewesen. Heloten, die von den Spartanern unterdrückte und ausgebeutete Vorbevölkerung der von ihnen in Besitz genommenen Territorien, hatten im Tempel des Gottes Poseidon Asyl gefunden – ein Asyl, das von den Spartanern nicht respektiert worden war, woraufhin ihnen Poseidon, der im Hauptberuf nicht Meeresgott, sondern Erdbebengott war, ein schreckliches Erdbeben geschickt hatte.
Ähnlich erging es 91 Jahre später den Bewohnern von Helike. Die Stadt am Golf von Korinth versank in einer Winternacht des Jahres 373 v. Chr. im Meer, als Ergebnis eines kombinierten See- und Erdbebens. Auch hier waren sich die meinungslenkenden Foren der Antike einig: Die Heliker waren bestraft worden, weil sie einen Frevel begangen hatten. Wieder war Poseidon darin verwickelt gewesen. Die Heliker hatten Gesandte aus dem Tempel vertrieben, in den diese aufgrund der Nachstellungen vor jenen geflohen waren. Damit hatten sie gegen das heilige Gesetz des Asyls verstoßen und ihr Leben verwirkt.