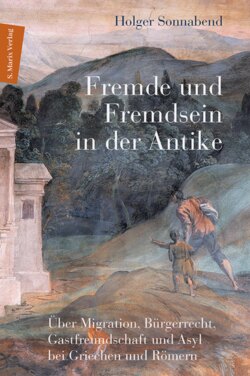Читать книгу Fremde und Fremdsein in der Antike - Holger Sonnabend - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Fremde willkommen? Griechen unterwegs
ОглавлениеHomers Odysseus repräsentiert mit seinen fiktiven (Irr-)Fahrten über das Meer die historischen Fahrten, die 200 Jahre lang, zwischen 750 und 550 v. Chr., Griechen aus dem Mutterland zu fremden Gestaden führten. Man hat sich angewöhnt, diese massenhafte Migration als »Große Griechische Kolonisation« zu bezeichnen. Dieser Begriff ist insofern missverständlich, als die Wanderungsbewegungen der Griechen nichts mit Kolonialismus im modernen Sinn zu tun hatten. Die Griechen kamen nicht, um zu erobern und zu unterwerfen, sondern um eine neue Heimat zu finden.
Die Gründe, aus denen so viele Griechen die gewohnte Umgebung verließen und die Beschwernisse einer Reise, die häufig ins Ungewisse führte, auf sich nahmen, waren vielfältig. Eine Zunahme der Geburten und damit verbundene Ernährungsengpässe sowie Landnot mögen in einzelnen Fällen eine Rolle gespielt haben, waren als Motive zur Auswanderung jedoch nicht so gravierend, wie man früher angenommen hat. Wichtiger waren wirtschaftliche und handelspolitische Gründe. Die Migranten erhofften sich in der Fremde eine Verbesserung ihrer Lebenssituation und spekulierten auch auf die reichen Märkte im Mittelmeerraum und im Schwarzmeergebiet. Unter ihnen befanden sich auch reine Abenteurer, die, auf welche Weise auch immer, ihr Glück in der Fremde suchten.
Schließlich verließen viele ihre Heimat wegen politischer und sozialer Unruhen. Griechenland bestand damals aus vielen, Poleis genannten Stadtstaaten. Die Polis war die zentrale politische Organisationseinheit – ein Personalverband mit einem urbanen Zentrum und einem agrarischen Umland, politisch autonom und frei. Konflikte innerhalb des regierenden Adels oder zwischen Armen und Reichen führten zu Destabilisierung der Verhältnisse. Die Sieger blieben, die Verlierer gingen. Sie schlossen sich wie diejenigen, die wirtschaftliche Motive hatten, einer der vielen Auswanderergruppen an, die sich in dieser Zeit auf den Weg machten. Um einen zuvor bestimmten, aus der Adelsschicht stammenden Anführer scharten sich meist junge Männer, 100 bis 200 an der Zahl, die gemeinsam ein oder mehrere Schiffe charterten und in See stachen.
Die Reise gestaltete sich nicht als eine reine Fahrt ins Blaue. Die Kapitäne wussten, wohin sie wollten. Dafür sorgte die zentrale Auskunftsinstanz in Delphi, wo eine Pythia genannte Priesterin als orakelndes Sprachrohr des Gottes Apollon den Migranten Hinweise auf geeignete Zielorte gab. Wie üblich, geschah dies in einer eher nebulösen, zweideutigen Formulierung, die im Falle eines Scheiterns des Unternehmens dem Orakel die Möglichkeit zu der Versicherung gab, die Pythia sei falsch verstanden worden.
Das göttliche Votum war nicht nur deswegen wichtig, weil sich die Auswanderer den Segen für ihre Unternehmungen verschaffen wollten. Es war zugleich ein Argument in den Zielgebieten. Denn die Plätze, die die Neuankömmlinge für ihre neue Heimat aussuchten, waren nicht immer frei. Dort, wo es gute Häfen, fruchtbare Böden und eine ausreichende Wasserversorgung gab, waren sie häufig schon besetzt. Die Einheimischen waren daher nicht nur begeistert über den Zuzug von Fremden, sondern sahen in ihnen auch Konkurrenten. Um Widerstände zu beseitigen, konnte der Verweis auf göttlichen Ratschluss hilfreich sein. Und dazu verfügte man über die Waffe des Mythos. Mit ihm konnten die Griechen alles erklären. Eine Allzweckwaffe war der umtriebige Heros Herakles, der viel unterwegs gewesen war und von dem die Griechen behaupteten, er habe das Land, um das es ging, schon früher einmal in seinen Besitz genommen, und daher gehöre es ohnehin den Griechen.
Nicht immer ließen sich die Indigenen von solchen Argumenten überzeugen. So kam es im Rahmen der griechischen Kolonisation häufig zu Auseinandersetzungen, die in der Mehrzahl damit endeten, dass die Zuwanderer die Einheimischen unterwarfen, versklavten oder vertrieben. Das war zum Beispiel auf Sizilien der Fall, das zu den bevorzugten Siedlungsgebieten der Griechen gehörte. Bei der Gründung der Stadt Syrakus an der Ostküste der Insel wurden die ansässigen Sikuler besiegt und hatten als Heloten Frondienste für die neuen Herren zu leisten. Ähnlich verhielt es sich auf der Insel Pithekoussai, dem heutigen Ischia. Besonders perfide war der Umgang der fremden Kolonisten mit den ihnen fremden Bewohnern in Süditalien. Sie kamen aus der griechischen Landschaft Lokris und nahmen ein Territorium ins Visier, das sich im Eigentum der Sikuler befand. Hier weiß der gewöhnlich gut unterrichtete griechische Historiker Polybios (12,6) Erstaunliches zu berichten – journalistisch korrekt in indirekter Rede, weil er die Information aus zweiter Hand erhalten hat:
»Damals, als sie bei ihrer Ankunft in Italien die Sikuler im Besitz des Landes fanden, das sie jetzt selbst bewohnen, wären jene so in Schrecken geraten, dass sie sie in ihrer Angst aufnahmen. Sie hätten nun mit den Sikulern ein Übereinkommen geschlossen, mit ihnen Freundschaft zu halten und gemeinsam mit ihnen das Land zu bewohnen, solange ihr Fuß die Erde beträte und sie den Kopf auf den Schultern trügen. Bei der Ableistung des Eides aber hätten die Lokrer auf die Sohlen ihrer Schuhe Erde gelegt und unter dem Gewand auf ihrer Schulter Knoblauchköpfe versteckt und so den Eid geleistet. Dann hätten sie die Erde aus den Schuhen entfernt, die Knoblauchköpfe weggeworfen und nicht lange danach, als sich die Gelegenheit bot, die Sikuler aus dem Land vertrieben.«
Geschickter stellten es die Bewohner von Libyen an. Kolonisten aus Thera (Santorin) suchten nach einem geeigneten Platz, wo sie sich niederlassen konnten. Nach einigen Schwierigkeiten gründeten sie die Stadt Kyrene. Im Zusammenhang mit der Gründungsgeschichte dieser Stadt berichten antike Quellen davon, dass die Fremden für ihre Stadt zunächst einen anderen Platz gewählt hatten. Diesen Ort bewohnten sie, wie es bei dem griechischen Historiker Herodot (4,158) heißt, sechs Jahre:
»Im siebten Jahr aber boten Libyer ihnen an, sie an eine bessere Stelle zu führen, und gewannen sie dafür, fortzuziehen. Die Libyer ließen sie also von dort aufbrechen und führten sie nach Westen. Am schönsten Platz, damit ihn die Hellenen nicht zu sehen bekämen bei ihrem Zug, führten sie sie nachts vorbei, nachdem sie vorher die Wegstunden berechnet hatten. Dieser Platz hieß Irasa. Und sie führten sie an eine Quelle, von der es hieß, sie gehöre Apollon, und sprachen: ›Männer aus Hellas, hier ist gut sein, hier nehmt eure Wohnung. Denn hier hat der Himmel Löcher.‹«
Die Griechen nahmen das Angebot dankend an, nicht ahnend, dass sie nur den zweitbesten Platz erhalten hatten. Und die Libyer freuten sich, dass die Fremden nun keine weiteren Begehrlichkeiten an Land entwickeln würden. Die Glaubwürdigkeit dieser Erzählung ist natürlich nicht über jeden Zweifel erhaben – im Gegenteil. Aber sie zeigt immerhin, dass eine solche Konstellation im Umgang mit Fremden, die man nicht eingeladen hatte zu kommen, prinzipiell denkbar war. Andere Beispiele zeigen, dass sich zwischen den Bewohnern und den Zugezogenen Prozesse abspielten, die man mit dem modernen Begriff der »Akkulturation« bezeichnen kann, worunter man im Allgemeinen die Angleichung und Anpassung unterschiedlicher Kulturen versteht. Dabei kam es nicht zu Auseinandersetzungen, Versklavung oder Vertreibung. Vielmehr lebten die Einheimischen mit den fremden Siedlern nicht völlig harmonisch, aber doch konfliktfrei zusammen. Wie es aussieht, haben die Einheimischen dabei mehr von den Fremden übernommen als umgekehrt die Fremden Impulse von den Indigenen aufnahmen. So übernahm die Urbevölkerung die religiösen Praktiken der Zugezogenen, indem sie deren Götter verehrten. Beigaben in den Gräbern beweisen, dass viele auch den griechischen Lebensstil adaptierten oder wenigstens imitierten. Man benutzte griechische Salben, um in Sachen Kosmetik mit den Fremden mithalten zu können; übte sich im Wurf von Diskus und Speer, um wie die Griechen Sport zu treiben; trank den Wein aus griechischen Mischkrügen, wie die Griechen bei den Trinkgelagen, die diese vornehmer als Symposien zu bezeichnen pflegten.
Die mit Abstand schönste aller Geschichten wurde in Marseille geschrieben. Die heutige französische Millionenstadt an der Küste des Mittelmeeres ist, wie viele andere Städte in Frankreich auch, eine Gründung der Griechen. Es war um 600 v. Chr., schon eher gegen Ende der Großen Kolonisation, als Griechen aus der Stadt Phokaia hier landeten und eine Siedlung mit dem Namen Massalia anlegten. Phokaia gehörte zu den Griechenstädten, die schon um 1000 v. Chr. entstanden waren, als ionische Griechen die Küsten Kleinasiens besiedelt hatten. Ihre ursprüngliche Heimat lag im mittleren Griechenland. Was die Seefahrer aus Phokaia anlockte, waren der Reichtum an Rohstoffen, insbesondere Zinn, und die Aussicht auf lukrativen Handel mit den keltisch-ligurischen Bewohnern. Auf der Suche nach einem geeigneten Handelsstützpunkt fiel ihnen das Gebiet um die Mündung der Rhone ins Auge – mit einem guten, durch eine Felsbucht geschützten Naturhafen. Es gab jedoch eine kleine Schwierigkeit: Der so perfekte Ort war schon besetzt, er gehörte zum Territorium eines einheimischen keltischen Fürsten, der über das Volk der Segobrigier herrschte. Wie würden die Platzhirsche auf die Ankunft der Fremden reagieren?
»Anführer der Flotte waren Simos und Protis. Und so wandten sie sich also an den König der Segobrigier mit Namen Nannus, in dessen Gebiet sie eine Stadt zu gründen beabsichtigten, und baten ihn um Freundschaft. Zufällig war er an diesem Tag gerade damit beschäftigt, die Hochzeit seiner Tochter Gyptis auszurichten, die er nach der Stammessitte den beim Gastmahl auserwählten Schwiegersohn auf der Stelle zur Frau zu geben vorhatte. Als nun alle Kandidaten zur Hochzeit geladen waren, wurden auch die Griechen als Gastfreunde zur Tafel gebeten. Als nun die junge Frau in den Saal geführt und vom Vater aufgefordert wurde, demjenigen, den sie zum Ehemann wähle, das Wasser zu reichen, da hatte sie für alle anderen keinen Blick mehr, sondern wandte sich allein den Griechen zu und reichte Protis das Wasser. So wurde er aus einem fremden Gast sofort zu einem Schwiegersohn, und er bekam von seinem Schwiegervater den Platz für die zu gründende Stadt. So wurde also Massalia gegründet, nahe der Mündung der Rhone in einer tief ins Land geschnittenen Bucht. Die Ligurer aber waren neidisch auf das Geschehen in der Stadt und plagten die Griechen durch unablässige Kriege. Diese jedoch arbeiteten sich durch erfolgreiche Abwehr aller Gefahren zu einem solchen Glanz empor, dass sie nach ihrem Sieg über die Feinde in den dabei eingenommenen Gebieten viele Kolonien anlegten.«
So beschreibt eine spätere Quelle (Iustin 43) die Vorgänge bei der Gründung von Marseille. Gerne würde man glauben, dass sich alles ganz genauso abgespielt hat, zumindest, was die so romantisch zustande gekommene Hochzeit von Gyptis und Protis betrifft. Indes ist es die undankbare Aufgabe einer tendenziell eher nüchternen historischen Analyse, die Fiktion von der Realität zu trennen. Und da ist festzuhalten, dass die Erzählung in dieser Form legendär ist. Es handelt sich um eine typische retrospektive Gründungsgeschichte, reich und fantasievoll ausgeschmückt, geeignet, im Wettbewerb der besten Gründungsgeschichten gut abzuschneiden. Sie ist jedoch, wie alle Mythen und Legenden, nicht völlig aus der Luft gegriffen. Sie beruht auf dem historischen Faktum, dass die Gründung von Marseille das Ergebnis des Zusammenwirkens von Einheimischen und Fremden gewesen ist. Über die Gründe für die Harmonie kann man indes nur spekulieren. Wahrscheinlich versprachen sich beide Seiten wirtschaftliche Vorteile. Die Griechen konnten ungestört ihre Handelsaktivitäten betreiben, und die Kelten wurden mit griechischen Waren beliefert.
Massalia entwickelte sich in den folgenden Jahrhunderten zu einer blühenden, prosperierenden Stadt. Sie dehnte ihr Territorium nach Osten aus, auf Kosten der dortigen ligurischen Stämme. Wenn die Quelle behauptet, die Ligurer seien auf die Griechen neidisch gewesen und hätten deswegen mit ihnen oft Krieg geführt, so ist dies die griechische Lesart. In Wirklichkeit dürften sie sich gegen die Bestrebungen gewehrt haben, von den Griechen okkupiert zu werden. Jedenfalls gründeten die Griechen von Massalia aus weitere bekannte Städte wie Nikaia (das heutige Nizza) und Antipolis (das heutige Antibes).
Massalia als Bollwerk in einer barbarischen Umgebung
»Massalia wird umwohnt von übermütigen Völkern und derweil der barbarische Nachbar mit grausigen Riten schreckt, hält fest die Siedler-Stadt der Phokäer inmitten waffenstarrender Völker an Sitten und Göttern der Heimat.«
Silius Italicus, Punica 15, 169–172
Die Gründungslegende von Marseille bringt auch Licht in das Dunkel eines Problems, das in den Forschungen zur griechischen Kolonisation eine prominente Rolle spielt. Die Kolonisten der ersten Stunde waren Männer, meist junge Männer. Es ist unmittelbar einsichtig, dass die von ihnen gegründeten Städte nur dann eine Zukunftsperspektive hatten, wenn zu der Bevölkerung auch Frauen gehörten. An Bord waren Frauen jedenfalls nicht, wenn die Schiffe auf der Suche nach Land unterwegs waren. Holten die Siedler die Frauen aus Griechenland nach, wenn sie sich für einen Platz entschieden hatten? Oder heirateten sie einheimische Frauen? Im Fall von Massalia herrscht wünschenswerte Klarheit: Gyptis und Protis stehen für die Praxis, dass die Griechen Ehen mit einheimischen Frauen schlossen, was der Integration ohne Frage sehr förderlich war. Aber so war es wohl nicht immer. Im Zusammenhang mit der Gründung von Milet in Kleinasien durch ionische Griechen schildert es Herodot (1,146) als ungewöhnlich, dass die Siedler einheimische Frauen heirateten und hat dabei auch eine merkwürdige Geschichte parat:
»Die aber vom Prytaneion in Athen auszogen und meinten, sie seien die vornehmsten unter den Ioniern, die brachten keine Frauen mit in ihre neue Siedlung, sondern nahmen karische Frauen, deren Eltern sie zuvor erschlagen hatten. Und um dieses Totschlags willen machten es sich die Frauen zum Gesetz und setzten einen Schwur darauf und gaben ihn weiter an ihre Töchter, niemals mit ihren Männern zu essen noch ihren Mann beim Namen zu rufen, weil sie ihre Väter und Männer und Kinder umgebracht und nach solcher Tat sie selber zu ihren Frauen gemacht hatten.«
Dass die Zugewanderten die Eltern ihrer künftigen Frauen erschlugen, macht nur Sinn, wenn sich diese geweigert hatten, ihnen ihre Töchter zur Frau zu geben. Aber, so bleibt zu hoffen, vielleicht handelt es sich auch bloß um eine Legende, die erfunden wurde, um den so stolzen und selbstbewussten Athenern zu schaden.