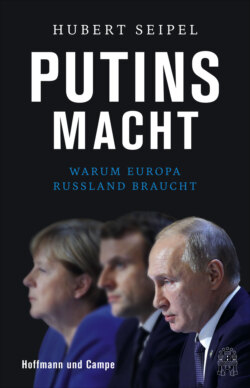Читать книгу Putins Macht - Hubert Seipel - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wer Handel treibt, schießt nicht
ОглавлениеDer Streit mit den USA um deutsche Wirtschaftsbeziehungen mit Russland hat eine lange Tradition. Der einstige Botschafter in Deutschland Richard Burt operierte in den achtziger Jahren in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn ähnlich rigoros wie später sein Nachfolger Richard Allen Grenell in Berlin. Im Auftrag des Weißen Hauses versuchte auch er über Jahre die deutsche Bundesregierung unter Druck zu setzen. Der Anlass war der gleiche wie bei Nord Stream 2. Richard Burt setzte im Auftrag seines Präsidenten Ronald Reagan alles daran, um einen Mega-Gasdeal zwischen der damaligen Sowjetunion und Westdeutschland zu torpedieren.
November 1982. Die Botschaft der wöchentlichen Radio-Ansprache, die Ronald Reagan an diesem Sonntag hielt, klang zunächst fast wie eine Siegesmeldung. Doch je länger der Präsident sprach, desto mehr entpuppte sich die Rede als der Versuch, eine politische Niederlage schönzureden. Die Vereinigten Staaten hätten unter seiner Regentschaft aufgerüstet, um der Sowjetunion Paroli zu bieten und so die Aussichten auf Frieden zu stärken. Nur der Westen, vornehmlich Westeuropa, habe sich nicht daran gehalten und mit dem Reich des Bösen einen schwungvollen Handel getrieben. Er habe zwar die Europäer und auch Japan wiederholt aufgefordert, das sein zu lassen, und Sanktionen gegen die Verbündeten verhängt, allerdings ohne Erfolg. Es sei kein Geheimnis, »dass unsere Verbündeten damit nicht einverstanden waren«.
Aber nun, so Reagan, habe man sich auf eine gemeinsame Linie geeinigt. Das neue Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten sei ein Sieg für alle. Die wirtschaftlichen Verabredungen mit den Alliierten ergänzten die militärischen Anstrengungen Washingtons, die Sowjetunion in Schach zu halten. Deswegen habe er die Sanktionen gegen die Verbündeten aufgehoben – »there is no need for this sanctions and I am lifting them today«.[51]
Was der amerikanische Präsident als Kompromiss verkaufte, war die herbe Niederlage in einem grundsätzlichen Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Westeuropa. Die USA wollten, wie bei Nord Stream 2 heute, mit allen Mitteln verhindern, dass Westeuropa, allen voran Deutschland, mit der Sowjetunion größere Geschäftsbeziehungen einging, und jetzt hatte Washington während des jahrelangen Kampfes eine Niederlage eingesteckt.
Der Hintergrund: Anfang der achtziger Jahre hatte die Sowjetunion mit dem Bau einer 5000 Kilometer langen Stahlrohrleitung begonnen, durch die Gas von Nowy Urengoi im fernen Sibirien nach Westeuropa fließen sollte. Ein Projekt von dieser Größenordnung, das war Regierungschef Leonid Breschnew und dem Politbüro klar, konnte logistisch und technisch nur mit Hilfe des Westens umgesetzt werden. Über Jahre verhandelten deutsche Firmen wie Mannesmann, AEG oder die Salzgitter AG mit dem Kreml. Die Deutsche Bank managte ein internationales Finanzkonsortium für die notwendigen Kredite des Deals. Aber auch Großbritannien, Italien und Frankreich waren mit von der Partie.
Zwei Tage, bevor der sowjetische Partei- und Regierungschef am 22. November 1981 zum offiziellen Staatsbesuch Bonner Boden betrat, unterzeichneten in Essen die Außenhandelsexperten das größte Ost-West-Industrieabkommen aller Zeiten: den Bau von Rohrleitungen und Kompressor-Stationen im Wert von 20 Milliarden Mark und – von 1984 bis 2009 – die Lieferung von jährlich 40 Milliarden Kubikmeter Sibirien-Erdgas im Wert von 16 Milliarden D-Mark – 400 Milliarden D-Mark in 25 Jahren.
Allein die Ruhrgas AG in Essen unterschrieb einen Vertrag für die Lieferung von rund 10 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Die Gegenlieferungen zum Bau der Pipeline mit Stahlrohren übernahmen Mannesmann und der französische Konzern Creusot-Loire als Generalunternehmer. Zahlreiche Firmen aus Europa und den USA beteiligten sich als Zulieferer.[52]
Der Deal versetzt nicht nur US-Präsident Reagan in Washington in Alarmbereitschaft. Für das Weiße Haus bedeutet die wirtschaftliche Schwäche der Sowjetunion eine Möglichkeit, den militärischen und ideologischen Gegner in die Knie zu zwingen. Die Gasleitung, schreibt der amerikanische Geheimdienst CIA in einem umfangreichen Memo für den Präsidenten, sei wirtschaftlich »für Moskau überlebenswichtig«. Außerdem benutze Moskau die Gasleitung, um in Europa »Verwirrung zu stiften« und einen Keil zwischen die Alliierten und Amerika zu treiben.[53]
Der Kongress in Washington reagierte damals kaum anders als in der aktuellen Debatte über Nord Stream 2. Er sah in dem Gasdeal lediglich eine Entwicklungshilfe für den politischen Gegner. James L. Nelligan, ein Abgeordneter aus Pennsylvania, bemühte bei der öffentlichen Anhörung sogar Lenin, um zu belegen, dass der Feind noch immer im Osten steht. »Der Westen wird uns die Ausrüstung und die Technologie liefern, die uns fehlt«, so Nelligans Warnung mit den Worten des russischen Revolutionärs. »Der Westen wird immer an seinem eigenen Selbstmord arbeiten.« Das Gasprojekt von Lenins Nachfolgern sei genau diese Falle. In einem Eilbrief an Reagan forderten Abgeordnete harte Maßnahmen. Das Projekt gefährde die westliche Sicherheit.[54]
Weder die deutschen noch die französischen oder italienischen Unternehmen ließen sich von den Drohungen der Amerikaner abschrecken. Daraufhin verhängte Reagan Sanktionen gegen deutsche und andere europäische Firmen, die beim Bau der Gasleitung mitwirkten – ohne Konsultationen mit den Verbündeten. Der deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt, obwohl überzeugter Transatlantiker, hatte Reagan zuvor mehrmals erklärt, dass Deutschland Sanktionen nicht hinnehmen werde. »Wer Handel miteinander treibt, schießt nicht aufeinander«, lautete Schmidts Devise. Der andere Grund für den deutschen Widerstand: Die Bundesrepublik steckt in einer Rezession. Der Deal würde der deutschen Wirtschaft Tausende von Arbeitsplätzen bescheren.[55]
Richard Burt, der zur gleichen Zeit in Bonn und anderen europäischen Hauptstädten im Auftrag des US-Außenministeriums dabei ist, für die amerikanische Position zu werben, holt sich eine Abfuhr nach der anderen. Auch der Präsident Frankreichs, der Sozialist Mitterrand, und Margaret Thatcher, Großbritanniens konservative Regierungschefin, rücken von dem Projekt nicht ab. Die Sanktionen, so ist man sich einig, verletzten internationales Recht. Die Amerikaner versuchten, mit amerikanischem Recht über europäische Verträge zu bestimmen.
Auf seiner Amerikareise liest Helmut Schmidt 1982 im Imperial Ballroom des Hyatt Hotels in Houston vor achthundert texanischen Geschäftsleuten und Angehörigen der Reagan-Administration die Leviten. Die Vorwürfe reichen von Ignoranz bis zu mangelnder Kompetenz, von Überheblichkeit bis zur Komplexbeladenheit.
Er habe »in den allerletzten Jahren« ein geringer werdendes »Interesse der Führungselite« der USA an den Problemen der Europäer festgestellt. »Klischeevorstellungen«, die Deutschen seien selbstsüchtig auf Wohlstand statt auf die Stärkung der westlichen Verteidigung bedacht, belasteten die Beziehungen. Und überhaupt seien die Kritiker »meist unzulänglich informiert«. Ein paar Tage später bei einem Historiker-Treffen in Berkeley legt Schmidt nach. Die Amerikaner müssten lernen, die Russen »in unsere gemeinsame Welt einzubeziehen«. Der deutsche Regierungschef: »Wenn man sich gegenseitig für Verbrecher hält, ist es sehr schwer, miteinander Verträge zu schließen.«[56]
Es war Schmidts Vorgänger im Bundeskanzleramt Willy Brandt, der Jahre zuvor mit seinem hartnäckigen Ansatz einer neuen Ostpolitik unter der Überschrift »Wandel durch Annäherung« das neue politische Klima für mehr wirtschaftliche Kooperation bereitet hatte. Brandt und seine Mitstreiter wussten, wie schwierig der Versuch sein würde. Die USA hatten bislang erfolgreich verhindert, dass Deutschland mit der Sowjetunion stärker ins Geschäft kam. Als die USA 1963 bei Konrad Adenauer ein Röhren-Embargo gegen die Sowjetunion durchsetzten, mussten die betroffenen deutschen Firmen später zusehen, wie ihre britischen Kollegen das Geschäft machten.
Nach Brandts Amtsantritt 1969 lief es anders. Noch im selben Jahr vereinbarte Moskau mit der Essener Ruhrgas AG die Lieferung von drei Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr für die nächsten zwei Jahrzehnte. Dafür verpflichteten sich die Düsseldorfer Stahlkonzerne Mannesmann und Thyssen, Röhren im Wert von 1,2 Milliarden Mark zu liefern, um 2000 Kilometer Pipeline zu bauen. Im Oktober 1973 erreichte das erste sowjetische Gas per Pipeline die Bundesrepublik. Die Leitung zwischen Ost und West verband zwei einstige Todfeinde und förderte den Handel in Zeiten des Kalten Krieges. Beide Seiten profitierten: Deutschland brauchte Energie und wollte sich vom Nahen Osten unabhängiger machen. Russisches Gas und Öl waren billig, und die Sowjetunion brauchte Einnahmen und technisches Know-how. Die Vereinbarung war die Blaupause für das gigantische Geschäft ein paar Jahre später.