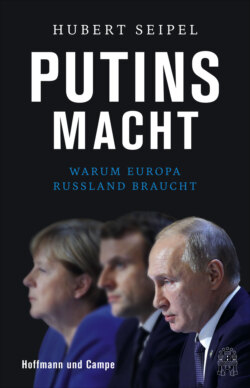Читать книгу Putins Macht - Hubert Seipel - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Prolog
ОглавлениеDas Theaterstück Hexenjagd des amerikanischen Dramatikers Arthur Miller spielt im frühen Amerika der Puritaner. Der moderne Klassiker schildert eine historische Begebenheit. Die kleine Stadt Salem nahe Boston, Massachusetts, wurde vor gut dreihundert Jahren durch mehr als hundert Hexenprozesse berühmt, die zerstrittene Dorfbewohner im Winter 1692 gegen ihre Nachbarn anstrengten. Ein Gericht verurteilte während des kurzen Kreuzzugs neunzehn Menschen als »Hexen«, die sich vermeintlich mit dem Teufel verbündet hatten, und ließ die Mitbewohner hängen. Dutzende andere starben nach ihrer Verurteilung in Gefängnissen.
In Millers Hexenjagd werden einige junge Mädchen vom Pfarrer des Städtchens dabei erwischt, wie sie heimlich in einem Wald tanzen und okkulte Rituale praktizieren. Um sich der Bestrafung zu entziehen, behaupten sie, verhext worden zu sein, und benennen aufs Geratewohl Frauen aus dem Dorf, die sie für Hexen halten. Das Klima in Salem verändert sich. Nachbarn beschuldigen Nachbarn. Denunziation scheint die einzige Möglichkeit zu sein, um sich vor dem Galgen retten. »Das ist die Stunde der Fanatiker«, so heißt es im Programmheft des Hamburger Thalia-Theaters, wo das Stück 2018 Premiere feierte, und von denen gibt es nicht nur im puritanischen Salem jede Menge. Vor allem, wenn neben religiösen auch ökonomische oder erotische Interessen ins Spiel kommen.
Hexenjagd ist noch immer eine brillante Chiffre für die hysterische Verfolgung Andersdenkender, auch wenn Arthur Miller in erster Linie Erfahrungen in den USA zu den Zeiten des Kalten Kriegs verarbeitet hat. Damals hatte der republikanische Senator Joseph »Joe« McCarthy und der »Ausschuss für antiamerikanische Umtriebe« die Jagd auf vermutete oder wirkliche Kommunisten eröffnet. Nicht nur beim politischen Gegner, den Demokraten, sondern vor allem unter Künstlern und Filmschaffenden in Hollywood. Selbst in der US-Armee und unter amerikanischen Zahnärzten suchten die Kommunistenjäger nach subversiven Helfern Moskaus. Miller schildert in einem Artikel in der New York Times von 1989 den McCarthyismus als einen amerikanischen Albtraum mit ebenso düsteren und bedrohlichen wie absurden Zügen:
»Eine Zeitlang schien es, als würde Senator Joe geradewegs aufs Weiße Haus losgehen, nicht zuletzt, weil die schiere Ungeheuerlichkeit seiner Behauptungen gewissermaßen der Beweis für ihre Richtigkeit war: Wenn sich die Kommunisten tatsächlich überall versteckten, dann folgte daraus, dass sie auch dort waren, wo der gesunde Menschenverstand sie am allerwenigsten vermutete.«[1] Und Miller erklärt, warum die Hexenjagd nicht nur eine Parabel über die Ära des Kalten Kriegs ist: »Tatsache ist, je länger ich mich mit dem Dilemma beschäftigte, desto weniger schien es um Kommunisten und um McCarthy zu gehen, sondern um etwas, das ganz wesentlich für das Menschentier ist: seine Furcht vor dem Unbekannten, und vor allem, die Angst vor der sozialen Isolation.«
Das Theaterstück Hexenjagd ist nicht zuletzt deswegen bis heute faszinierend, weil sich die politischen Strategien seit den Tagen von Salem kaum verändert haben. Der Glaube an die eigene Mission ist unerschütterlich, und der Feind kommt grundsätzlich aus dem anderen Lager. Arthur Millers Resümee: »Politische Bewegungen versuchen immer, sich als Schutzschild gegen das Unbekannte zu inszenieren: Stimm für mich, und dir droht keine Gefahr! Bei einer Hexenjagd ist diese Gefahr allerdings eine einzige böse, verkommene, üble, gottlose, zügellose, betrügerische, amoralische, widerliche Verschwörung, die direkt aus dem Innersten der Hölle stammt.«
Die Vorstellung hat sich seit Salem über McCarthy bis in die Gegenwart gehalten. Für die US-Demokraten besteht kein Zweifel, dass der Republikaner Donald Trump nur dank Wladimir Putins Manipulationen 2016 zum Präsidenten der USA gewählt wurde. Seither vergeht kaum eine Woche, in der nicht die journalistischen Flaggschiffe wie The Washington Post oder The New York Times Geschichten zur angeblichen Unterwanderung der amerikanischen Gesellschaft durch russische Geheimdienste präsentieren. Stets mit dem Verweis auf Erkenntnisse amerikanischer Geheimdienste und den beiden Worten »most likely« – »sehr wahrscheinlich«. Worte, die Journalisten dann benutzen, wenn sie für einen Verdacht keine konkreten Beweise haben. Über zwei Jahre hat der amerikanische Sonderermittler Robert Mueller im Auftrag des Kongresses die sogenannte »Russland-Affäre« untersucht. Für die Verschwörungstheorie der Demokraten, nach der Trump dank Putin ins Amt gekommen sei, konnte er keine Beweise vorlegen.
Die tägliche Wiederholung von der Gefahr aus dem Osten hat allerdings die gesicherte Erkenntnis auch in deutschen Medien weitgehend verdrängt, dass die USA weltweit Marktführer sind, wenn es um flächendeckendes Ausspähen und Abhören der Geheimdienste geht. Es war bekanntermaßen der amerikanische Geheimdienst NSA, der weltweit nicht nur Angela Merkels Handy, sondern auch die deutscher Industrieunternehmen abhörte und wohl auch noch abhört – bestens ausgestattet mit einem Budget von gut 11 Milliarden Dollar, über 40000 Angestellten und mit tatkräftiger Unterstützung der Internetgiganten aus dem Silicon Valley. »Ja, die NSA versucht, anderer Leute Geheimnisse zu klauen, und ich gebe zu, dass wir ziemlich gut darin sind«, erklärte ihr einstiger Chef Michael Hayden in der ARD-Dokumentation »Abgenickt und Abgehört« unmissverständlich. »Selbst wenn es um Amerikas engste Freunde geht. Unsere Werte, unsere Interessen, unsere politischen Interessen decken sich nie.«[2]
Für den US-Präsidenten Donald Trump kam die Gefahr gleichfalls von außen. Neben dem traditionellen Lieblingsfeind Russland hatte er noch eine weitere Gefahr aus dem Fernen Osten ausgemacht. Für ihn war es keine Frage, dass das Coronavirus chinesisch und damit die Kommunistische Partei Chinas für die über hunderttausend Toten in Amerika verantwortlich ist. Eine geradezu religiöse Überzeugung, die kein anderes Erklärungsmuster zuließ. Der Aufstieg Chinas zur Weltmacht und zum Konkurrenten der Vereinigten Staaten mobilisierte einmal mehr die Ängste wie zu den besten Zeiten des Kalten Kriegs.
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion vor mehr als drei Jahrzehnten ist das triumphale Gefühl der Überlegenheit wieder gefährdet und damit auch die Vorstellung von der vermuteten Einmaligkeit. Weltweit machte damals ein Thesenpapier die Runde, das Sieger und Verlierer klar beim Namen nannte und der Welt eine glänzende Zukunft vorhersagte. Der Titel der frohen Botschaft: Das Ende der Geschichte. Verfasst hatte das Werk Francis Fukuyama, ein amerikanischer Politologe, und der Inhalt war ebenso einfach wie erfreulich: Wir, der Westen, haben gewonnen. Der Feind im Osten ist am Ende. Die Zukunft gehöre nun allein »der Demokratie und der kapitalistischen Wirtschaft«, die »alle Widersprüche überwinden und alle Bedürfnisse befriedigen« würden.
Francis Fukuyama war nicht der Einzige, der begeistert den Anbruch einer neuen Ära verkündete. Auch der amerikanische Präsident George Bush senior beschwor am 11. September 1990 vor dem Kongress das neue Zeitalter. Das Versprechen: »Eine Welt, in der die Herrschaft des Rechts die Herrschaft des Dschungels ersetzt. Eine Welt, in der die Völker die gemeinsame Verantwortung für Freiheit und Gerechtigkeit erkennen. Eine Welt, in der der Starke die Rechte des Schwachen respektiert.«
Was das konkret bedeutete und wer in dieser neuen Welt das Sagen haben sollte, beschrieb der Kommentator der Washington Post Charles Krauthammer eine Woche nach Bushs Rede in seinem berühmt gewordenen Artikel »The Unipolar Moment«. Der ausgewiesene Konservative mit besten Beziehungen zum Weißen Haus erklärte die Spielregeln. »Es gibt die Vorstellung, dass die Welt multipolar wird«, so Krauthammer. »Die Welt nach dem Kalten Krieg wird nicht multipolar sein. Sie ist unipolar. Die Vereinigten Staaten sind das Zentrum der Welt. Die USA sind die einzige Weltmacht, begleitet von westlichen Alliierten.«[3]
An der Größenvorstellung hat sich nichts geändert. Achtunddreißig Jahre später, im Sommer 2018, unterstreicht US-Präsident Trump wieder einmal den amerikanischen Führungsanspruch auf die Welt. »Amerika hat die beste Ausrüstung der ganzen Welt. Wir haben das beste Gefühl, die besten Soldaten. Auf jedem Schlachtfeld und zu jeder Zeit. Wir sind die Mächtigsten. Wir haben das meiste Geld. Wir sind die Größten. Wir sind die Stärksten, wir sind die Klügsten. Mit Amerika geht es wieder aufwärts. Wir werden nicht klein beigeben.«[4]
Auch nicht, was China angeht – das Land, das jetzt neben Russland auf der Anklagebank sitzt. Donald Trump, der republikanische Gewinner von 2016, hat – wie die Demokraten – den Feind von außen ausgemacht. »China wird alles tun, was in seiner Macht steht, damit ich die Wahl verliere«, verkündete Trump im Wahlkampf 2020.[5]
Donald Trump wähnte sich – ähnlich wie einst seine Konkurrentin Hillary Clinton – im Namen einer höheren Macht unterwegs, daran lässt er keinen Zweifel. »Ich bin der Auserwählte. Also nehme ich es mit China auf.« Der Mann aus Washington hat auch keine Zweifel, wie die Schlacht ausgeht. »Und wissen Sie was? Wir werden gewinnen.«[6] Und falls doch nicht, ist diesmal Peking schuld statt Moskau.
Die geschürte Angst vor finsteren Mächten der USA ist nicht nur eine innenpolitische PR-Variante der Überzeugung, dass das Böse von außen kommt. Die Projektion taugt auch als Mehrzweckwaffe gegen Deutschland, wenn der unbotmäßige Verbündete Amerikas Geschäfte stört. Weil per Fracking gewonnenes Öl und Gas aus den USA teurer ist als der Import aus Russland, versucht Washington mit allen Mitteln die deutsch-russische Pipeline zu verhindern. Präsident Trump wie auch Demokraten und Republikaner aus dem Kongress laufen seit langem Sturm gegen Nord Stream 2. Das günstige Gas aus dem Osten stört die amerikanische Energiebranche sehr. Deutschland begebe sich in Abhängigkeit von russischem Gas, sorgt sich Amerika angeblich um unsere Sicherheit. Deswegen haben die USA als selbsternannte Erziehungsberechtigte ein »Gesetz zum Schutz von Europas Energiesicherheit« verabschiedet. Washington droht mit milliardenschweren Sanktionen und will deutsche und andere europäische Firmen ruinieren, die bei der Konstruktion der Pipeline beteiligt sind. Wie strategisch und übergriffig der Pate aus Übersee dabei vorgeht, zeigt ein Schreiben von amerikanischen Senatoren, das im August 2020 in Sassnitz auf Rügen einging, einem beschaulichen 9000-Einwohner-Flecken.
In ihrem Brief warnen die US-Parlamentarier vor »vernichtenden juristischen und wirtschaftlichen Sanktionen«, falls die Hafenbetreiber von Sassnitz nicht sämtliche Unterstützung für die Verlegung der deutsch-russischen Gaspipeline einstellen.[7] Die Drohung richtet sich ausdrücklich nicht nur gegen Unternehmer und Aktionäre, sondern auch gegen sämtliche Mitarbeiter der betroffenen Betriebe.
Der Fährbetrieb gehört der Stadt und dem Land Mecklenburg-Vorpommern. »Es geht dem Präsidenten offenkundig nicht um Europas Energiesicherheit«, kommentiert die Frankfurter Allgemeine. »Er will die neuen amerikanischen Gasproduzenten auf dem alten Kontinent ins Geschäft bringen. Dazu muss er Russland als dominierenden Anbieter aus dem Markt boxen.«[8]
Donald Trump hatte den Druck auf Deutschland weiter erhöht. Ohne Rücksprache mit Berlin wollen die USA fast 12000 Soldaten aus Deutschland abziehen. Die Kommandozentrale der US-Truppen für Europa in Stuttgart soll ins belgische Mons verlegt werden. Trump warf Deutschland vor, die USA beim Handel und beim Militär zu übervorteilen. »Sie nutzen uns seit vielen Jahren aus … Wir wollen nicht mehr die Deppen sein.« Mit Blick auf die ökonomischen Folgen des Abzugs fügte er hinzu: »Jetzt sagt Deutschland, es sei schlecht für seine Wirtschaft. Nun, es ist gut für unsere Wirtschaft.«[9]
Die USA setzen auf eine Spaltung Europas, um ihre Interessen durchzusetzen. Es ist die alte Strategie, die schon die Römer kannten: »divide et impera« – »teile und herrsche«. Washington zieht demonstrativ Soldaten aus Deutschland ab in Richtung Ostgrenze der Nato, »wo unsere neuen Alliierten sind«, verkündete Donald Trump. Der neue Partner heißt Polen. Die nationalkonservative Regierung in Warschau möchte seit langem mehr Truppen im Land haben – als Drohkulisse gegen den Erbfeind Russland. Bislang sind Soldaten dort im Rotationsprinzip stationiert, nach Angaben der polnischen Regierung derzeit etwa 5000. Geplant ist unter anderem eine ständige amerikanische Militärbasis, die nach dem Willen der polnischen Regierung den Namen »Fort Trump« erhalten sollte.
Die Regierung in Warschau ist auch eine von Trumps Waffen gegen die Gaslieferungen aus Russland. Polen hat mit den USA langfristig Verträge über amerikanisches Fracking-Gas abgeschlossen und organisiert in der EU den Widerstand gegen Nord Stream. Warschau war schon immer gegen russische Gaslieferung nach Deutschland und verwandelt die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg in einen Krieg der Erinnerungen. Der einstige Verteidigungsminister Radosław Sikorski verglich den deutsch-russischen Vertrag über die Gas-Pipeline gar mit dem Hitler-Stalin-Pakt. Er spielt damit auf eine exklusive polnische Geschichtsdeutung an, der zufolge Hitler und Stalin gemeinsam den Zweiten Weltkrieg geplant haben. Genau so hätten Russland und Deutschland Anfang der Jahrtausendwende den Verlauf der Pipeline an Polen vorbei entschieden. Warschau sieht den Kampf gegen Russland als nationale Aufgabe, das geschichtliche Trauma mit dem mächtigen Nachbarn und Rivalen während der vergangenen dreihundert Jahre aufzuarbeiten. Die rechtsnationale Regierung kann dabei nicht nur auf die Unterstützung Washingtons bauen. Polnische Abgeordnete haben im September 2019 im Europaparlament eine Resolution durchgesetzt, die Russland als Rechtsnachfolger der Sowjetunion für den Zweiten Weltkrieg mit verantwortlich macht.[10]
»Jetzt sind wir also nur noch die Täter«, kommentiert der russische Historiker Alexey Miller von der Europäischen Universität St. Petersburg, »und die anderen sind nur die Opfer.«[11]
Die USA sind durch die Dauerfehde zwischen Republikanern und Demokraten für die nächsten Jahre politisch nicht kalkulierbar – auch, was die Amtszeit von Joe Biden angeht. Die Außenpolitik Washingtons ist die Fortsetzung der amerikanischen Innenpolitik, mit brachialen Konsequenzen für Europa.
»Was wir gerade erleben, ist für mich der Hirntod der Nato«, gibt der französische Präsident Emmanuel Macron im Oktober 2019 in einem spektakulären Interview mit dem englischen Magazin The Economist zu Protokoll und bricht damit bewusst das Tabu, offen über Ziel und Zweck des gemeinsamen Verteidigungsbündnisses zu reden. »Wir finden uns das erste Mal mit einem amerikanischen Präsidenten wieder, der unsere Idee des europäischen Projekts nicht teilt«, kritisiert Macron. Es könne nicht sein, dass man immer nur über die amerikanische Forderung nach höheren europäischen Verteidigungsausgaben rede, während die USA im Alleingang den Vertrag mit Russland über die Begrenzung der Mittelstreckenraketen kündigt, ohne die europäischen Verbündeten zu konsultieren, obwohl deren Sicherheitsinteressen betroffen sind. Macrons Schlussfolgerung: Europa könne sich nicht mehr auf Amerika verlassen. Gefordert sei mehr europäische Souveränität, auch in der Verteidigung, und man müsse wieder mehr auf Russland zugehen. Die Eiszeit in den Beziehungen zu Moskau habe Europa nicht stabiler gemacht.[12]
Die Antwort der Bundeskanzlerin kommt schnell und ist typisch für Angela Merkel. Sie könne nicht abstreiten, dass es in der Nato knirscht. Aber was Emmanuel Macron über das transatlantische Bündnis gesagt habe, könne sie auf keinen Fall so stehen lassen: »Diese Sichtweise entspricht nicht meiner«, betont sie in Berlin. »Ich glaube, ein solcher Rundumschlag ist nicht nötig, auch wenn wir Probleme haben, auch wenn wir uns zusammenraufen müssen.« Die Attacke aus Paris trifft Angela Merkel in einer empfindlichen Phase ihrer langen Karriere. Ihre Ära geht dem Ende zu. »Wer sagt es ihr?«, hatte die Wochenzeitung Die Zeit im Oktober 2018 getitelt und darauf angespielt, dass Merkels Zeit abgelaufen sei. »Merkel sitzt auf dem Sofa ihrer Überzeugungen, während um sie herum Betriebsamkeit herrscht. Alle schauen nach vorn, und Merkel ist noch da, aber gleichzeitig schon weg – ein gefährlicher Zustand.«
Einige Tage später verkündet die Kanzlerin unter dem Druck miserabler Landtags-Wahlergebnisse in Hessen, ihr Amt als CDU-Vorsitzende abzugeben. Bis zum Ende der Wahlperiode 2021 will sie allerdings noch Bundeskanzlerin bleiben. Es ist ihr Kampf um die verbliebene Restspielzeit und ihren schwindenden Einfluss. Sie weiß, was das bedeutet. Wer die eigene Partei nicht führen könne, könne auch nicht das Land führen, kommentierte einst die CDU-Vorsitzende Angela Merkel 2004 den Rücktritt ihres Vorgängers vom SPD-Vorsitz. Bundeskanzler Schröder habe einen »Autoritätsverlust auf ganzer Linie« erlitten. Für den französischen Präsidenten ist es der passende Moment, politisch anzugreifen. Er setzt auf ein stärkeres Europa, nicht auf Amerika.
Für Angela Merkel ist die Konfrontation mit den USA am Ende ihrer langen Laufbahn ein Debakel. Sie hat in ihrer erstaunlichen Politkarriere ausschließlich auf den großen Bruder jenseits des Atlantiks gesetzt und über Jahre die Beziehungen nach Moskau vernachlässigt. Washington hat die Bewunderung der deutschen Kanzlerin honoriert und ihr die »Freiheitsmedaille des Präsidenten« verliehen, einen der höchsten amerikanischen Orden. Eine Auszeichnung für Menschen, die sich um die Interessen der USA verdient gemacht haben, heißt es in den Statuten. »Dass ich einmal von einem amerikanischen Präsidenten die Freiheitsmedaille empfangen würde, das lag jenseits meiner Vorstellung«, bekennt sie gerührt im Juli 2011 im Rosengarten des Weißen Hauses vor den versammelten Gästen.
Was ihr Freund Barack Obama der deutschen Kanzlerin damals nicht verrät: Der amerikanische Geheimdienst hört die deutsche Kanzlerin seit Jahren ab, Handy inklusive. Eine US-Tradition, die vor politischen Freunden nicht haltmacht – wie schon bei Merkels Vorgänger und Vorvorgänger.
Als die Information durch den Whistleblower Edward Snowden zwei Jahre später öffentlich wird, bleibt sie Barack Obama treu. Ihre einzige kritische Anmerkung in der Öffentlichkeit lautet: »Wir sind Verbündete, aber solch ein Bündnis kann nur auf Vertrauen aufgebaut sein. Und deshalb wiederhole ich noch mal: Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht.« Barack Obama ist wenig beeindruckt. Seine öffentliche Antwort auf den Abhörskandal lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. »Lassen Sie mich das klar sagen: Unsere Geheimdienste werden weiterhin auf der ganzen Welt Informationen darüber sammeln, was andere Regierungen vorhaben. Wir werden uns nicht dafür entschuldigen, dass unsere Geheimdienste besser sind.«[13]
Erst das gewöhnungsbedürftige, polternde Auftreten seines Nachfolgers Donald Trump zeigte, wie sehr Angela Merkel in der Rolle der politischen Dienstleisterin für eine Weltmacht aufgegangen war. Erst jetzt geht auch die Kanzlerin auf Distanz. Für die Politikerin aus Deutschlands Osten ist mit Trumps Amtsantritt jene geschäftliche Grundsicherung der Bundesrepublik verloren gegangen, die nicht nur in der Welt der Angela Merkel als politisch erdbebensicher galt: die gusseiserne Vorstellung einer unverbrüchlichen Gemeinsamkeit des Westens und der feste Glaube, die Großmacht USA werde stets an unserer Seite stehen, weil uns eine irgendwie gemeinsame Vorstellung von Demokratie und freier Marktwirtschaft verbindet. Dass der Westen keineswegs gemeinsam agiert und die Großmacht USA ausschließlich eigene Interessen hat, ist eine neue Erfahrung für die Kanzlerin am Ende ihrer Amtszeit.
Es ist diese späte Erkenntnis, die Angela Merkel pragmatisch bewogen hat, doch wieder mehr mit Wladimir Putin zu konferieren. Ihr Spielraum ist enger, die Probleme sind größer geworden. Dabei ist die Devise »America first« nicht neu. Die Erfahrung hatten schon ihre Vorgänger Gerhard Schröder und Helmut Kohl gemacht. Auch für Barack Obama oder George W. Bush stand das Leitmotiv nie infrage.