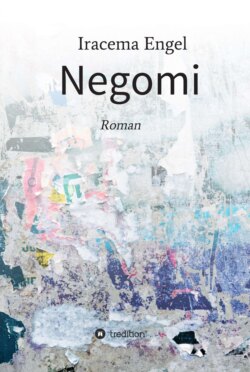Читать книгу Negomi - Iracema Engel - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2
Die Laternen warfen trübe Flecken aufs Pflaster. Junge Typen in Jeans, Sneakers und T-Shirts kamen uns breitbeinig entgegen, ihre Haare waren in alle Himmelsrichtungen frisiert, sie stießen sich gegenseitig mit den Ellenbogen in die Rippen, ihr Lachen keckerte in ihren Kehlen. Einer warf seinen Kopf in den Nacken, ein anderer grölte. Grüppchen von Mädels trippelten aufgeputzt an uns vorbei: rote Lippen, klebrig schwarze Wimpern, rosa gepuderte Wangen, die Haare geglättet. Sie kicherten hinter vorgehaltener Hand und schauten um sich nach möglichen Werbern.
»Sophie! Das kann doch nicht sein! Du Langweilerin!«, Nelli hielt im Gehen die Hand über das Mikro am Handy, schielte mich krass an und feixte, »Sie hat heute einen alten Schulfreund wiedergetroffen! – Jaja, Süße, dann lass es mal krachen!«, sie legte auf, nahm mich an der Hand und lief mit mir auf den Platz unter die bunten Scheinwerfer. Aus den angrenzenden Gebäuden wummerten Bässe aus Verstärkeranlagen.
»Komm! Wir gehen da rein!«, Nelli zog mich hinter sich her zu einem großen, weiß getünchten Gebäude, dessen üppig gestaltete Fassade an herrschaftliche Zeiten erinnerte. Zu ebener Erde stand, wie beim Eingang zu einer Lagerhalle, ein Eisentor einen Spalt breit offen. Nelli war schon hineingeschlüpft, ich folgte ihr. Laute Synthesizer-Musik, gelbes Licht. Am Ende einer langen, niedrigen Halle sprangen vier Mitglieder einer Hip-Hop-Band auf einer Bühne herum und brüllten unverständliches Zeug in ihre Mikrophone. Auf der Tanzfläche standen Grüppchen von jungen Leuten. Sie hielten Plastikbecher mit bunten Flüssigkeiten in ihren Händen und schauten stur nach vorne.
»Ist das hier eine Trauerfeier?!«, Nelli zog mich hinter sich her in die Mitte der Tanzfläche, schwang ihre Arme in die Luft und ließ ihre Hüften kreisen. Ich schloss die Augen und ließ mir vom Rhythmus die Langeweile aus dem Körper schütteln.
Nelli stieß mich in die Seite, »Die Typen da! Die gaffen uns an!«
Zwei Studis mit Plastikbechern standen wie angewurzelt ein paar Meter entfernt und starrten zu uns herüber.
»Kein Wunder! Wir sind ja auch die einzigen Lebendigen hier!«, ich bewegte meine Arme wie Schlangen, wippte mit dem Kopf und kreiste ihn in schnellen Achtern: vor meinen Augen rasten verschwommene Farbfahrer. Mein Blick fiel wieder auf die beiden Gaffer. Sie standen immer noch am selben Fleck und guckten uns an. Der eine prostete mir zu und grinste affig, er hob einen Fuß und eierte auf mich zu, »Du hast einen abgefahrenen Tanzstil!«
Ich ignorierte ihn und tanzte weiter.
Er stand da wie in den Boden geschraubt und grinste, »Wie heißt du?«
Ich tat so, als hätte ich ihn nicht gehört.
»Wie heißt du!?«
– Mann, ist der aufdringlich! – »Negomi!«
»Wie?«
»Negomi!«
»Was für ’n Gummi?«
Ich zeigte ihm den Vogel: »N-e-g-o-m-i!«
»Cool! Ich heiße Tom!«
»Gratuliere!«, ich tanzte weiter.
Der Typ rührte sich nicht vom Fleck, den Plastikbecher in der Hand, sein Grinsen immer noch auf dem Gesicht, durchbohrte er mich mit seinem Blick.
»Was ist mit dem?!«, schrie Nelli mir ins Ohr.
»Keine Ahnung!«, ich drehte mich von ihm weg. Meine Füße flogen im Zickzack über den Boden, mein Kopf kreiselte, der Beat peitschte meine Arme, ich atmete die Synthesizer-Töne ein, ließ sie meine Lungen füllen und stieß sie durch die Nasenflügel wieder aus, sodass sie als verbogene Noten auf den Boden purzelten. Der Typ stand immer noch da. Seine schwarzen Locken wirbelten in wilden Strömen um seine Stirn, sein kleiner, eckiger Körper wackelte und zitterte: Neandertaler! Seine Augen schossen brennende Pfeile in meine Brust. Nelli riss mich am Arm, »Der ist ja irre! Komm, wir gehen woanders hin!«, sie zog mich hinter sich her. Im Gehen blickte ich noch mal zurück: Der Neandertaler hatte sich ein Stück gedreht und schaute mir über die Distanz messerscharf in die Augen: armer Trottel!
Wodka, Tequila, Farbblitze, der Beat jagte meinen Puls in die Höhe. Nellis Lachen zerrte ihr Gesicht in die Länge, ihre Augen waren schallplattengroße Teller, auf denen rote Adern platzten, ihr Mund öffnete sich zu einem Abgrund, in dem Feuer loderte, ihre Lippen flogen als Luftschlangen durch den Raum. Ich stieß die Tür auf. Ein warmer Hauch berührte meine Haut. Flämmchen von Teelichtern zuckten in dickwandigen Gläsern. Menschenrücken. Gedämpfte Stimmen. Die Tür fiel ins Schloss. Auf dem Balkon hoben manche ihre Köpfe. Ich hielt mich am Geländer fest und schaute hinunter auf den Platz. Das Bild vibrierte vor meinen Augen. Ich griff mir an die Stirn.
»Hey!«, ein großer schlaksiger Typ mit Kapuzenweste stellte sich neben mich und lächelte mich von der Seite an.
»Hi!«
»Alles klar bei dir?«, er sprach wie nebenbei.
»Ich hab von allem ein bisschen zu viel erwischt.«
Er lachte leise. »Gefällt dir das Fest?«, seine Stimme war sanft und warm.
»Geht so.«
»Studierst du?«
»Ja.«
»Was denn?«
»Hiho!«, der Neandertaler mit dem irren Blick stand da, »Du warst vorhin auf einmal weg!«
»Ich wollte weg von dir!«, ich drehte mich wieder zu dem sanften Typen.
»Negomi, oder?«, sagte mir der Neandertaler in den Rücken.
»Du nervst!«, zischte ich ihm über die Schulter zu.
»Ein abgefahrener Name, so wie dein Tanzstil.«
»Du, ich geh mal rein an die Bar. Hoffentlich sehen wir uns noch«, der sanfte Typ verschwand nach drinnen. Der Neandertaler sah ihm hinterher und nickte zufrieden, »Mir hat dein Tanzstil gefallen.«
»Das hast du schon gesagt.«
»Was machst du so? Ich meine, beruflich.«
»Ich studiere.«
»Ich auch! Und was studierst du? – Negomi!«, er betonte meinen Namen, als wäre er stolz darauf, ihn aussprechen zu können.
»Schauspiel.«
»Oh, toll! Ich habe viele Freunde, die Schauspielschüler sind, am Reinhardt Seminar. Auf welcher Schauspielschule bist du?«
»Schauspielakademie Rita May.«
»Die kenne ich nicht. – Bist du aus Wien?«
»Nicht direkt. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, aber meine Familie kommt ursprünglich aus Wien.«
»Lebst du gerne hier?«
»Ich bin mit Vielem nicht einverstanden, was hier läuft.«
»Geht mir auch so. Hier ist alles ein bisschen hinterm Mond.«
Ich musste lachen. »Und was machst du?«
»Ich bin auf der Angewandten und studiere Bühnenbild. Eigentlich hätte ich vor Kurzem mein Biologie-Studium abschließen sollen, aber ich hab’s geschmissen. Ich habe mir eingebildet, was G‘scheites studieren zu müssen. Kurz vor meiner Diplomarbeit habe ich erkannt, dass ich mit der Wissenschaft nicht weitermachen will. Bühnenbild ist spannend, das begeistert mich, und auf der Angewandten laufen viel lustigere Typen rum als auf der Biologie.«
»Sperrstunde!«, ein tätowierter Typ steckte seinen Kopf durch die Tür. Außer uns war niemand mehr auf dem Balkon. Der Himmel leuchtete matt rosa.
Tom und ich durchquerten das Lokal und traten hinaus auf den Platz. Die Strahlen der Morgensonne bohrten sich wie Dolche in meine Stirn, vor meinen Augen flimmerte es, ich hielt mich an Toms Schulter fest, er ergriff meinen Arm, »Ist dir nicht gut, Negomi?«
»Mir geht es blendend!«, ich zog durch die Nase kräftig Luft ein und atmete durch den Mund so lange aus, bis ich auch noch das letzte Bisschen Alkohol-Nikotin-Mief aus meinen Lungen rausgepresst hatte und meine Nase wie von selbst wieder Luft einsaugte: Sauerstoff strömte ein, meine Lungen blähten sich auf.
»Negomi!«, Nellis Stimme kratzte wie der Fingernagel auf der Schiefertafel, »Negomi!« Mein Kopf wollte bersten! Nelli wankte mit ein paar anderen Nachtschwärmern im Schlepptau auf uns zu und streckte die Hand nach mir aus, »Komm, Negomi, wir gehen frühstücken!«
»Ja, das ist eine gute Idee! Lasst uns Frühstücken gehen!«, rief Tom.
»Nein, du kommst nicht mit, du bist komisch!«, lallte Nelli.
»Wieso?«, Tom tat gekränkt, »Wartet, ich hole mein Rad!«
Nelli zerrte an meinem Shirt, »Komm, Negomi! Wir gehen frühstücken! Komm!«, sie stampfte mit dem Fuß auf.
»Ich warte auf Tom.«
»Aber wir gehen jetzt! Ruf mich an! Dann könnt ihr nachkommen.«
»Vielleicht, aber ich gehe wohl eher nach Hause.«
»Nein, nein!«, greinte Nelli. Sie legte den Zeigefinger an die Lippen, beugte sich zu mir und flüsterte laut: »Du kommst nach, Negomi!«
»Nein, Nelli, ich gehe nach Hause.«
»Na gut, Negomi, na gut, wenn du es so willst… ich gehe!«, Nelli warf mir eine Kusshand zu und torkelte mit ihrem Anhang davon.
Ich stand alleine auf dem Platz, die Sonne wärmte meine Haut, mein Atem ging ruhig.
»Hey! Wie schön! Die anderen sind weg! War die eine da deine Freundin? Die ist ja irre!«, Tom schob sein Fahrrad auf mich zu.
»Ich gehe nach Hause«, sagte ich.
»Nein!«, flehte er.
»Doch!«, beharrte ich.
»Ich will dich wieder sehen!«
»Ja, wir sehen uns bestimmt irgendwo wieder.«
»Nein, ich will dich schnell wieder sehen.«
»Gut. Wann?«
»Um 12 im MQ-Daily.«
»Ich werde dort sein.«
Tom schob sein Rad über den Platz und verschwand in einer Seitenstraße. – Ein Treffen ohne Telefonnummer? Wie kann er sicher sein, dass ich komme? Nicht mehr denken, nur ins Bett – und nie mehr so viel Alkohol! –
Ich öffnete die Wohnungstür. Aus dem offenen Türrahmen der Küche schien Licht ins Vorzimmer. Ich legte meine Tasche ab, schlüpfte aus meinen Schuhen und trat über die Schwelle. Mama stand im Pyjama am Herd, »Guten Morgen, Schätzchen! War's schön?«
»Ja, geht so.«
Die Eieruhr piepte. Mama nahm das Töpfchen vom Herd, goss das heiße Wasser ab, stellte das Töpfchen in die Spüle und ließ kaltes hineinlaufen. Sie wartete ein paar Augenblicke, griff ins Töpfchen, nahm das Ei heraus, stellte es in einen Eierbecher und trug ihn zum Tisch, auf dem ein Butterbrot, ein Messer und eine Tasse Schwarztee vorbereitet waren. Sie setzte sich auf den Hocker und schlug das Ei auf. Ich sah ihre Handgelenke, und es drehte mir den Magen um: Früher hatte sie große Hände und kräftige Arme gehabt, jetzt hingen ihre Hände übergroß von knochigen Gelenken an dünnen Ärmchen herunter.
»Willst du auch was?«, Mama biss in ihr Butterbrot.
»Nein, danke. Ich gehe in mein Zimmer.«
Ich spürte nicht den Boden unter meinen Füßen, alles an mir war taub. Im Zimmer ließ ich mich aufs Bett fallen und drückte mein Gesicht in den Kopfpolster. Ich wollte heulen, ich wollte schreien, aber heraus kam nur ein trockenes Schluchzen.
– Sprich sie endlich darauf an! So kann es nicht weitergehen!
Ich traue mich nicht!
Mach’ schon! Geh! Los! Sag es ihr! –
Mama löffelte gerade ihr Ei aus. Ich blieb im Türrahmen stehen. Ihre früher so volle Löwenmähne hing zottig und ergraut an ihren Wangen herunter. Ihre Augen hatten tiefe Schatten, sie schauten mich aus einem bleichen, knochigen Gesicht heraus leer an.Ich hätte gerne gelächelt, ich hätte gerne ganz locker darüber geredet, aber mein Gesicht war versteinert, mein Mund eingefroren.
– Sag es! Los! Es gibt kein Zurück! –
»Mama, du bist viel zu dünn, du isst viel zu wenig!«
– Ich habe die Grenze übertreten! Was wird sie tun? –
»Ich weiß. Ich mache das mit Absicht. Ich brauche das. Aber ich habe mich im Griff, keine Sorge«, Mama wendete sich wieder ihrem Frühstück zu. Ich stand da, war aber eigentlich vollkommen verschwunden. Irgendwie fand ich in mein Zimmer zurück, wo ich mich in mein Bett verkroch und in einen trüben Dämmerschlaf sank.
Der Klingelton meines Handys riss mich hoch: Nelli: »Alles okay bei dir, Süße? Bist du gut nach Hause gekommen?«
»Jaja. Und du?« Plötzlich schoss es mir ein: Tom! »Nelli, ich muss Schluss machen! Ich bin verabredet!«
»Was? Negomi? Ist es der Typ-?«
Ich legte auf, raste ins Vorzimmer, schlüpfte in meine Schuhe, schnappte meine Handtasche, besserte meine Schminke im Spiegel nach und flitzte aus der Wohnung. Zum Glück fuhr die Straßenbahn gerade in die Station ein, als ich über die Kreuzung zum Schloss Belvedere lief. Ich sprang hinein und setzte mich auf einen freien Platz beim Fenster.
– 11:45 Uhr. Wenn die Bahn schnell macht, komme ich vielleicht nur zehn Minuten zu spät. Hoffentlich wartet Tom auf mich! –
Beim Dr.-Karl-Renner-Ring stieg ich aus, hastete über die Schienen und an der Hinterseite des Naturhistorischen Museums vor zur Hauptstraße. Die Hitze hing in den Straßen wie unsichtbarer Nebel. Um mich her surrte und brummte der Verkehr. – Gleich bin ich da, nur noch den Zebrastreifen überqueren: ein Ding der Unmöglichkeit! Die gemeine Ampel lässt mir dafür gerade mal eine halbe Sekunde Zeit, dann wird dem gehenden Mann sein grünes Licht entzogen und der stehende Mann erstrahlt in teuflischem Rot: »Halt! Stehen bleiben! Kein Weiterkommen!« Und ich befinde mich gerade mal auf dem ersten Drittel des Zebrastreifens: Blöde Ampeln, Stressfabrikanten! – Mit großen Schritten überquerte ich die letzten beiden Drittel des Zebrarückens. Ich setzte meinen rechten Fuß auf den Gehweg, der linke zog nach, da brausten die Autos auch schon wie losgelassene wilde Tiere hinter mir vorbei.
»Ja, fahrt schon, und alles Gute! Ich werde euch alle überleben!«
Ich ging auf die Torbögen des Hauptportals zu, trat ins Dunkel des Durchgangs, machte ein paar schnelle Schritte und war wieder im Licht, auf dem großen Museumsplatz – genau zehn Minuten zu spät und außer Atem!
Die Lokale, die sich zwischen den Museumsgebäuden in die alten Gemäuer eingenistet hatten und am Rand des Platzes ihre Schanigärten ausbreiteten, waren bevölkert mit mittagshungrigen Menschlein: Der eine wartete noch auf jemanden, die andere saß schon mit ihrer Freundin bei einem frischen Salat und einem Aperol Spritz: Eine nette Kulisse, wie aus dem Werbeprospekt. Tom saß auf der Terrasse des MQ-Daily an einem der klotzigen Plastiktische auf einem lungenschwachen Stanzstuhl, winkte mir zu und grinste.
»Entschuldige die Verspätung!«, ich setzte mich zu ihm auf einen etwas gesünderen Stanzstuhl: hart, platt, eckig: mein Hintern stöhnte, mein Rückgrat ächzte.
»Kein Problem!«, flötete Tom.
Die Kellnerin kam zu unserem Tisch. Ich warf einen Blick in die Karte. Tom bestellte einen Couscous-Salat und irgendsoein zuckrig-alkoholisches Getränk mit einem besonders schicken Namen, für den man es teuer verkaufen kann. Ich tat es Tom gleich.
»Ich freue mich, dass du da bist!«, Tom machte die Arme lang, fasste mich an den Handgelenken und schmiegte seine Schulter an meine, »Wie geht es dir, Negomi?«
»Mir geht es gut. Wie geht es dir, Tom?«
»Ja, auch«, er flatterte mit den Wimpern, »Also, Negomi, sag’ mal, wie kommt es, dass du Schauspielerin werden willst?«
»Das ist schon lange mein Traum.«
»Schön!«, hauchte er und lachte.
»Warum lachst du?«
»Weil es mir gut geht!«, schnurrte Tom.
Die Kellnerin servierte unser Essen und die Getränke. Wir stießen an: rosa Flüssigkeit, Limettenscheiben, Eiswürfel. Ich sog das Gesöff zwischen den Lippen durch die Zähne an den Gaumen und spürte bittere Süße und stechenden Alkohol: ich schluckte!
»Was machst du im Sommer?«
»Sommertheater. Auf einer Burgruine. Draußen in der Pampa.«
»Im Ernst?«
»Spaß ist es keiner. Ich hätte nie damit anfangen sollen.« Ich nahm einen kräftigen Schluck und schwieg.
»Jetzt sag aber: du bist am Land aufgewachsen?«, er bewegte seine Schultern vor und zurück, sodass sein Kopf sich hin und her drehte.
»Ich war drei, da haben meine Eltern ein altes Dorfschulhaus im Waldviertel gekauft und renoviert. Mein Vater hat unter der Woche in Wien gearbeitet, und meine Mutter war bei uns Kindern.«
»Du bist also so richtig am Arsch der Welt groß geworden«, lachte Tom.
»Ich fand es wunderschön. Die Stille dort draußen, die Natur, das waren meine Kraftquellen, davon bin ich geprägt.«
»Klingt nett. Also, ich war immer nur in Städten: Wien, Berlin, Dortmund, Köln, oder weiter weg: Rom, Venedig, Mailand – ich liebe Italien! Warst du schon dort?«
»Einmal in Venedig und einmal in Rom, aber immer nur für ein paar Tage.«
»Ich liebe Städte! Da ist es laut und hektisch, die Menschen sind unfreundlich, es stinkt, es ist immer zu warm oder zu kalt, alles läuft mehr schlecht als recht, ständig geht was schief. Aber es gibt dann immer irgendwo diese kleinen Oasen, an denen man vergisst, was einen umgibt, wo man einfach entspannen und Spaß haben kann. Außerdem ist in der Stadt die Kultur zu Hause: ich liebe es, in Ausstellungen zu gehen, ins Kino, ins Theater, in Konzerte, das brauche ich, davon ernähre ich mich.«
»Das mag ich auch. Trotzdem weiß ich nicht, ob ich hierbleiben werde.«
»Wieso? Wo willst du hin? Bleib da, bitte!«, Tom formte seine Lippen zu einem Schmollmund, »Oder geh nach Berlin, da komm ich mit: Berlin ist zurzeit die geilste Stadt!«
»Ja, vielleicht, mal sehen«, ich zwang mich zu einem Lächeln und schlang das Essen hinunter: Das Gemüse und die Minze waren frisch, der Couscous war locker, aber ich schmeckte nichts. Tom aß mit gutem Appetit, er schmatzte und putzte den leeren Teller mit Fladenbrot sauber.
»Und du hast was gegen Österreich, Negomi?«, Tom bewegte die Schultern und grinste.
»Naja-«, fing ich an.
»Es ist schon ein kleines Faschistennest«, unterbrach er mich und lachte, so als hätte jemand anderer seinen Satz gesagt.
Die Kellnerin räumte die Teller ab. Wir verlangten die Rechnung.
»Gehst du noch mit mir auf ein Eis am Schwedenplatz?«
»Bei der Hitze den ganzen Weg durch die Innenstadt?«
»Wir nehmen uns City-Bikes!«
»Ich weiß nicht.«
»Komm! Das wird ein Riesenspaß!«
»Na gut.«
Ich lud Tom auf das Mittagessen ein – als Wiedergutmachung für die Verspätung. Wir gingen zur Fahrradstation vor dem Museumsquartier und entlehnten zwei Räder über den digitalen Bildschirm an der Eingabesäule. Jeder zog das Rad aus dem Ständer mit der von ihm gewählten Nummer, wir stiegen auf und fuhren los.
Tom ritt voran. Er war der City-Bike Cowboy. Sein Pferd wieherte unter seinem festen Tritt. Es setzte an zum Sprung. In schnellem Galopp jagte er es über die Prärie: »Juchhe!« Ich folgte ihm auf meinem alten Gaul, trieb ihn zur Eile an, versuchte mit dem Cowboy und seinem Hengst mitzuhalten - doch es gelang mir nicht, ich blieb zurück. Der Cowboy preschte davon, die Hufe seines Pferdes wirbelten Staub auf, eine rote Wand trübte meinen Blick. Mein alter Gaul schnaubte. Der Cowboy war in der Ferne verschwunden, sein Juchhe hallte nach in der unendlichen Weite der Prärie.
Ich bog um eine Kurve und hörte einen Schrei. Meine Hände pressten sich zusammen, ich bremste, was nur ging, der vordere Reifen blockierte, der hintere hob ab, meine Hände klammerten sich an die Lenkstange, ich knallte auf die Straße.
»Sind Sie wahnsinnig?! Haben Sie keine Augen im Kopf!?«
Ich lag unter meinem Fahrrad, die Speichen drehten sich surrend über mir. Eine Frau mit langen rotblonden Haaren, einem zinnoberroten Hosenanzug und einer großen, schwarzen Sonnenbrille schaute auf mich herunter. Durch die dunklen Gläser ihrer Brille erkannte ich, dass ihre Augen geweitet waren. Ich rappelte mich hoch, »Entschuldigen Sie! Ist Ihnen etwas passiert?«
»Etwas passiert?!«, kreischte die Frau, »Sie haben mich halb totgefahren!«
»Entschuldigen Sie! Kann ich etwas für Sie tun?«
»Schauen Sie gefälligst, wo Sie hinfahren!«, herrschte mich die Frau an. Sie ging in die Knie und riss eine große schwarze Lederhandtasche an ihre Brust. Ihre Lippen kräuselten sich, »Seien Sie froh, dass ich nicht die Polizei rufe!«
»Es tut mir wirklich leid!«
»Ach, halten Sie die Schnauze!«, sie fuhr mit dem Arm in die Schlinge ihrer Handtasche, reckte die Nase in die Luft, warf den Kopf in den Nacken, ihre Haare flogen, sie stolzierte davon.
Mein Herz raste, mein Mund war trocken, meine Hände zitterten. Ich befand mich einer verlassenen Seitenstraße, gleich zu meiner Rechten über den Gehsteig ein Geschäft für Wohnungseinrichtung: weiche Polstermöbel, modernistisch anmutende Lampengebilde, Tische aus hellem Holz. War die Frau aus diesem Geschäft gekommen? Ein Auto hupte mich an. Ich fuhr herum. Hinter der Windschutzscheibe eines riesigen, schwarzen Porsche hob ein Mann seine Arme und verzog das Gesicht. Ich stand in der Mitte der Straße breitbeinig über meinem Fahrrad und blockierte die gesamte Fahrbahn! Ich sprang zur Seite, zog das Rad hoch und machte Platz. Der Porsche röhrte an mir vorbei. Mein Handy läutete, »Negomi, wo bist du? Ich bin jetzt am Schwedenplatz.« »Tom! Ja! Ich komme!« Ich stieg aufs Rad und fuhr vor zur Hauptstraße. Sie war vierspurig und stark befahren, die Fahrradspur verlief zwischen der Autospur und den Straßenbahnschienen. Ich war noch nie mit dem Rad mitten im städtischen Verkehr gefahren. Rechts kamen mir zwei geschwind hintereinanderfahrende Straßenbahnen entgegen, links sausten die Autos an mir vorbei. Ich hatte Angst, von den einen oder den anderen mitgerissen zu werden. Krampfhaft versuchte ich, zwischen den blaugestrichelten engen Bodenmarkierungen Spur zu halten. Ich gelangte zu einer großen Kreuzung. Die Autos bremsten und blieben stehen, ihre Motoren tuckerten, ich atmete den schwarzen Rauch ein, die Autos glühten, so wie der Asphalt unter meinen Füßen. Ich kam ins Schwitzen: kalter Schweiß. Die Motoren brummten wieder los. Ich ließ mich vom Tempo der Autos mitreißen. Eine Hupe ertönte, meine Lenkstange schlingerte. Vor mir war einem Fahrer der Motor abgestorben, die Kolonne stockte, alle Autos hupten. Ich trat in die Pedale, fuhr an der Autoschlange vorbei über die Kreuzung. Nach ein paar Metern mündete die schmale Fahrradspur in eine breite Zone für Fußgänger und Radfahrer. Hohe Platanen säumten den Weg, ich fuhr in ihrem Schatten, ein warmer Wind spielte um meine Wangen, ich atmete auf.
Am Schwedenplatz stand Tom unter einem Baum und schleckte an einer grünen Eiskugel. Ich hielt an und stieg ab.
»Was ist denn mit dir passiert?«, Toms Augen wanderten meinen Körper hinunter. Ich folgte seinem Blick: Ich sah Blut! Das Rad fiel scheppernd zu Boden. Mir wurde schwarz vor Augen.
»Negomi! Negomi! Aufwachen!«
Verschwommen nahm ich die Umrisse von Toms Gesicht wahr.
»Da, trink einen Schluck Wasser«, Tom hielt mir eine Flasche an die Lippen. Das Wasser war warm und schmeckte nach Plastik. Wieder wurde alles schwarz um mich her.
Rote Hosen, weiße T-Shirts, Männerstimmen. Zwei Arme schoben sich unter meine Achseln, zwei Hände packten meine Fußgelenke. Ich wurde hochgehoben und auf weiche Polster gelegt. Die Frau in dem zinnoberroten Hosenanzug legte ihre Hand auf meine Stirn, sie hatte ihre Sonnenbrille abgenommen, ihre Augen waren grün, sie funkelten wie Smaragde. Die zinnoberrote Frau lächelte, sie küsste meine Wange: zinnoberrote Lippen, ihre rotblonden Haare kitzelten meine Nase, ich musste niesen.
»Viel Glück!«, rief die zinnoberrote Frau.
»Danke!«, erwiderte ich.
»Geht es Ihnen schon besser?«, fragte die zinnoberrote Frau.
»Ja!«, ich wollte mich aufrichten.
Sie drückte mich sanft, aber bestimmt in die Kissen eines breiten Sofas, »Ruhen Sie sich aus. Das haben Sie sich verdient. Tom ist Ihnen davongefahren. Bei mir sind Sie in Sicherheit.«
Wärme durchströmte mich, ich lächelte.
»Ich freue mich, dass Sie in mein Haus gekommen sind. Sie können gerne hier wohnen bleiben, wenn Sie es wünschen. Meine Sofas sind die bequemsten in der ganzen Galaxie, ihre Bezüge sind aus den Fäden der Mondmilch gewebt und gefüllt sind sie mit dem Knistern des Sonnenfeuers. Meine Lampen sind aus Kometenglas gefertigt, sie erfreuen sich kosmischer Beliebtheit. Und haben Sie schon den Tisch angefasst?«
Ich sah sie gebannt an und schüttelte den Kopf.
»Nur zu! Es ist ein Erlebnis, Sie werden sehen!«
Vorsichtig streckte ich den Arm aus und berührte die Tischplatte.
»Haben Sie es erraten?«, die zinnoberrote Frau zwinkerte mir zu, »Es ist Jupitergestein, erste Ernte, mit Sternenstaub geschliffen!«
»Sternenstaub?«, fragte ich.
Die zinnoberrote Frau nickte, »Feinste Auslese. Direkt aus dem Orionnebel. Dieser Tisch ist ein Unikat, wir nennen ihn Marwalon.«
»Marwalon? – Woher kommt dieser Name?«, fragte ich.
Die zinnoberrote Frau schmunzelte. »Marwa ist die Quelle des Lichts und Alon der Ursprung der Dunkelheit. Sie sind das erste Paar. Aus ihrer Vereinigung entspringt alles Seiende.«
»Wer kauft diese Möbel? Sie sind doch bestimmt unbezahlbar!«, sagte ich.
Die zinnoberrote Frau wiederholte langsam, als würde sie die Wörter zum allerersten Mal aussprechen: »Kaufen? Unbezahlbar?« Sie schwieg. »Wir nehmen dankbar die Geschenke des ersten Paares an. Wir fertigen diese Gegenstände, um durch sie das Sein zu feiern.«
»Wer ist wir?«, fragte ich.
Die zinnoberrote Frau antwortete: »Mein Gefährte und ich. Wir reisen durch den Kosmos und sammeln die Gaben von Marwalon. In unserer Werkstatt verleihen wir ihnen dann Gestalt.«
Ein Hupen ertönte. Ich schreckte hoch. Es war kein gewöhnliches Hupen, es klang wie das Tosen eines Wasserfalls, wie das Trompeten eines Elefanten, wie das Brüllen eines Löwen. Die zinnoberrote Frau hatte sich zum Fenster gedreht. Draußen in der glitzernden Schwärze des Alls stand ein schwarzer Wagen. Ein Mann saß am Steuer. Es war der Porschefahrer!
»Mein Gefährte!«, sagte die zinnoberrote Frau und erhob sich, »Wir machen uns wieder auf zu den Sternenbahnen.«
Ehe ich es mich versah, saß die zinnoberrote Frau schon neben ihrem Gefährten in dem Wagen. Jetzt erst sah ich, dass es gar kein Porsche war, sondern ein schwarzer Kometenschlitten. Ich sprang vom Sofa auf, »Wann kommt ihr zurück?«
»Wann?«, wiederholte die Frau, als hätte sie dieses Wort noch nie gehört. »Viel Glück!«, rief sie und winkte.
Der Kometenschlitten schoss wie ein Blitz davon. Vor meinen Augen breitete sich gleißend helles Licht aus. Ich blinzelte.
»Negomi? Negomi!«, Toms Augen waren weit aufgerissen, sein Mund stand offen, er hielt meine Hand, »Sie sieht mich an!«
In meiner Armbeuge steckte eine Nadel, sie war mit einem dünnen Schlauch verbunden, »Wo bin ich?«
»Sie sind in einem Rettungswagen«, antwortete ein junger Sanitäter neben Tom, »Wir fahren gerade ins Krankenhaus. Sie haben eine Fleischwunde am Knie, die muss genäht werden.«
Tom streichelte meine Hand, »Du bist offenbar mit dem Rad gestürzt. Du hast wie verrückt geblutet, als du vorhin auf mich zugekommen bist. Dann bist du einfach umgefallen. Zum Glück habe ich dich aufgefangen, sonst hättest du dir womöglich auch noch den Kopf angeschlagen. Ich lasse dich nie wieder allein«, Tom gab mir einen Kuss auf die Lippen.
Eine Spritze, zwölf Stiche, ein Verband und die Entlassung mit der Ermahnung des Arztes, im städtischen Verkehr besonders gut aufzupassen: »Das hätte auch schlimmer ausgehen können. Was glauben Sie, wie die meisten Radfahrer aussehen, die zu mir hereingebracht werden.«
Wir setzten uns auf ein Mäuerchen im Schatten. Der Stein kühlte. Ich starrte vor mich hin. Erdbeere und Vanille – meine Lieblingssorten. Ich schleckte gegen die Hitze und das Zerrinnen an. Auf meiner Zunge zerschmolz meine Kindheit. Ich wollte wieder sorglos sein. Ich wollte, dass mein Leben mit der Sonne aufgeht und am Abend mit ihr verlischt. Ich wollte jeden Tag neu geboren werden in die immer gleiche Geborgenheit. Ich wollte, dass meine Welt da endet, wo sich der Bach um die Wiesen und Wäldchen unseres Dorfes schlängelt. Ich wollte, dass der Austritt aus dieser heilen Welt nur eine ferne Ahnung ist von einer Zukunft, die niemals kommt. Das Eis hatte die Tüte aufgeweicht, ich schleckte und biss und kaute – cremig, flüssig, bröslig, trocken –, bis nur noch die Spitze der Tüte übrig war. Ich steckte mir das feste, trockene Hütchen zwischen die Zähne, meine Zunge fing es sich, die Falle schnappte zu: der krönende Abschluss des sommerlichen Genusses: Vielleicht esse ich Eis überhaupt nur wegen dieses letzten Bissens, wegen der süßen, knackigen Freude am äußersten Ende der Schleckerei.
Toms Fingerspitzen berührten die Mullbinde an meinem Knie.
»Tut es noch weh?«
»Was? – Achso! – Es geht.«
»Wann kommen die Nähte raus?«
»Nächsten Freitag.«
»Soll ich da mitkommen?«
»Nein. Ich bin in der Früh dort, fahre dann gleich weiter zur Probe.«
»Okay, aber du musst mir nur Bescheid geben. Und danach treffen wir uns und feiern deine Genesung.«
»Wann danach!? Das geht nicht! Ich bin den ganzen Tag auf der Burg. Und wenn ich dann abends nach Hause komme, bin ich zu gar nichts mehr fähig.«
»Schade. Ich würde gerne was mit dir unternehmen.«
»Ja, ist halt so. Was soll ich tun? Ich kann's nicht ändern!«, ich hob die Arme, ließ sie auf meine Schenkel fallen, schnaubte und schaute an Tom vorbei ins Leere.
»Dir geht es nicht gut«, Tom streichelte meinen Arm.
»Ach, was!«, ich wich zurück, er ließ seine Hand sinken und seufzte. Wir schwiegen.
»Heute ist dein freier Tag! Versuche, an etwas anderes zu denken.«
»Du bist lustig! Morgen gehen die Proben weiter. Ich habe keine Ahnung, was mich da wieder erwartet. Aber es ist eh immer der gleiche Scheiß!«
»Warum steigst du nicht aus? Pfeif auf das Sommertheater, das ist doch nicht wichtig.«
»Bist du nicht ganz dicht!? Was heißt, das ist nicht wichtig!? Das ist doch scheißegal, ich bin dabei, ich habe damit angefangen, ich kann nicht einfach so aussteigen und die anderen im Stich lassen. Das wäre eine Blamage!«
»Negomi, du kannst dir nur selbst helfen, aber mit dieser Stimmung wirst du das Ganze nicht gut überstehen.«
»Ach was, lass mich doch in Ruhe, was weißt du schon!«, ich stand auf.
»Wieso bist du jetzt gegen mich?«
»Ich bin nicht gegen dich. Ich habe nur keine Kraft mehr.«
»Wo willst du jetzt hin?«
»Nach Hause, ins Bett.«
»Ich begleite dich.«
»Nein.«
»Rufst du mich an?«
»Ja.«
Tom stand auf und drückte mich fest an sich – mein Körper war Kaugummi und Pudding. »Ich finde dich toll. Ruh’ dich aus. Und melde dich dann.«
Tränen pressten nach draußen, ich biss die Zähne zusammen und nickte.
Ich humpelte die Stufen hinauf zur heimatlichen Wohnung: Hier war nie etwas heimatlich gewesen, immer nur ein Provisorium! Aber ich hatte mich eingerichtet, innerhalb der wesenlosen Wände die beseelten Gegenstände aufgestellt: herausgerissen, ihrer Bedeutung beraubt! Hier standen sie rum als Dekor, niemand brauchte sie mehr. Ich warf sie nur nicht weg, weil ich die vergebliche Hoffnung hatte, sie könnten wieder zu neuem Leben erwachen. Aber sie sprachen nicht mehr zu mir. Mein Kopf schmerzte. Ich drückte mein Gesicht ins Kissen. – Schlafen, schlafen und nie mehr aufwachen, schlafen und ewig aufgehoben sein, endlich in Sicherheit, endlich Ruhe, keine Gedanken mehr, kein Müssen. – Meine Glieder waren schwer, ich ließ los und sank hinab ins Dunkel… Ich stehe auf der brüchigen Asphaltstraße vor dem schiefen Gartentor, es schließt nicht - wir lehnten es immer an. Ich öffne es und gehe hindurch, über den schmalen Weg zur Haustür. Er ist von zwei niedrigen Mäuerchen begrenzt, in die früher, als das noch der Garten des Schuldirektors war, Zaungitter eingeschraubt waren. Auf allen Mäuerchen im vorderen Garten waren diese Zäune montiert und mehrere Tore, durch die man in die schmalen Gassen und auf die kleinen Wiesenflächen gelangte, aber nur wenn man den Schlüssel hatte – die Schüler durften da niemals rein! Mama entfernte die Zäune gleich, nachdem sie und Papa das Haus gekauft hatten. Für Irma, Arno und mich waren die Mäuerchen Hürden, über die wir sprangen, oder Sitzgelegenheiten, wenn im Sommer die Sonne den Stein erwärmt hatte. Als ich größer war, konnte ich einen Fuß auf das eine Mäuerchen und den anderen auf das gegenüberliegende stellen und schwebte in der Grätsche über dem schmalen Weg zwischen Gartentor und Hauseingang.
Der sommerliche Garten war ein Blumenparadies. Wir hatten viele Rosenstöcke mit duftenden Blüten – weiße, apricotfarbene, rote, rosaviolette und gelbe –, jeder Rosenstock verströmte seinen eigenen Duft. Ich ging oft an den Beeten und Töpfen entlang und sog die Düfte ein. An warmen Sommernachmittagen saß ich auf der Steinstufe unter der Haustür und schaute in den Garten: Die Farben und Formen der Blumen, die Büsche und Sträucher, die Hecke vor dem Zaun, alles schien ineinanderzuwachsen. Bienen, Hummeln und Schmetterlinge flogen zwischen den Blüten hin und her. An der Hausmauer im wilden Wein tummelten sich die Wespen. Ich fühlte mich geborgen und geschützt – im Paradies.
Ich gehe in den hinteren Garten an die Westseite des Hauses, hier führen drei Glastüren hinaus auf die Terrasse – wir benutzten immer nur eine Tür, die mittlere, die anderen blieben geschlossen. Im Sommer standen zwei in Töpfe gepflanzte Olivenbäume und drei Zitronenbäume auf der Terrasse, an der Hauswand zwei schwere Wannen mit bunten Blumen und eine Holzbank mit einem Tisch und Stühlen, daneben ein großer Sonnenschirm. An der vorderen Ecke der Terrasse füllte Mama jeden Morgen eine flache runde Blechwanne mit frischem Wasser. Tagsüber setzten sich die Vögel an den Rand der Wanne, benetzten ihre Schnäbel oder badeten; auch unsere französische Bulldogge Mona stillte dort ihren Durst. Neben der Terrasse verläuft eine schmale Wiesenfläche, die zur Straße hin ein einfacher Bretterzaun begrenzt. An seinen Latten wuchsen Fliederbüsche hoch, die im Frühsommer weiß und hellviolett blühten. Um die äußerste Ecke des Grundstücks ist eine hohe Betonmauer errichtet zum Schutz vor einer möglichen Explosion des in den Boden eingelassenen Gastanks – eine aberwitzige Schutzvorrichtung und Mamas ewiges Ärgernis. Mit den Jahren überwucherten ein Brombeerstrauch, ein Blauregen, wilder Wein und Efeu die Mauer.
Ein Sommermorgen, Ferien! Kühler Schatten auf der Terrasse, Tau im Gras. Ich sammle wilde Erdbeeren, die im Blumenbeet an der Betonmauer wuchern, und fülle sie in eine Schüssel mit Joghurt. Schwarztee zum Frühstück, Eierspeise und Butterbrot. Die Tauben gurren.
Nach dem Frühstück mache ich einen Spaziergang. Die schmale brüchige Asphaltstraße bergab, an den Pferdekoppeln vorbei, hinunter zur kühlen schattigen Brücke am Bach. Im Gestrüpp, die Böschung hinunter, hatten Arno und ich unser Geheimversteck. Am Ufer des Baches spielten wir Robinson Crusoes Abenteuer nach – das eiskalte klare Wasser, die rutschigen Steine, kleine Fische und Flusskrebse, nasse Füße, Lachen; manchmal zu dritt mit Irma in Gummistiefeln durchs Bachbett, das Wasser in den Stiefeln quakte bei jedem Schritt: Frösche wir!
Der Bach schlängelt sich endlos durch die Wiesen, durch dichtes Gestrüpp und den Wald. Ich habe nur einmal versucht, seinem Lauf zu folgen, aber nach wenigen hundert Metern stand ich an, er war von dornigen Sträuchern zugewachsen, sie fraßen sich wie Ungetüme durch die angrenzende Wiese, auf der umgestürzte Bäume im wild wuchernden Gras lagen, dahinter, die Böschung hoch, schwieg mich der düstere Wald bedrohlich an. Ich traute mich keinen Schritt weiter und lief zurück zu dem mir vertrauten Weg, auf dem ich mich vor den Waldmonstern, die überall im Dickicht lauerten, halbwegs sicher fühlte.
Es war immer derselbe Weg, meine Bachrunde, eine kleine und begrenzte Welt, die ich jedesmal wie im Traum durchwanderte: von der Brücke über dem Bach, wo wir Quakfrösche und Robinson Crusoe waren, den sandigen Pfad durch die Wiesen hinauf ins Wäldchen, wo der Boden im Herbst übersät war von Eicheln, dann um die Kurve beim Jägerstand und den steilen Hang zwischen den Feldern hinauf bis zum höchsten Punkt, von wo aus man auf das Dorf blickte, weiter den langen Weg zwischen den Feldern hindurch bis zu einer schmalen Asphaltstraße, die mich wieder hinunter zum Bach führte. Ich überquere ihn auf einer kleinen Stahlbrücke, unter der das gurgelnde und plätschernde Rinnsal auf den Fluss zuläuft. Ein paar Autos stehen am Feldrand, sie gehören den Fischern, die versteckt am Flussufer sitzen. Ich folge der Straße aufwärts in Richtung Dorf. Auf der Anhöhe, in der Mitte der Straße schließe ich die Augen, breite die Arme aus und setze blind einen Fuß vor den anderen, nur ein paar Schritte, ein paar Meter, dann öffne ich die Augen wieder. Rechterhand biege ich in einen Feldweg und spaziere an den hinteren Wiesengrundstücken der Bauernhöfe entlang – alte Apfelbäume, verwitterte Holzzäune, Gemüsebeete, Scheunen –, dann zurück ins Dorf, die Hauptstraße hinauf zu unserem Haus.
Ich lege meine Hand an die Türklinke. Das alte gusseiserne Schloss hat einen Riegel, der nur von innen geschlossen werden kann, einige Zentimeter darüber ist ein modernes Schloss angebracht. Tagsüber sperrten wir nur das moderne Schloss auf und zu, abends schoben wir zusätzlich den alten Riegel vor – es gab in vierzehn Jahren keinen Einbruch.
Zu der Zeit als wir in das alte Schulhaus einzogen, trat man zur Tür hinein in einen schmalen dunklen Flur, von dem aus man links ins Esszimmer und rechts ins Wohnzimmer kam. Der Flur führte nach hinten zum Stiegenaufgang, und noch ein Stückchen weiter nach hinten linkerhand in die Küche, und über einen Nebenflur rechterhand zu Badezimmer, Toilette und Kellertür. Nach ein paar Jahren ließ Mama die Wände im Flur einreißen und Glastüren einbauen. Von da an war der Flur lichtdurchflutet. Die Glastüren standen immer offen, Wohnzimmer, Flur und Esszimmer verbanden sich zu einem einzigen großen Raum.
Über fünfzehn flache Steinstufen gelangt man an einem niedrigen Geländer aus Holz, das seinerzeit für die Schulkinder angebracht wurde, auf einen quadratischen Absatz unter einem hohen Fenster und um die Ecke vier Stufen hinauf in den ersten Stock. Oben angekommen, setze ich meine nackten Füße auf die alten quadratischen grauschwarzen und grauweißen Steinplatten, die mit offenen Fugen wackelig den Boden bedecken. Gleich gegenüber vom Treppenabsatz ging es ins Wäschezimmer, da türmten sich unsere Klamotten in offenen Regalen bis an die Decke, in zwei großen Körben sammelten wir Kochwäsche und Buntwäsche, auf dem Bügelbrett bügelte Mama ihre Blusen und, wenn es festlich wurde, die feinen Tischtücher und Stoffservietten. Nebenan war das Badezimmer, das gehörte Irma, Arno und mir; Mama und Papa hatten ihr Badezimmer im Erdgeschoß. Wäschezimmer und Badezimmer waren in früheren Zeiten Buben- und Mädchenklo gewesen. Gegenüber an der Wand des schmalen kurzen Flurs standen niedrige weiße Regale, in denen Mama Alben mit Babyfotos von uns dreien aufbewahrte und jede Menge Krimskrams. Über den Regalen hing ein großer Setzkasten an der Wand, den Irma, Arno und ich mit Steinen bestückten, die wir beim Spazierengehen sammelten; daneben lag die hölzerne Blumenpresse, in der wir Frühlingsblumen und bunte Herbstblätter pressten; auf einem Ständer saß unser rot-gelb-grün gefiederter Papagei – der sah richtig echt aus! Man musste einen winzigen Schalter an seinem Rücken zur Seite schieben und dann sagte man etwas, und er sagte es nach. Irma, Arno und ich machten das so lange, bis wir zu lachen anfingen, und dann machte der Papagei unser Lachen nach, und wir mussten noch mehr lachen, und er lachte auch, und so ging das immer weiter, und wir konnten schon gar nicht mehr, hielten uns die Bäuche vor Lachen, krümmten uns und schalteten ihn ab, weil es nicht mehr auszuhalten war.
Hinter dem Badezimmer öffnet sich der Flur in eine kleine Halle, in der eine schwarz lackierte hölzerne Sitzgruppe auf einem weißen Teppich stand. Eigentlich saß hier nie jemand, sie stand nur da, weil sie schön aussah und den Raum ausfüllte. Der Tisch und die Stühle und die Bank waren weich gepolstert und hatten lange dünne Beine. Manchmal fragten wir Mama, und dann lackierte sie jedem von uns den Nagel vom kleinen Finger mit ihrem roten Nagellack, und wir stiegen in Mamas Stöckelschuhe, setzten uns ihre Sonnenbrillen und die alten Hüte auf und nahmen auf der hohen Bank Platz. Wir tranken aus den feinen Porzellantassen von unserem Puppengeschirr heißes Wasser, in dem wir Zuckerwürfel auflösten. Wir spreizten unsere kleinen Finger mit den lackierten Nägeln ab und verrührten den Zucker. Wir verstellten unsere Stimmen und sprachen ganz hoch, weil wir feine Damen waren. Nach jedem zweiten Satz lachten wir laut auf, schlugen die Augen nieder und hielten uns die Hand vor den Mund.
Von der Halle führen links zwei Türen in die ehemaligen Klassenzimmer, geradeaus geht es ins Büro des Schuldirektors, ein kleines Zimmer, in dem Mama und Papa in den ersten Jahren auf einem improvisierten Bett schliefen, bis sie sich ein großes Doppelbett mit weichen Matratzen leisten konnten. Das stellten sie dann ins Klavierzimmer – so nannten wir das erste Klassenzimmer. Es ist groß und hat zur Straße hin drei hohe Fenster. Hier stand der kleine schwarze Flügel, der unserer Mutter von ihrer Mutter und dieser wiederum von ihrer Mutter geschenkt worden war. Er war das Hochzeitsgeschenk meines Urgroßvaters an meine Urgroßmutter. Sie, das arme Arbeiterkind, hatte davon geträumt, einmal Klavierunterricht zu nehmen. Er wollte ihr den Traum erfüllen und sparte sich die Raten für den Flügel vom Mund ab. Jahrzehntelang stand er in der Stadtwohnung meiner Urgroßeltern. Im zweiten Weltkrieg wurde die Wohnung bombardiert und der Flügel beschädigt, meine Urgroßeltern setzten ihn nach dem Krieg wieder instand. Außer meiner Urgroßmutter bekam auch meine Großmutter Unterricht an dem kleinen schwarzen Flügel. Später übersiedelte er in die Wohnung meiner Großeltern. Alle sechs Kinder wurden an ihm unterrichtet. Nachdem Mama und Papa geheiratet hatten, zog der Flügel mit ihnen in ihre gemeinsame Wohnung. In der alten Schule übten Irma und ich auf dem Flügel, Mama spielte zur Weihnachtszeit die alten Lieder auf ihm.
Neben dem Klavierzimmer war das Kinderzimmer, groß und hell, mit zwei Fenstern zur Straße und zwei in den hinteren Garten, an den Wänden drei Betten, überhäuft mit Kuscheltieren, vor den Fenstern drei Schreibtische, in der Mitte ein großer Holztisch mit bekleckster und zerkratzter Platte, eine Puppenecke und Schränke, vollgestopft mit Spielsachen.
Von der Halle im ersten Stock kommt man durch eine schwere Metalltür direkt auf eine steile Treppe hinauf zum größten und geheimnisvollsten Raum im ganzen Haus: der Dachboden! Ich ging nur in den Sommermonaten nach oben, dann war es dort warm und stickig. Durch winzige Fenster und Ritzen zwischen den Dachziegeln schien die Sonne herein und warf ihr Licht auf die kleinen Staubflusen in der Luft. Der Boden war nachlässig mit Ziegelsteinen und Styroporplatten ausgelegt. Überall standen staubige Kisten und alte, kaputte Möbel. Ich baute mir aus dem, was da war, eine eigene kleine Wohnung und spielte Hausherrin. Ich befehligte eine große Dienerschaft und kam bei der Organisation der Hauswirtschaft selbst kaum zur Ruhe. Lange hielt ich es auf dem Dachboden aber nie aus, in der heißen Luft fiel das Atmen bald schwer, und ich musste meine Dachwohnung jedesmal nach kurzer Zeit wieder verlassen.