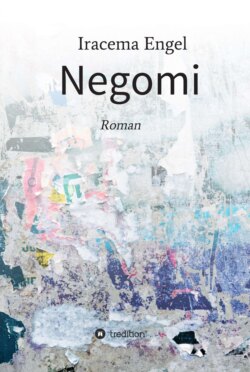Читать книгу Negomi - Iracema Engel - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление8
»Wir sollten heute wieder proben.«
»Ich kann leider nicht. Im Waldviertel ist ein Familientreffen. Es geht um eine ernste Angelegenheit. Ich fahre heute mit meiner Mutter hin. Bin morgen wahrscheinlich wieder zurück.«
»Ok. Alles Gute bei der Familiensitzung.«
»Danke.«
– Das war eine glatte Lüge! Ich muss mich verstecken! Sobald ich aus dem Haus gehe, könnte er mir über den Weg laufen! Es ist Vormittag. Jetzt kann ich noch raus. Wenn wir uns begegnen, sage ich, ich bin auf dem Weg zu meiner Mutter. Ja, Mamas Wohnung! Sie ist ja wirklich ins Waldviertel gefahren und kommt erst morgen zurück. –
Ich riss meine Handtasche vom Kleiderständer, stürzte aus dem Zimmer und aus der Wohnung, raste die Stufen hinunter, zwängte mich durch die schwere Eingangstür und sprang auf den Gehsteig. Ich machte große Schritte über das Kopfsteinpflaster, überquerte die Straße, eilte durch den Park an der Votivkirche vorbei. Vorne bei der Ampel musste ich stehen bleiben. Auf dem Zebrastreifen drängte ich mich zwischen den Entgegenkommenden hindurch und hetzte vor zur nächsten Kreuzung. Beim letzten Blinken des grünen Männchens sprang ich auf die Bordsteinkante und hastete zum Eingang der U-Bahn-Station. Ich übersprang jede zweite Stufe die Treppe hinunter in den Untergrund, lief durch die Schranke auf die Rolltreppe zu. Um mich herum Menschengedränge. Ich wechselte auf die linke Seite und rannte die Rolltreppe hinunter. Die U-Bahn in meine Richtung fuhr ein. Ich schob mich mit der Menschenmenge durch die U-Bahn-Tür. Kein Sitzplatz. Ich hielt mich an der grellgelben Stange fest. Hände über und unter meiner Hand, nasse Haut an meiner Schulter. Es ekelte mich. Ich hielt den Atem an.
Karlsplatz. Die Rolltreppe hinunter zur U1. Die U-Bahn-Türen öffneten sich. Hier waren weniger Leute, ich blieb trotzdem stehen. Die Bahn fuhr an. Je näher ich meinem Ziel kam, desto freier konnte ich atmen, desto weiter war ich schon von ihm entfernt.
Südtirolerplatz: Ausstieg rechts. Hinaus auf den Bahnsteig, die Treppe hinauf, durch die Schranken und hinaus auf die Straße. Nur noch zwei Häuserblocks! Meine Füße überschlugen sich fast. Endlich: das Portal mit den steinernen Löwen! Ich durchschritt das Tor – in Sicherheit! Ich sperrte die Eingangstür auf, das kühle Stiegenhaus nahm mich in Empfang, ich nahm jede zweite Stufe hinauf in den zweiten Stock, sperrte die Wohnungstür auf und trat ein. Alles war ruhig. Ich zog meine Schuhe aus und schlüpfte in Mamas dünne Filzpantoffel. Hier war mir alles vertraut. Und doch war ich hier nicht mehr zu Hause - war es nie wirklich gewesen, immer nur eine Zwischenstation. Jetzt lebte ich alleine, ausgeliefert. Hier war ihre Seele, ihr Geruch, hier konnte mir nichts passieren. An den Haken der Garderobe hingen Mamas dünne Sommermäntel. Die Tür in ihr Schlafzimmer stand offen. Ich legte mich auf das große Bett, zog die Knie an die Brust, stand wieder auf, ging ins Wohnzimmer, in der Mitte des Raumes blieb ich stehen. »Glück? Was wird mein Glück sein? Was für eine glückliche Frau soll aus der kleinen Antigone werden? – Es hat keinen Sinn!«
Ich ging in die Bibliothek: die lange Bücherwand aus Mahagoni mit ihren Regalen bis an die Decke, das Sofa, der Couchtisch, die durchgesessen Stühle mit ihrem abgewetzten Stoff, der alte Perserteppich, der schwere Schreibtisch mit seinen goldenen Knäufen, auf der leeren Tischplatte das Hochzeitsfoto: Mama und Papa sitzen nebeneinander vor einem Tisch, links und rechts von ihnen ihre Trauzeugen, hinter ihnen lange Sesselreihen mit den Festgästen; Mama trägt ein schlichtes weißes Kleid und schaut starr vor sich hin, Papa hat den Oberkörper zu ihr geneigt und lächelt selig.
Ich ging im Zimmer auf und ab. Ich wollte es aufschreiben, rausschreiben. In einer Schreibtischschublade fand ich Papier. Auf dem Tisch lag ein Bleistift. Kein Sessel da. Im Stehen begann ich, das weiße Blatt zu beschreiben. Sonst hatte ich durch das Schreiben auch immer Ordnung in meine Gedanken bringen können. Es war meine letzte Hoffnung. Meine Hand flog übers Papier. Die Buchstaben waren erst klein, wurden von Zeile zu Zeile größer und unleserlicher. Ich begann, mit dem Stift über das Geschriebene zu schreiben: Wörter über Wörter, meine Gedanken fingen wieder an, sich zu verwirren. Ich nahm den Bleistift in die Faust und hackte seine Spitze in das Papier. Die Mine brach. Mit einem Schrei schmiss ich den Stift gegen die Wand. »Ich will ihn nicht mehr sehen! Ich habe Angst vor ihm! Er kommt mir zu nahe! Er schnürt mir die Luft ab!« Meine Wangen waren tränennass, ich schlug mit den Händen gegen meine Stirn. »Ich liebe mich nicht! Ich hasse mich! Ich liebe ihn nicht! Ich hasse ihn!« Ich fiel auf die Knie, kauerte mich zusammen, krallte die Finger in die Schenkel und schrie – lautlos: die Wohnung war hellhörig. Der stumme Schrei quälte mich. Ich lief ins Badezimmer, schloss die Tür, stellte mich in die Duschkabine und ließ einen Schrei los. Er gellte und krächzte. Ich schrie lauter, lauter und immer lauter, bis meine Stimme versagte. Ich schlug gegen die Fliesen der Duschkabine, bis meine Hände bluteten. Ich heulte, wimmerte, flehte. »Lesen! Lesen schafft Ruhe!« Ich stolperte aus der Dusche, lief zurück in die Bibliothek und stellte mich vor das Bücherregal. »Was steht da für ein Buch? Mein Kampf!?« Ich zog es heraus und schlug es auf: Hitler schaute mich an. Ich schrie auf und warf das Buch auf den Boden. »Diese schrecklichen Augen, dieser wahnsinnige Blick!« Ich schrie und schrie. »Nein! Nein! Alles ist zerstört! Ich bin zerstört!« Ich sank auf den Boden und presste die Lider zusammen. »Der ganze Wahnsinn in dieser Wohnung, eine einzige Krankheit!« Ich sah alles wieder vor mir, war wieder da, an diesem schrecklichen Tag: Ich trete ins kühle Stiegenhaus, meine Kleider kleben an mir, mein Handy klingelt: Mama: »Negomi, bist du schon da? Irma hat nicht gut geklungen am Telefon. Sie hat gesagt, dass sie müde ist, aber nicht schlafen kann – sie arbeitet zu viel, und dann auch noch diese Hitze! Ich habe ihr gesagt, dass du ihr Schlafmittel mitbringst. Mach’ bitte noch den Abstecher zur Apotheke. Ich schicke dir den Namen des Medikaments per SMS. Es ist gut, wenn du bei ihr bist. Schau’, wie es ihr geht. Wenn irgendetwas ist, ruf’ mich an, dann komme ich mit dem Auto zu euch.«
»Ja, Mama, ist gut, bis dann!«
Ist Irma schon wieder am Durchdrehen, oder was? Dann will ich aber bitte nicht mit ihr alleine sein! Scheiße! Na gut! Ich atme die kühle modrige Luft tief ein und verlasse das Stiegenhaus, wieder hinaus in die Schwüle. Zum Glück ist die Apotheke gleich um die Ecke. Ich bekomme das Medikament, das Mama wollte, und rette mich zurück ins Stiegenhaus. Ich überspringe jede zweite Stufe hinauf in den zweiten Stock, sperre die Tür auf, öffne sie einen Spalt breit und horche: alles still! Ich trete ein. Wo ist sie? Die Tür zum Schlafzimmer ist geschlossen. Sie schläft jetzt also doch! Ich stelle meine Tasche bei der Garderobe ab und gehe in die Küche. Auf dem Tisch steht ein Teller mit Spaghetti, auf denen ein paar angetrocknete Lachsstücke liegen, eine Gabel steckt im Nudelberg. Ich hätte das Essen in den Kühlschrank geräumt, aber ich weiß ja, dass sie keine Ordnung halten kann. In der Spüle liegen Spaghettitopf, Nudelsieb, zwei Löffel und ein Fleischmesser. Der Topf ist bodenbedeckt mit Wasser gefüllt, am Innenrand klebt Nudelstärke. Ich nehme mir aus dem Schrank über der Spüle ein Glas, drehe den Wasserhahn auf und warte, bis das Wasser kalt herausläuft. Es kühlt und befeuchtet meinen trockenen Mund. Die Schlafzimmertür geht auf. Ich drehe mich um. Irma trottet herein. Sie trägt einen Pyjama, ihre Haare sind verstrubbelt, sie sieht müde aus.
»Hallo«, sie schlurft an mir vorbei ins Badezimmer und schließt die Tür. Ich höre, dass sie das Wasser in der Dusche aufdreht. Ich gehe ins Wohnzimmer, setze mich vor den Fernseher: Abendnachrichten, Normalität! Ich höre, dass Irma das Bad verlässt, durch die Küche in den Vorraum stampft und die Schlafzimmertür unsanft schließt. Ihr Handy klingelt, ich höre sie sprechen, sie schimpft: »Ich will nicht mit dir darüber sprechen! Ich habe andere, mit denen ich reden kann! Lass mich in Ruhe!« Sie reißt die Schlafzimmertür auf, knallt sie hinter sich zu, flucht laut und bolzt durchs Vorzimmer in die Küche. Ich höre sie Geschirr gegeneinanderschlagen. Mein Herz klopft, ich halte den Atem an, drehe den Fernseher ab: Kein Lärm mehr aus der Küche! Ich atme aus. Schau nach, was mit ihr ist!
Irma sitzt am Küchentisch und stochert mit der Gabel in den trockenen Nudeln. Ihre Haare sind nass. Sie hat ihren Pyjama wieder angezogen. Ich bleibe in der Tür stehen. Sie schaut mich kurz an und dreht das Radio auf.
»Willst du was?«, sie deutet auf die Spaghetti.
»Nein, danke, ich habe keinen Hunger.«
Sie zuckt mit den Schultern.
»Ist alles okay bei dir?«, frage ich.
»Die Leute sollen mich halt fragen, wenn sie was wissen wollen!«
»Wer soll dich was fragen?«
»Na, die Leute halt. Die beobachten mich, die im Büro, die schauen mich an und flüstern. Sollen sie mir sagen, wenn sie was wissen wollen!«, sie starrt vor sich hin.
»Ich geh’ dann wieder ins Wohnzimmer.«
Sie reagiert nicht.
Ich setze mich wieder aufs Sofa und schalte den Fernseher ein.
»Negomi! Die Marie will mit dir sprechen!«
Ich springe auf, laufe in die Küche. Irma hält mir das Handy hin.
»Hallo, Marie?«
»Ja, hallo, Negomi, was ist denn mit Irma los?«
Ich gehe schnell ins Wohnzimmer.
»Sie hat mich angerufen und mir gesagt, sie hätte mich im Radio gehört, dabei kann das gar nicht sein.«
Ich drehe mich um: Irma ist mir nicht gefolgt!
»Ja, Marie, es geht ihr nicht gut. Ich weiß auch noch nicht so genau, was los ist. Aber meine Mutter weiß Bescheid. Ich warte jetzt einmal ab, was passiert.«
»Brauchst du was?«
»Nein, danke, es geht schon.«
»Du kannst mich jederzeit anrufen!«
»Okay, bis dann!«
Ich gehe wieder in die Küche. Irma sitzt am Tisch, das Radio läuft, sie stochert in ihren Nudeln. Ich gebe ihr das Handy zurück.
»Geht es Marie eh gut?«
»Ja! Warum fragst du?«
»Sie ist halt manchmal ein bisschen komisch, und da mache ich mir dann Sorgen um sie.«
»Marie macht sich Sorgen um dich!«
»Nein, nein, Marie ist manchmal ein bisschen komisch, da mache ich mir dann Sorgen. Ich habe sie vorhin angerufen, weil sie im Radio war und mich gegrüßt hat, das hat sie schon einmal gemacht.«
»Marie war nicht im Radio!«
»Doch, doch, ich habe sie ja gehört«, sie lächelt und starrt auf die Nudeln, »Hast du das Schlafmittel?«
»Ja, in meiner Tasche«, ich springe ins Vorzimmer, krame die Medikamentenschachtel heraus, bin wieder in der Küche und halte Irma die Packung hin. Sie nimmt sie wortlos, steht auf, geht aus der Küche und schließt die Schlafzimmertür.
Hilfe! Hilfe! Sie ist total durchgedreht! Was soll ich tun?!
- Ganz ruhig, Negomi, ganz ruhig! Sie geht jetzt schlafen, das wird ihr guttun, morgen ist wieder alles normal.
Und wenn sie eine Überdosis nimmt?!
- Das sind nur Tropfen, Negomi! Komm, bleib ruhig. Schau dir einen Film an und entspann' dich!
Mein Handy klingelt: Wieder Marie!
»Hallo, Marie?«
»Irma hat mir ganz komische SMS geschrieben!«
»Lies vor!«
»Sie hat geschrieben: Ich mag Leute, die spinnen. Das zweite war: Alle spinnen. Und dann: Danke.«
»O, Gott!«
»Negomi, ich mache mir wirklich Sorgen.«
»Ich mir auch. Aber sie hat sich jetzt schlafen gelegt. Ich warte ab bis morgen.«
»Halte mich bitte auf dem Laufenden.«
»Mach’ ich!«
Die Schlafzimmertür fliegt auf, Irma stampft in die Küche. Ich laufe zu ihr. Sie steht vor dem Geschirrspüler.
»Schau! So schaltet man ihn ein! Du musst die Tür fest andrücken: So! Bis es klick macht! Dann den Hahn abdrehen und auf den Knopf drücken! Die Einstellung ist immer dieselbe!«
»Okay…«
»Ja, ich habe Lösungen für meine Probleme!«
Ich sage nichts, schaue sie nur an.
»Ja! Auch wenn das die Leute nicht glauben wollen. Ich habe Lösungen für meine Probleme. Ich habe die blöde Jalousie einfach abgerissen: So! Jetzt hängt sie nicht mehr schief! Die Leute sollen mich halt fragen, wenn sie was wissen wollen!«
Ich schweige.
»Ich geh’ jetzt schlafen!«, sie stampft aus der Küche und knallt die Schlafzimmertür zu.
Verdammt! Verdammt! Verdammt! Was mach’ ich jetzt!? Aufräumen! Die Küche aufräumen! Erst einmal die Küche aufräumen. Ja! Zuerst den Teller: Die Spaghetti und den Lachs in den Kübel: So! Geschirrspüler auf: Teller rein, das Besteck, den Topf, das Nudelsieb, die Löffel, das Messer. Tür zu. Okay, das sieht schon besser aus. Und als nächstes? Den Tisch abwischen! Zur Spüle, Wettex nehmen, Wasserhahn aufdrehen, Wettex unter den Strahl halten, Hahn abdrehen, Wettex ausdrücken, zum Tisch, gleichmäßig über die ganze Fläche wischen und die Brösel in die Hand fallen lassen. Gut, Negomi, das ist gut! Zurück zur Spüle: Hahn aufdrehen, Wettex abspülen, gut ausdrücken, Hahn abdrehen, Herd abwischen, Hahn aufdrehen, Wettex unters Wasser halten, Hahn abdrehen, Wettex ausdrücken, fest ausdrücken und neben die Spüle legen. Gut gemacht, Negomi! Die Küche ist sauber.
Ich schleiche ins Vorzimmer und schaue zur Schlafzimmertür: kein Licht: hoffentlich schläft sie jetzt! Und ich? Ich gehe ins Badezimmer und lege mich dann auch ins Bett. Licht aufdrehen, zum Waschbecken, Zahnbürste nehmen, Zahnpastatube aufschrauben, Pasta auf die Borsten, Mund auf, vor-zurück, vor-zurück, oben-unten, vorne, an den Seiten, Bürste raus, ausspucken, Wasserhahn aufdrehen, Mund ausspülen, Gesicht waschen, abtrocknen, ausatmen: Gut!
Im Wohnzimmer lege ich mich aufs Sofa und stelle den Wecker auf sieben: Da schläft Irma sicher noch.
Und was, wenn sie in der Nacht in mein Zimmer kommt und mich umbringt?
- Komm schon, red' keinen Unsinn! Schlaf jetzt!
»Guten Morgen!«
Ich schrecke hoch: Irma steht im Zimmer!
»Wie spät ist es?«
»Keine Ahnung!«, sagt sie fröhlich und geht aus dem Zimmer.
Ich schaue auf mein Handy: Es ist erst sechs! Irma schläft sonst immer bis Mittag! Ich springe auf und laufe in die Küche. Irma ist im Bad. Sie duscht. Ich renne ins Wohnzimmer und ziehe mich an. So, jetzt aufpassen, Negomi! Ich setze mich aufs Sofa und warte. Vor mir auf dem Tisch liegt ein Buch: Kronprinz Rudolf – Mythos und Wahrheit. Irma kommt! Ich tue so, als würde ich lesen.
»Was machst du da?«, herrscht sie mich an.
»Ich lese.«
Sie schlägt mit den Armen in die Luft und flucht: »So ein Mist!«
Ich erschrecke, »Was ist denn?«
Sie stampft mit dem Fuß auf und schreit mich an: »Ich will das nicht mehr!«
»Was willst du nicht mehr, Irma?«
»Keine Ahnung!«, sie schnaubt, »Sollen mich die Leute halt fragen, wenn sie was wissen wollen!«
»Ich frage dich doch!«
»Blödsinn!«, sie schaut stur zu Boden.
»Was sollen dich die Leute fragen?«
»Wurscht, vergiss es!«, schnauzt sie mich an.
»Nein, Irma, was ist los mit dir?«, ich lege das Buch beiseite.
»Nichts, lass mich in Ruhe!«
»Irma, du führst dich seit gestern absolut komisch auf! Wer hat dir was getan?«
»Lass mich in Ruhe! Das geht dich gar nichts an! Hör auf!«
»Nein, ich hör’ nicht auf! Was ist los mit dir?«
»Halt den Mund!«, sie dreht sich um und stampft aus dem Zimmer.
Ich springe auf und gehe ihr nach. Sie stampft durch die Küche ins Badezimmer und knallt mir die Tür vor der Nase zu.
»Irma, so geht das nicht! Hör auf damit! Sag’ mir, was los ist!«, schreie ich durch die Tür, »Ich werde so lange hier stehen bleiben, bis du rauskommst und mit mir redest!«
Sie reißt die Tür auf, bleibt stehen, schnaubt und stampft an mir vorbei – durch die Küche, ins Vorzimmer, zum Schlafzimmer und knallt die Tür zu. Ich reiße die Tür auf. Irma sitzt auf dem Bett. Sie hält ein Buch in der Hand.
»Ich weiß, dass du nicht wirklich liest!«
»Was?«, sie schaut auf und guckt unschuldig.
»Irma, sag’ mir endlich, was los ist. Das ist nicht komisch. Ich mache mir Sorgen um dich.«
»Lass mich in Ruhe!«, sie fetzt das Buch auf den Boden.
»Das ist nicht normal! Du redest wirres Zeug! Du schreibst Marie diese SMS! Du sagst, dass sie im Radio war, dabei stimmt das gar nicht!«
»Du sollst mich in Ruhe lassen! Geh raus!«, Irma steht vom Bett auf, stößt mich aus dem Zimmer und knallt die Tür zu.
Ich bleibe vor dem Zimmer stehen: »Rede mit mir! Warum bist du so? Was hab ich dir getan? Irma!?«
Ich öffne wieder die Tür. Irma sitzt mit verschränkten Armen auf dem Bett und schaut ins Leere.
»Irma! Ich halte das nicht mehr aus! Seit gestern mache ich die Hölle durch! Sag mir, was los ist!«, ich heule, meine Nase läuft, mit dem Handrücken wische ich mir den Rotz weg und in die Hose.
»Es ist die Arbeit. Ich komme mit den Leuten da nicht zurecht, die mobben mich.«
»Das tut mir leid, Irma, aber darüber kannst du doch mit mir reden.«
»Ja, ich weiß, aber mir ist das halt alles zu viel. Und dann hat mich Andreas belogen.«
»Andreas hat dich belogen?«
»Ja! Er hat mir gesagt, dass seine Großmutter gestorben ist, aber ich habe herausgefunden, dass das gar nicht stimmt. Seine Mutter ist in Wahrheit gestorben! Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll! Seine Mutter ist gestorben, und er sagt mir das nicht!«, sie weint.
»Irma, das tut mir leid. Kannst du mit ihm darüber reden?«
»Nein, das geht nicht! Ich kann über meine Gefühle nicht sprechen, ich kann das nicht! Warum hat Mama nicht gesagt, wie sie Andreas findet? Ich bringe meinen Freund halt mit zu meiner Familie, damit ich mehr über ihn erfahre!«
»Aber Irma, Mama mag Andreas doch! Er ist sehr nett. Es kommt ja nur darauf an, dass du glücklich mit ihm bist.«
»Man merkt doch, wenn ich zu Dr. Lindner gehe, dass es mir wieder schlechter geht. Sollen mich die Leute halt fragen. Ich weiß eben nicht, wie es anders geht, ich kann's nur so! Ich steh’ da vor dem Sarg und weiß nicht, was ich sagen soll! Die Leute schauen mich an, und ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll!«, sie heult, »Ich hasse es, wenn die Leute mich durchschauen!«
»Nein, Irma, es durchschaut dich niemand. Es gibt nur Menschen, denen du etwas bedeutest, und die sich Sorgen um dich machen: Marie, Andreas, Mama und ich.«
»Aber ich kann nicht über meine Gefühle reden!«
»Doch Irma, du tust es ja gerade«, ich setze mich zu ihr aufs Bett, rücke an sie heran und umarme sie. Sie drückt sich an mich. Wir weinen. Sie lässt mich los, »Ich bin müde.«
»Ja, ist gut, leg’ dich hin, ich lasse dich alleine«, ich stehe vom Bett auf, wir schauen uns in die Augen, »Ich hab’ dich lieb, Irma.«
»Ich dich auch.«
Ich setze mich im Wohnzimmer aufs Sofa. Plötzlich wird wieder die Schlafzimmertür aufgestoßen. Irma kommt ins Wohnzimmer. Sie hat eine Zeitung in der Hand, setzt sich neben mich, sagt nichts und liest.
»Irma?«
Sie reagiert nicht.
»Irma, was ist los?«
Sie schaut nicht auf, sagt: »Gar nichts. Ich lese Zeitung.«
»Ja, das sehe ich. Aber die Probleme, über die wir gerade gesprochen haben, die sind ja jetzt nicht gelöst.«
Irma schaut immer noch auf die Zeitung. Sie zuckt mit den Schultern und sagt: »Sollen die Leute mich halt fragen, wenn sie was wissen wollen.«
»Irma! Was soll das? Wir haben doch über alles geredet!«
Sie schaut auf: »Worüber haben wir geredet?«
»Ach, komm, Irma, das weißt du doch!«
»Ich weiß gar nichts«, sie feixt mich an.
»Irma, bitte, lass’ das.«
»Pfum!«, sie zieht mir die Zeitung über den Kopf.
»Hey!«, ich reiße ihr die Zeitung aus der Hand und ziehe sie ihr über den Kopf.
Irma streckt mir die Zunge heraus und singt: »Irma-Pipili, blöde Irma, Pipili!«, sie kichert und schreit: »Irma-Pipili, kacka Irma, Pipili!«, und läuft aus dem Zimmer.
»Irma!«, ich gehe ihr hinterher.
Sie knallt die Badezimmertür zu. Ich reiße sie auf. Irma steht vor dem Spiegel mit der Schere in der Hand und macht, »Zap! Zap! Zap!«, Haarbüschel fallen auf den Boden, sie schneidet und schneidet und schneidet, »Zap! Zap! Zap!«
Ich versuche, ihr die Schere zu entreißen, aber sie stößt mich weg, ich stürze zu Boden, knalle gegen die Badewanne, »Aua!«
Irma steht mit zerzackten Haaren vor mir, sie lässt die Schere fallen und fasst sich mit beiden Händen an den Kopf, »Die wachsen wieder nach! Die wachsen wieder nach!«, sie reißt an ihren Haaren, »Gerannt ist er, und es war Wind, und die Haare sind ihm davongeflogen. Gerade noch haben wir’s in den Laden geschafft. Da waren seine Haare fast alle schon weg. Eine Perücke, bitte! Papa, Papa! Eine Perücke, bitte!«
Das Fensterkreuz warf einen langen Schatten auf das Bett und über meinen Körper. Durch die schmutzigen Scheiben schien das dumpfe Orange der Straßenlampen.
Papa steht am Ende des Flurs und schaut uns nach. Er trägt die Mütze, die Mama ihm gestrickt hat, um die Glatze zu verdecken. Wir drehen uns im Gehen immer wieder zu ihm um und winken. Vor der Lifttür bleiben wir stehen und warten, winken ihm und winken, bis die Türen sich öffnen. Papa lächelt und hebt die Hand. Wir gehen. Er muss bleiben.
Papa, ich liebe dich! Komm zurück! Papa! Ich liebe dich! Komm zurück! Lass’ uns wieder zusammen sein. Du bist wieder da, ja? Sei wieder da! Das alles ist nie passiert. Keine Krankheit. Kein Dreißigster Dezember. Das Telefon läutet, und du sagst, dass es dir gut geht, dass du nach Hause kommen wirst. Nein, Mama, nein! Geh’ nicht ran, nicht abheben, nicht! Ich muss nur die Tür ins Schlafzimmer aufmachen, und du liegst auf dem Bett und lachst. Du wirst wieder gesund. Wenn man krank ist, wird man wieder gesund. Man stirbt nicht. Kein Telefon. Schneidet es ab, macht es kaputt! Ich will es nicht hören! Ich habe das alles nur geträumt. Schrecklicher Traum. Aber jetzt bin ich wach, und du bist wieder da, du lebst!
Du hast uns verlassen. Du bist einfach gegangen, und ich habe dich nicht einmal weggehen sehen. Wo bist du hin? Wie lächerlich: tot! Was ist das? Das ist doch Blödsinn, das stimmt doch nicht. Ich habe dir doch gerade eben noch die Schuhe zugebunden, weil du zu schwach warst. Es würde alles wieder gut werden, das war doch klar. Es würde alles weitergehen wie bisher. Ich bin deine liebe Negomi, wir sind eine Familie – das ist mein Leben! Auf einmal bist du weg, und ich schreie und heule und schlage um mich. Es stimmt nicht, es stimmt nicht, es stimmt nicht!
Seit du weg bist, ist in mir so eine Leere, und ich bin so wütend, dass ich nicht atmen kann. In meinem Kopf hängt Nebel, und ich muss die ganze Zeit weinen. Es sind schwarze Tränen, ein Strom, ein Meer aus Tränen, schwarze Wogen, die mich mit sich reißen und forttragen.
Ich würde gerne die Zeit zurückdrehen. Aber ich weiß gar nicht, wann ich dich jemals leiden konnte. Ich wollte immer bei Mama sein, du warst mir lästig, warst nur im Weg. Aber dann warst du auf einmal krank, und ich wollte lieb zu dir sein. Ich wollte dir sagen, dass ich dich liebhabe. Aber ich habe geglaubt, du willst das nicht. Jetzt tut es mir weh, dass ich es dir nicht gesagt habe. Das kann ich jetzt nie mehr tun.
Es gibt ein Begräbnis, es gibt Trauer, es gibt Tränen. Dein Sarg wird aus der kalten Halle in den kalten Nieselregen getragen. Ich gehe neben Mama hinter dem Sarg her. Auf einmal bleibt sie stehen, und Irma und Arno bleiben auch stehen. Ich will weitergehen, aber sie halten mich fest, und der Sarg verschwindet mit den schwarzen Trägern im Nebel. Der Trauerzug hinter uns löst sich auf in kleine Grüppchen, die gedämpft sprechen und sich langsam vom Platz zurückziehen. Da verstehe ich es auf einmal: Papa, du bekommst kein Grab, dein Körper wird verbrannt, und deine Asche wird Mama in einer Urne zugeschickt. Auch deine Urne bekommt keinen Grabplatz. Mama will das nicht, nicht einmal eine Gedenktafel mit deinem Namen auf dem Friedhof will sie. Sie stellt deine Urne in Heisendorf unter die Kellertreppe, dort wo du immer den Müll sortiert hast. Sie bringt eine kleine Lampe unter der Treppe an und legt eine Kunststoff-Rose neben die Urne. Ich komme dich manchmal da unten besuchen, ich knipse die Lampe an und knie mich auf den kalten, erdigen Boden vor die Urne. Da fühle ich mich dir ganz nah und ich spreche zu dir. Aber ich bleibe nie lange, weil mir zu kalt ist und der muffige feuchte Geruch mich schwindlig macht.
Das Fensterkreuz warf einen langen Schatten auf das Bett und über meinen Körper. Durch die schmutzigen Scheiben schien das dumpfe Orange der Straßenlampen. – Ich will die Welt nicht mehr sehen, ich will die Augen für immer vor ihr verschließen. Aber die Dunkelheit unter meinen Lidern macht mir Angst. Aus dem Fenster springen, sofort aus dem Fenster springen, ausgelöscht sein, mich auslöschen, Schluss machen, aus! –
»Was ist denn los, Schätzchen?«, Mama setzte sich zu mir ans Bett.
Ich bekam kein Wort heraus.
Sie wartete.
»Ich sehe in nichts mehr einen Sinn. Ich will mich umbringen.«
Sie schaute mich leer an. – Hört sie überhaupt, was ich sage? – Ich weinte, mein Körper war warm und schwer. Sie legte ihre Arme um mich und drückte meinen Kopf an ihre Brust.
– Mama! Mama! Rette mich! Ich will zurück an einen vergangenen Ort, in eine vergangene Zeit, ich will mich in deinen Armen verstecken, ich will in dir verschwinden, nicht mehr sein, ewig aufgehoben sein! –
»Das wird schon wieder, Schätzchen. Man sieht manchmal nur Finsternis, aber ich kann dir versichern, dass auch wieder die Sonne scheinen wird. Sich aus dem Fenster zu stürzen, hat keinen Sinn.«
»Aber ich kann nicht mehr!«
»Denke an die kleinen Dinge, die dir Freude bereiten. An denen kannst du dich aufrichten. Es gibt immer etwas, wofür es sich zu leben lohnt.«
»Es ist alles kaputt. Ich bin kaputt.«
»Denke an die Menschen, die dich lieben. Denke daran, was du ihnen antun würdest. Das würden sie niemals verkraften.«
»Mama, ich weiß nicht mehr, was mein Leben ist, ich habe kein Leben mehr, ich bin nicht mehr, nichts!«
»Morgen sieht die Welt schon ganz anders aus. Geh jetzt nach Hause, schlaf dich aus und ruf’ an, wenn du etwas brauchst.«
Ich lief in der Dunkelheit durch leere Straßen. Ein kühler Wind kam auf. Am schwarzen Himmel zuckten Blitze. Sie erleuchteten die Wolkenberge, aus denen der Donner über die Hausdächer rollte. Regentropfen prasselten auf mich nieder. Ich hielt mich am Geländer der Hohen Brücke fest und schaute hinunter in den Tiefen Graben. – Wie viele Meter sind es? Ich muss nur über das Geländer steigen und loslassen. Es wird ein harter Aufprall sein, aber da spüre ich dann schon nichts mehr. Eine junge Frau liegt mit gebrochenen Gliedern und zertrümmertem Schädel auf dem nassen Asphalt. Ihr Gesicht ist zerstört, man erkennt nicht mehr, wie sie ausgesehen hat. – Ich riss mich vom Geländer los und rannte davon, ich schlitterte über die nasse Straße, rutschte aus, fiel hin, rappelte mich hoch und rannte weiter: weg von der Hohen Brücke!
Felix öffnete die Tür, »Du bist ja ganz durchnässt!«, er führte mich über einen langen Flur nach hinten in ein Badezimmer, zog mir die Kleider aus, half mir in eine große Eckbadewanne und duschte mich ab: das warme Wasser brannte auf meiner Haut. Er hüllte mich in ein Badetuch und rubbelte mich trocken.
In seinem Zimmer gab er mir ein paar von seinen Sachen zum Anziehen. Er setzte mich aufs Sofa und wickelte mich in eine Wolldecke.
»Willst du darüber reden?«, er tippte die Zigarette gegen den Rand des Aschenbechers, »Es ist stickig. Ich öffne mal das Fenster«, er stand vom Sofa auf.
– Nein, geh’ nicht zum Fenster! Bitte! –
Klick, Klack: die Scharniere öffneten sich, mit einem Ruck war es getan: kalte Luft strömte ins Zimmer, ein Sog erfasste mich, ich krallte meine Finger ins Leder des Sofas, es kam mir vor, als wäre ich eine Feder: Unfähig, mich zu widersetzen, werde ich in den Abgrund gerissen. Aber eine Feder segelt durch die Luft, sie landet sanft auf dem Boden und schnell erhebt sie sich auch schon wieder in die Lüfte. Sie tanzt. Es ist ihr Element, die Luft, sie kann sich nicht den Hals brechen.
Felix' Handy läutete, »Oh, entschuldige, das ist meine Regisseurin, da muss ich rangehen!«, er ging aus dem Zimmer.
Ich versuchte, dem Sog zu widerstehen, ich wollte um Hilfe schreien, aber stattdessen stand ich auf und ging auf das Fenster zu. Es hatte aufgehört zu regnen. Ich hörte das Rauschen des abendlichen Verkehrs, ich sah die Lichter der Stadt, ich schaute nach unten in die Straße auf die bunten Reklameschilder, die parkenden Autos. Das weiße Licht der langen, schmalen Lampen, die an dünnen Drahtseilen über die Straße hingen, spiegelte sich in den Pfützen auf dem Asphalt. Die Ampel an der Kreuzung blinkte orange. – Was hält mich? Nur meine Angst vor dem Fall, vor der Geschwindigkeit, vor den Sekunden in der Luft, bevor ich aufpralle und am Boden zerschmettere. Dann ist alles aus. Es gibt mich nicht mehr. Alles vorbei. Ruhe. Es wird schön sein. Keine Angst! Tu’ es! Ich springe von der Klippe ab: Knallblauer Himmel, trockene Wärme, die Sonne strahlt. Es haben schon einige vor mir getan und andere warten hinter mir. Ich bin dran. Die Lehrerin hat gesagt, wir müssen uns mit voller Kraft vom Felsen abstoßen, um ein paar Meter nach vorne zu kommen, sonst fallen wir zu knapp an der Felswand hinunter. Es kommt mir vor, als wäre ich völlig wahnsinnig: Ich könnte sterben, im nächsten Augenblick, nur ein bisschen zu wenig Kraft beim Absprung, und ich schlage gegen den schroffen Stein. Aber ich tue es, keine Gedanken mehr: jetzt! Ich bin im freien Fall, ich spüre die Sekunden nicht, ich spüre die Zeit wie ein Loch. Die anderen haben alle Freudenschreie ausgestoßen. Ich versuche, mir Mut zuzurufen, aber heraus kommt ein kläglicher Schrei, wie von einem abgeschossenen Vogel. Ich durchstoße die Wasseroberfläche und spüre Kälte. Ich bekomme keine Luft. Es ist dunkel. Das Wasser drückt mich nach oben. Tropfen auf meinen Wimpern, ein Brennen im Körper. Der Felsen, von dem ich gerade abgesprungen bin, ragt weit über mir in den blauen Himmel. Ich sehe meine Mitschüler wie kleine Figuren da oben stehen und zu mir herunterblicken. Die Lehrerin im Wasser schaut mich leicht besorgt an, wahrscheinlich wegen meinem Schrei, aber sie merkt sofort, dass ich unversehrt bin. Ich schwimme zum Ufer, wo ein Mitschüler mich empfängt und mir den Weg über die spitzen Felsen nach oben weist. –
»So, das wär 's jetzt! Entschuldige, dass es so lange gedauert hat.«
Ich drehte mich zu Felix um.
»Negomi, was ist mit dir?«, er schloss das Fenster.
»Ich will nicht mehr leben!« Tränen liefen über meine Wangen. Er nahm mich ich seine Arme. Mein Kopf war schwer, ich wollte meine Augen nicht mehr öffnen, wollte in der Wärme seiner Arme verschwinden, nie wieder auftauchen, nur Ruhe, alles ruhig. Wie eine Puppe mit schwer beweglichen Gliedern zog er mich hoch und setzte mich neben sich. Ich wollte schlafen, nicht reden, nicht denken. Aber ich hatte Angst, ich hatte Angst vor mir selbst – ich hörte ihm zu.
»Ein Mensch, der sich das Leben nimmt, tut das nicht plötzlich, er ist einen weiten Weg bis dahin gegangen. Anfangs gibt es noch offene Türen, die zurück ins Leben führen. Aber dann gibt es den Punkt, an dem er alle Türen hinter sich zugeschlagen hat. Er hat keinen Lebenswillen mehr, er hat abgeschlossen, er hat keine Fragen mehr, es gibt nur noch den einen Gedanken und die Tat, das ist alles, woraus er am Ende besteht. Niemand kann ihn mehr aufhalten. Er ist ganz ruhig und selbstgewiss, er tut es einfach.«
»Ich denke nur daran! Das macht mir Angst.«
»Du brauchst keine Angst zu haben. Es ist alles in Ordnung mit dir. Du erlebst gerade etwas, das neu für dich ist: den Verlust von Sicherheit. Du hattest bis vor Kurzem ein klares Ziel vor Augen. Du hast dich mit deinem Ziel identifiziert und hast mit voller Kraft darauf hingearbeitet. Aber deine Wünsche haben sich nicht erfüllt, und jetzt stehst du plötzlich und vielleicht zum ersten Mal da ohne Ziel. Aber es ist nicht so schlimm, wie es dir vorkommt. Ganz im Gegenteil: es ist das Beste überhaupt, ohne Ziel zu sein. Du erlebst dich plötzlich ungebunden, zum ersten Mal bist du frei. Die Freiheit kann einem schon Angst machen und einen in eine Krise stürzen. Aber das ist nicht das Ende von allem: es ist der Anfang!«
»Aber, wenn ich nicht weiß, wer ich bin!«
»Das ist die Frage, die sich diejenigen gerne stellen, die eine Ausrede brauchen, um nicht leben zu müssen. Keine Sorge, davon sind wir alle hin und wieder befallen. Was wir sind? Wir sind banale Kacksis, einfach nur kleine Würmchen, die sich viel zu wichtig nehmen und glauben, dass sie Ziele brauchen, um lebendig zu sein. Aber Ziele festlegen heißt, sich selbst festlegen und das ist widernatürlich.«
»Aber was hat das Leben ohne Ziele für einen Sinn?«
»Das Leben hat keinen Sinn! Es hat weder Sinn noch Zweck. Es ist ein Nichts. Eine Leere. Das Feld der Möglichkeiten, die Wirklichkeit werden durch dein Tun. Nur du kannst dein Leben mit Sinn füllen: im Hier und Jetzt. Du bist die Regisseurin jedes Augenblicks! Das Leben will von dir gestaltet werden, es stellt dir eine Aufgabe, ein Rätsel: Erkenne dich selbst! Wer bist du? Du bist sicher nicht ein in die Zukunft projiziertes Ziel! Selbsterkenntnis findet nur in der Gegenwart statt. Und die ist nie abgeschlossen, sie ist immer neu, und du bist auch immer neu. Wir Menschen wandeln. – Ist es nicht wunderbar, was in unserer Sprache alles aufgehoben ist: Indem wir gehen – wir können immer nur gehen, vorwärtsgehen in der Zeit, die es ja eigentlich auch nicht gibt – ver-wandeln wir uns. Wir können nicht wissen, wo wir hinkommen. Folge deiner augenblicklichen Lust, dann verlierst du dich nie.«
»Aber ich habe Angst vor dem Tod.«
»Hat nicht, wer Angst vor dem Tod hat, Angst vor dem Leben? Warum sich vor dem Tod fürchten? Der Tod ist dein Freund! Vielleicht ist er der einzige Freund, den du je im Leben haben wirst. Er ist ein Wegweiser, eine Ermahnung. Er macht unser Leben erst kostbar. Die Endlichkeit zeigt uns den Wert jedes Augenblicks.«
»Ich will nicht sterben! Die Vorstellung, dass ich aufhöre zu atmen, macht mir Angst, dass ich nicht mehr denken kann, dass ich einfach nicht mehr da bin, tot in einem Sarg eingesperrt, ohne Luft, ohne Licht, viele Meter unter der Erde!«
»Negomi, Schatz, es gibt nichts Sinnloseres, als sich über den Tod bange Gedanken zu machen! Wenn er da ist, bist du nicht mehr da, und wenn du da bist, ist er nicht da. Was nach dem Tod kommt, wissen wir nicht, können wir nicht wissen. Das einzig Interessante ist das Leben.«
»Aber wo sind wir hier? Was ist das alles? Was ist das Leben?«
»Es ist dieser Augenaufschlag, es ist dein Atem, dein Herzschlag. Das Leben ist ein Geschenk. Nimm es an, sag’ Danke, sag‘ Ja, feiere es! Das Leben ist ein Abenteuer, ein Rausch, ein Fest!«
»Ich fühle mich so verloren, so nackt und hilflos.«
»Die größte Herausforderung im menschlichen Leben ist das Leben selbst. Sich dem Leben stellen, heißt, es mit all seinen Höhen und Tiefen anzunehmen und die Verantwortung für sein eigenes Tun zu übernehmen. Die meisten Menschen schwindeln sich durchs Leben. Sie lügen und betrügen und geben immer den anderen die Schuld für die Folgen ihrer eigenen Missetaten oder sie schieben dem Leben selbst die Schuld in die Schuhe. Das sind die lebenden Toten. Ihr Leben ist ihnen eine Last, sie haben sich zu oft gegen es verstoßen und verachten es dafür, dass es ihnen kein Glück gebracht hat. Das Einzige, was ihre Verachtung für das Leben übersteigt, ist ihre Angst vor dem Tod. Also klammern sie sich ans Leben, obwohl sie es eigentlich hassen.«
»Aber wofür lebe ich überhaupt, wenn ich am Ende sowieso sterben muss?«
»Wir Menschen tun immer so, als wüssten wir nicht, dass der Tod kommt. Dabei wissen wir es vom ersten Augenblick an, mit unserem ersten Atemzug wissen wir um die Endlichkeit unseres Daseins. Aber wir rennen unser Leben lang dem Tod davon, wir wollen ihn nicht wahrhaben. In dieser Flucht vergeuden wir unsere besten Jahre, wir gehen unachtsam mit uns um und mit den Menschen, die uns nahe sind. Wenn dann ein Nächster stirbt, sind wir wie vom Blitz getroffen, tief erschüttert und wissen nicht, wie uns geschieht. Wir bereuen, ihm dies und das nicht mehr gesagt zu haben, wir wünschen uns, dass wir ihn besser behandelt hätten, und wir verwünschen unser Dasein und schimpfen auf den Tod. Wir suhlen uns im Selbstmitleid und übersehen, dass der Tod uns in Wahrheit auf etwas hinweist, dass er etwas bedeutet, dass er nicht das böse Schicksal ist, das einmal über jeden von uns kommt. Der Tod sagt uns: Wisse in jedem Augenblick um mich und genieße jeden Augenblick, gehe achtsam mit deinem Leben um, aber koste es aus, lebe mit deinen Nächsten in Liebe und tritt mir am Ende mit offenen Armen und einem prall gelebten Leben entgegen.«
Ich wischte mir die Tränen weg, »Da stand der Sarg in der kalten Halle, ein rotes Tuch darüber geworfen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass da mein Vater drin liegen soll, sein toter Körper. Ich weiß nicht, ob ich ihn vermisse, ich weiß nicht, wie ich über ihn denken soll.«
»Die Toten bleiben in der Zeit zurück, sie sind in der Vergangenheit eingefroren. Man muss sie ruhen lassen, man muss sie vergessen und weitergehen. Eines Tages merkst du, dass da etwas ist, ein Gedanke, ein Bild, eine Erinnerung: das ist es, was von ihnen bleibt.«
»Aber was ist mit der Trauer und dem Schmerz?«
»Die Zeit heilt alle Wunden, wenn du nicht ständig in ihnen bohrst. Die Trauer ist einfach da, sie ist eine Naturgewalt. Sie überwältigt dich, aber sie geht auch wieder vorbei. Sie gehört zur Heilung.«
»Schaust du nie zurück? Hast du keine Angst?«
»Ich bin dem Tod begegnet, und seither weiß ich, dass ich keine Angst vor ihm zu haben brauche. Nach meiner Wiedergeburt habe ich mir zwei Dinge geschworen und ich halte mich an sie, jeden Tag: Ich schaue nicht zurück und ich werde zu mir selbst und zu allen anderen aus tiefstem Herzen heraus ehrlich sein, ich werde mir über alles Rechenschaft ablegen und meine Wahrheit immer aussprechen.«
»Wiedergeburt? Wann war das?«
»Ist jetzt zehn Jahre her, ein früheres Leben. Ich war damals im Erfolgsrausch. Eine Riesenrolle nach der anderen. Nur Lobeshymnen in den Zeitungen. Und fette Gagen! Aber in mir war eine Leere, die ich nicht anders zu füllen wusste als mit Alkohol. Ich lief im Hamsterrad. Der Erfolg schmeckte schal. Der Presserummel, die vielen Leute, die dir auf die Schultern klopfen und sich mit dir fotografieren lassen; die Neider, die nur darauf warten, dass du stolperst. Da war nirgendwo ein Mensch, nirgendwo Wärme. Ich habe mir das kalte Spektakel schön gesoffen. Hat natürlich nicht geklappt, und irgendwann fiel den Kollegen auf der Probe meine Fahne auf. Ich wurde unzuverlässig, hab’ den Regisseuren die Textbücher um die Ohren gepfeffert, bin auf Proben nicht erschienen oder mittendrin im Streit abgedampft. Und ich hab’s mir mit der feinen Gesellschaft auf den Premieren-Feiern verscherzt, mit den toupierten Damen mit ihren Brillant-Colliers, die sich auch noch einen umjubelten Schauspieler als Schmuckstück umhängen wollen. An einem Abend habe ich so einer den Champagner ins Dekolleté gekippt. In den frühen Morgenstunden fand ich mich wieder mit einer Flasche Wodka in der Hand irgendwo auf der Straße, lallend und kotzend, bin gestolpert und liegen geblieben in der Eiseskälte. Aufgewacht bin ich im Krankenhaus. Der Arzt hat mir gesagt, dass ich mich sehr bald umbringen werde, wenn ich so weitermache. Ich habe ihn einen Trottel genannt und bin weg, aber ich wusste, dass er Recht hatte. Ich stand also vor der Entscheidung, entweder mich totsaufen oder mit dem Alkohol ein für alle Mal Schluss machen. Irgendwie fand ich, dass es das nicht gewesen sein konnte, also machte ich einen kalten Entzug. Fünf Tage und Nächte lang hab’ mich in der Wohnung eingesperrt. Ich wäre fast dabei drauf gegangen. Ohne Essen, nur Wasser. Da stand der Tod vor mir und hat gesagt: Es ist noch nicht so weit, du sollst leben. Als ich da durch war, bin ich ins nächste Kaffeehaus und habe mir eine Suppe bestellt. Da saß ich, ausgezehrt und abgemagert, ohne Geld, ohne Ansehen, ohne Freunde, ich hatte alles verloren, und auf einmal breitete sich in mir ein Lächeln aus, und da war dieser eine Gedanke: Du kommst nackt und allein und du gehst nackt und allein und reicher wirst du niemals sein.«