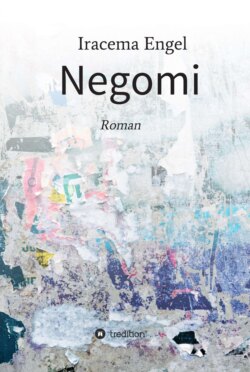Читать книгу Negomi - Iracema Engel - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2
Durch den weiß-schwarz bedruckten Vorhang strahlte das Licht des Morgens. Ich spürte die warme Decke, den weichen Polster und meine ausgeruhten Glieder. Felix? Ich richtete mich auf: die Polster und Decken drüben auf dem Sofa waren frisch aufgeschüttelt. Auf dem Boden vor mir lag ein handbeschriebenes Blatt Papier.
»Geliebte Negomi, Herzeleben, mein Sonnenschein!
Du schläfst so friedlich mit einem seligen Lächeln auf deinen Lippen.
Ich bin schon los, treffe mich mit meiner Regisseurin.
Aber ab ein Uhr habe ich frei.
Wollen wir uns dann im Café Korb treffen?
Funke mich kurz an, wenn du wach bist!
Ich küsse dich überall und Tausendmal,
dein Felix«
Ich schaute auf mein Handy: 10 Uhr. – Ha, Felix, diesmal werde ich zuerst da sein! – Ich sprang auf und raste ins Bad: duschen, Zähne putzen, Haare föhnen, schminken. Mit der Make-Up-Dose in der Hand guckte ich in den Spiegel: ohne Eyeliner und Wimperntusche wirkten meine Augen klein und unscheinbar, meine Haut war blass, unter meinen Augen zeichneten sich dunkle Ringe ab – schnell drüberschminken, ein bisschen Rouge auf die Wangen und ich sehe aus wie das blühende Leben!
»Du brauchst keine Schminke«, sagte plötzlich eine Stimme in mir.
»Wie bitte?«, fragte ich erstaunt.
»Felix findet dich schön, so wie du bist.«
»So wie ich bin!? Ich bin eine leichenblasse graue Maus! Das kann Felix nicht schön finden!«
»Felix liebt deine Seele«, sagte die Stimme.
»Das mag ja sein, aber es kommt sehr wohl auch auf das Äußere an.«
»Felix liebt deine Ausstrahlung.«
»Aber ich liebe mich so nicht! Ich finde mich so nicht schön.«
»Steh' zu dir! Riskiere es! Du kannst nur gewinnen!«
»Was soll ich bitteschön gewinnen?«
»Dich selbst!«
»Mich selbst?! Wer oder was bin ich selbst?«
»Das wirst du herausfinden, wenn du dich so lässt, wie du bist. Sei unverstellt!«
»Na gut! Ich mache es! Ich will mich so lieben, wie ich bin. Gut, gut, liebes graues Mäuschen, heute hältst du dein blasses Näschen ungeschminkt in den Wind!«
Auf dem Weg die regennasse und von grauen Wolken verdüsterte Straße hinauf ins Café Korb kam es mir vor, als würden mich die Menschen im Vorübergehen anstarren: »Wie sieht denn die aus?! Wieso schminkt sie sich nicht? Vielleicht wäre sie dann etwas weniger hässlich!«
Vor der Tür zum Café wollte ich kehrtmachen und zurück in die Wohnung, schnell an den Schminktiegel, mein nacktes Gesicht ungesehen machen, damit die Menschen sich nicht mehr ekeln mussten. – Ach komm’, da drinnen kennt dich doch niemand! Die interessieren sich nicht für dich. Die sehen dich einmal und nie wieder. Und Felix wird aus Liebe über deine Hässlichkeit hinwegsehen. Geh’ schon rein! – Ich hielt die Luft an, legte die Hand auf die Klinke, zögerte und öffnete mit dem Ausatmen die Tür.
Stimmengewirr, Lachen, Zigarettenrauch, Kaffeegeruch. Das Lokal war brechend voll. Ich stand in einem rechteckigen Raum, den man leicht überschauen konnte. Spiegelflächen an den Wänden mir gegenüber vergrößerten ihn scheinbar. In seiner Mitte saßen die Gäste dicht gedrängt auf Holzstühlen an einfachen Metalltischen. Sie tranken Tee oder Kaffee und rauchten. Manche nippten an einem Glas Wein oder prosteten sich mit Bier zu und schlugen Gabel und Messer in ein mächtiges Stück Fleisch auf ihrem Teller. Einige Tische waren mit weißen Tüchern bedeckt, die anderen standen nackt da. Den Gästen an den weiß gedeckten Tischen wurde Mittagessen serviert, denen an den blanken Frühstück. Ich hatte Appetit auf die süßen Strudel und Schokotorten, aber auch die Teller mit Schnittlauchbroten oder Marmeladesemmeln sahen verführerisch aus – dazu Spiegeleier mit gebratenem Speck oder ein weiches Ei! – Und was ist das? Zwei geschälte weichgekochte Eier in einer Glasschale! So etwas habe ich noch nie gesehen: ich ahnungsloses Landei! – In den Gängen zwischen den Tischreihen gingen mit großen schwingenden Schritten Männer in schwarzen Anzügen und mit schwarzen Fliegen an den weißen Hemdkragen hin und her. Sie balancierten voll beladene Tabletts. Zwischen ihren Fingern klemmten kleine weiße Zettel, die sie den Gästen zuschoben. Sie nannten eine Summe, fügten ein »Bitte« oder »macht das« hinzu, griffen, ohne hinzusehen, an ihre Hüfte und zogen eine dicke schwarze Ledertasche aus einem Beutel an ihrem Gürtel. Beim Aufklappen öffnete sich die Tasche wie eine Ziehharmonika. Der Gast zückte seine Geldbörse und nannte mit erhobener Stimme eine etwas höhere Summe. Der Mann mit der schwarzen Fliege machte eine leichte Verbeugung und nahm mit einem »Danke sehr« oder »Danke vielmals« das Geld entgegen. Er steckte die Scheine in die Falten der Ziehharmonika, warf die Münzen zu einem ganzen Haufen anderer in die breiteste Falte, zog in Windeseile ein paar Scheine heraus und kramte ein paar Münzen hervor. Der Gast nahm das Geld entgegen und nickte. Der Kellner verabschiedete sich, wünschte dem Gast einen schönen Tag und eilte zum nächsten Tisch mit hungrigen, durstigen oder zahlungswilligen Gästen.
»Gestatten Sie?«, sagte ein Mann.
Ich schreckte hoch und merkte, dass ich vor einem kleinen Tisch stand, auf dem Tageszeitungen ausgebreitet waren. »Oh, ja! Entschuldigen Sie!«, ich trat zur Seite.
Der Mann beugte sich mit prüfendem Blick über die Schlagzeilen des Tages.
Ich schaute wieder ins Lokal: alle Wände waren mit rot gepolsterten Bänken verbaut. Links von mir gleich neben dem Eingang waren ebensolche Bänke vor der Fensterfront zu Sitzkojen gruppiert. Die Gäste, die hier saßen, wirkten viel entspannter als die auf den Holzstühlen und den offenen Bänken. Sie thronten abgeschirmt auf den dicken Polstermöbeln und lehnten sich bequem zurück, schlürften an ihrem Tee oder Kaffee und blätterten gelassen in einer Tageszeitung. In einer der Kojen kicherten zwei Frauen und stießen mit Weingläsern an, in der dahinter unterhielten sich zwei Männer im Anzug mit gedämpften Stimmen, eine ältere Dame mit Hut schob eine Kuchengabel in den Mund und schaute mit abschätzigem Blick auf die Holzstuhlsitzer hinunter. Ich ließ auf der Suche nach einem freien Platz meinen Blick vom Polsteradel über das gemeine Holzstuhlvolk schweifen. Da sah ich weiter hinten rechts gleich bei der Vitrine mit den Mehlspeisen auf einer Polsterbank Felix' Jackett und seine große lederne Umhängetasche. Er musste sich hier mit seiner Regisseurin getroffen haben. Aber sie waren beide nicht zu sehen. Ich ging auf den Tisch zu, hatte Felix' Platz fast erreicht, da stellte sich mir ein Kellner in den Weg, »Kann ich Ihnen helfen?«
»Ja! Ich-«
»Wir haben im Augenblick keinen Tisch frei«, er versuchte mich wegzudrängen.
»Nein, ich-«
»Sie müssen später wiederkommen, wir haben jetzt Hochbetrieb.«
»Aber ich-«
»Negomi!«
Ich drehte mich um und schaute direkt in Felix’ strahlende Augen. Der Kellner musterte mich.
»Ist schon gut, Herr Otto, sie gehört zu mir«, Felix nahm mich sanft am Arm.
»Das habe ich nicht gewusst. Ich komme gleich zu Ihnen!«, er war um ein Lächeln an mich bemüht.
Ich ließ mich auf der Polsterbank nieder.
»Du bist zum ersten Mal hier, stimmt’s? Das Café Korb ist eines der letzten natürlichen Biotope der Stadt. Keine Touristenhorden! Es lebt von seinen Stammgästen. Das ist hier so etwas wie eine geschlossene Gesellschaft. Hier verkehren Schauspieler, Regisseure, Journalisten, Maler, Schriftsteller, Politiker: alles Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Man will gesehen, aber gleichzeitig in Ruhe gelassen werden. – Aber jetzt lass dich anschauen: gut siehst du aus, heute ungeschminkt! Das hab' ich mir schon längst bei dir gedacht, dass du das nicht brauchst, du bist eine natürliche Schönheit!«
Ich musste lachen. «Mein erster Freund auf dem Gymnasium, der Julian, hat das auch zu mir gesagt. Ich war damals in einer Mädchenclique, das waren echte Super-Tussis, die haben sich jeden Tag für die Schule hergerichtet, als würden sie in die Disco gehen oder viel eher auf den Klein-Mädchen-Strich.«
Felix machte große Augen, »Und das waren deine Freundinnen?«
»Ich war gar nicht so eine Tussi. Aber die Mädchen aus der Clique waren die Coolen, hinter denen waren die Jungs her, da wollte ich natürlich unbedingt dazu gehören. Wir waren die ersten, die sich Achseln und Beine rasiert haben: da waren wir elf! Julian mochte meine Tussi-Freundinnen nicht. Es gefiel ihm, dass ich nicht so aufgedonnert war wie sie.«
Der Kellner kam, »Was darf es sein, junge Dame?«
»Einen Caffè Latte und einen Apfelstrudel, bitte!«
»Machen wir gerne, junge Dame!«, er kniff ein Auge zusammen und lächelte schief.
Ich wusste nicht, was ich von seinem angestrengten Versuch, freundlich zu mir zu sein, halten sollte, aber ich war schon froh, dass er mich nicht mehr aus dem Lokal vertreiben wollte.
»Wieso mochten dich die Tussis, wenn du doch gar nicht so warst wie sie?«
»Keine Ahnung! Irgendwann wurde es mir aber zu blöd mit ihnen und ich habe mich von ihnen getrennt. Das Einzige, was ich aus meiner Tussi-Zeit mitgenommen habe, war das Schminken. Mit vierzehn, fünfzehn haben sich dann fast alle Mädchen in meiner Klasse geschminkt. Dafür musstest du nicht extra cool oder eine Tussi sein. Ein Mädchen ohne Schminke war nicht weiblich. Schminken ist meine tägliche Routine. Ich traue mich ohne Schminke nicht aus dem Haus. Ich habe meinen Schminkbeutel immer dabei und bin ständig besorgt, mein Make-Up könnte verblasst sein. Ich schminke mich nie stark, aber es ist ein echter Zwang.«
»Ich liebe dein Gesicht, so wie es ist, oder besser gesagt deine vielen Gesichter: du bist so bunt: ich kann mich gar nicht satt sehen an dir!«
Der Kellner brachte meine Bestellung, »Guten Appetit!«
Ich stach die Gabel in den Apfelstrudel und nahm den ersten Bissen: süß-sauer, bröselig und weich: ein Hochgenuss!
»Die ganzen Schönheitsnormen! So ein Blödsinn! Ich wollte aussehen wie die Models auf den Werbeplakaten! Verrückt!«
»Alle Menschen sind schön, außer sie haben hässliche Gedanken.«
»Ups! In einer Stunde beginnt meine Vorlesung!«, ich verputzte das letzte Stück Strudel und stürzte den Caffè Latte hinunter.
»Wir haben genug Zeit. Wir können gemütlich zum Campus schlendern.«
»Schlendern?«
»Schlendern! Gehe immer früh genug weg und genieße den Weg. Je hektischer die Menschen sich an dir vorbeidrängen, je lauter die Autos hupen, je aggressiver sie die Kurven schneiden, umso gemächlicher setzt du einen Fuß vor den anderen, schaust um dich und summst ein Liedchen.«
»Oh ja, das machen wir!«
Draußen strahlte uns die Sonne entgegen, keine Wolke war mehr am Himmel.
»Was hast du heute für eine Vorlesung?«
»Keine Ahnung! Die heißt Orientierungslehrveranstaltung.«
»Und keine Informationen dazu?«
»Nein! Die Homepage der Romanistik ist unübersichtlich und verwirrend. Das ist mit allem auf der Uni so. Die Universität ist ein Labyrinth! Ohne die Hilfe eines erfahrenen Studenten, weiß man nicht einmal, wie die Inskription funktioniert.«
»Das kann doch nicht sein!«
»Ist aber so! Mir hat mein Bruder geholfen, alle nötigen Anmeldungen zu machen. Ich saß neben ihm vor dem Computer, während er durch den Dschungel der Formulare navigierte, und habe nichts verstanden. Ich war nur froh, dass er das alles für mich erledigt.«
»Das ist ja unglaublich!«
»Es dauert sehr lange, bis man sich auf den verschlungenen digitalen Pfaden der Uni und auf der Uni überhaupt zurechtfindet, hat mir mein Bruder prophezeit. Man kommt nur über Umwege an Informationen, und die sind alle lückenhaft, eine Handvoll Puzzlesteine in einem Tausend-Steine-Puzzle. Man weiß immer zu wenig und ist sich nie sicher. Man muss vor allem viel fragen und dann herausfinden, welche der vielen Antworten, die man bekommen hat, überhaupt brauchbar sind. Da geht es einem so, als würde man eine Fremdsprache lernen, aber ohne Wörterbuch und Grammatik.«
»Das hört sich an wie aus einem sauschlechten Film.«
»Die Uni ist ein Phantom! Alle sprechen darüber, keiner weiß etwas. Nicht einmal die Angestellten scheinen eine Ahnung zu haben, für wen sie da eigentlich arbeiten und was sie da genau machen. Als angehende Studentin sucht man sich nach Gutdünken einen Fachbereich aus, weiß aber überhaupt nicht, was einen dann im Studium erwartet. Man wählt einfach den Titel, der am besten klingt: Psychologie, Philosophie, Afrikanistik … Die Entscheidung für einen Studienzweig ist das einzig Konkrete, von da an steht man vor einer undurchdringlichen Wand von Bürokratie. Es gibt Vorschriften und Termine und Fristen, aber niemand sagt einem, wo was wann stattfindet und welche Unterlagen man mitbringen muss. Wann und wo heute diese Vorlesung stattfindet und dass sie überhaupt stattfindet, weiß ich nur durch Zufall.«
»Warum spielst du dieses absurde Spiel mit?«
»Ich möchte Französisch lernen. Ich liebe die Sprache und das Land. Aber du weißt ja: die Uni ist für mich nur eine Zwischenlösung, bis ich den Einstieg in die Schauspielerei geschafft habe. Einstweilen sichert mir das Studium meinen Lebensunterhalt.«
»Wo müssen wir hin?«, fragte Felix am Eingang zum Campusgelände.
»Hof 7!«
»Und wie finden wir den?«
»Da ist ein Plan!«, auf einer Tafel an der Hauswand war das Campusgelände schematisch abgebildet: verschiedenfarbige Pfeile und Kreise und Zahlen verwiesen darauf, in welchem Gebäude sich welche Einrichtung befand.
»Ich hasse Pläne!«, sagte Felix.
»Hof 7, da! Gleich der übernächste!«
Wir traten unter dem Torbogen in einen kurzen Gang, der uns in einen quadratischen Hof führte. Ein schmaler Asphaltweg, von alten Kastanien gesäumt, zwischen denen Parkbänke standen, teilte den Hof und lief gerade auf den gegenüberliegenden Torbogen zu, der in die Fassade des spiegelgleichen Altbaus geschnitten war, aus dem wir unter dem Bogen hervortraten: weiß getünchte unebene Wände, niedrige Stockwerke, Fenster aus zierlichen Holzrahmen und dünnem Glas. Zwischen den Spiegel-Altbauten waren einander gegenüber spiegelgleiche langgestreckte Gebäude aus Glas und Stahl gebaut. Ihre Fensterfronten strahlten im Licht der Nachmittagssonne rosa-türkis.
»Und das war mal ein Spital?«, fragte ich Felix.
»In den Altbauten waren die verschiedenen medizinischen Abteilungen untergebracht. Man musste lange Strecken durch die Höfe zurücklegen, um einen Patienten vom Schlafsaal in den Operationssaal zu transportieren. Auch der Transport von Geräten, Lebensmitteln und was sonst gebraucht wurde, war sehr umständlich. Irgendwann war das einfach nicht mehr zeitgemäß, und die Stadtverwaltung errichtete einen monströsen Hochhauskomplex, in dem alle medizinischen Abteilungen untergebracht wurden: das Allgemeine Krankenhaus. Man sagt, es sei wie eine Stadt in der Stadt, ein riesiger Verwaltungsapparat, hundertmillionen Angestellte und noch mehr Patienten, alles auf engem Raum zusammengefasst. Der Bau des Spitals war von Korruptionsskandalen und finanziellen Fehlberechnungen begleitet: ein einziger Pfusch! Und der ist heute auch schon längst renovierungsbedürftig. Aber man kann an dem Gebäude nicht partiell etwas verbessern. Man müsste das ganze Monstrum abreißen und etwas Neues bauen.«
Links und rechts vom Weg waren kleine Wiesenstücke angelegt, auf denen überdimensionale grüne Plastikklötze als Sitzgelegenheiten bereitstanden. Trotz der herbstlichen Kühle lagen einige Studenten darauf, tranken Kaffee und lasen in Büchern oder Skripten.
»Ich fand die immer schon schrecklich. Sie sind hässlich und unbequem. Man weiß nicht, ob man auf ihnen liegen oder sitzen soll, das Plastik ist hart und immer dreckig – aber das ist modern«, sagte Felix.
Auf einer der Parkbänke unter den Kastanien saß händchenhaltend ein Liebespaar: er war über den leuchtenden Bildschirm des Smartphones in seiner freien Hand gebeugt, sie stierte auf das Smartphone in ihrer freien Hand.
»Glaubst du, die schreiben sich gerade gegenseitig?«, fragte ich Felix.
»Kann schon sein, aber viel Spaß scheinen sie dabei nicht zu haben.«
Ich blieb vor ihnen stehen und prustete ein herzhaftes »Hatschi« vor ihre Füße. Die beiden starrten regungslos auf ihre Handys, als wären sie von einer schalldichten unsichtbaren Glocke umgeben. Ich zuckte mit den Schultern, Felix kicherte, wir spazierten weiter.
Der nächste Hof war weitläufig angelegt. Lange, von Ahornbäumen gesäumte Kieswege durchkreuzten breite Rasenflächen, auf denen alte Fichten in den Himmel ragten und mit ihren ausladenden Ästen lange Schatten auf das Gras warfen.
»Sind wir hier richtig?«, Felix deutete auf die Geländetafel an der Hauswand.
»Ja, das ist Hof 7. Jetzt müssen wir nur noch das Gebäude A12 finden. Auf dem Plan ist es nicht eingetragen.«
Wir drehten eine Runde durch den Hof, gingen an unzähligen verschlossenen Türen vorbei, neben denen auf Schildern Zahlencodes und Buchstabenkürzel standen, aber keine Aufschrift A12.
»Das kann doch nicht wahr sein!«, sagte Felix.
Da öffnete sich eine Tür an der nächsten Ecke, aus der Studenten nach draußen drängten, es wurden immer mehr und mehr, bestimmt hundert strömten in den Hof.
»Aus welcher Vorlesung kommt ihr gerade?«, fragte ich eine Studentin.
»STEOP Literaturwissenschaft Französisch«, antwortete sie und ging weiter.
»Die sollte doch erst in zwanzig Minuten beginnen!«, sagte ich laut.
Niemand antwortete, keiner nahm von mir Notiz.
Felix und ich gingen zu der Tür, aus der die Studenten gekommen waren, um nach A12 zu schauen, aber auf dem Schild standen ganz andere Zahlen und Buchstaben.
»Was soll ich jetzt tun?«
»Wir gehen nächste Woche genau eine Stunde früher genau zu dieser Tür«, sagte Felix.
»Aber das ist doch alles völlig falsch!«
»Wir können es nur versuchen.«
Wir kamen zur Wohnungstür herein, die Kuhglöckchen schlugen gegen das alte Holz und läuteten penetrant.
»Sag mal, Felix, was sollen die eigentlich?«
»Das ist Pauls Alarmanlage.«
Aus der Küche war Radiomusik zu hören, es roch nach gebratenem Fleisch, nach Zwiebeln und Gewürzen.
»Hallo!«, rief jemand hinter der verschlossenen Küchentür.
»Das ist Paul!«, Felix ging voran in die Küche.
Umgeben von Dampfschwaden stand ein großer Mann in kariertem Hemd am Herd und rührte in einem riesigen Edelstahltopf, »Hallo, ihr zwei! Ich habe für uns gekocht. Schmeckt euch orientalisch? Das Essen ist gleich fertig! Setzt euch und trinkt schon mal ein Glas Wein. Mein Chef hat mich angerufen, holt mich direkt aus der Kur: Notfall! Eine Kollegin musste in Frühkarenz, und einer meiner Kollegen ist mit dem Motorrad gegen einen Baum gefahren«, er wischte sich die Hände mit einem Geschirrtuch ab und reichte mir die Hand, »Negomi! Habe ich es richtig ausgesprochen? Ein sehr ungewöhnlicher Name. Den habe ich noch nie gehört. Wollt ihr Rotwein oder Weißwein?«
»Für mich keinen Wein«, sagte Felix.
»Was!? Warum denn nicht?«
»Ich bin seit zehn Jahren trocken!«
»Alle Achtung, gratuliere! – Aber du trinkst schon einen Wein, Negomi! Setzt euch doch!«, Paul stellte zwei Gläser Rotwein auf den Tisch, »Aber noch nicht trinken! Erst, wenn ich das Wasser dazugestellt habe«, er ging zur Spüle und drehte den Wasserhahn auf, »Das rinnt jetzt erst mal eine ganze Weile – die alten Leitungen!«, er verdrehte die Augen und ging wieder an den Topf, »Mein Chef dreht jetzt total durch! Brummt mir schon wieder Überstunden auf! Ich komm’ in den nächsten Wochen gar nicht mehr aus dem Büro! Aber er weiß, wie er mich rumkriegt: ich bin sein bester Mitarbeiter, nur auf mich kann er sich verlassen und so. Ich sag’ ihm eh immer, er muss mehr Leute einstellen, aber dafür ist nicht genug Geld da, sagt er dann. Aber jetzt ist's bald wirklich genug, sonst kann er mich im Spital besuchen!«, mit einem riesigen Schöpflöffel füllte Paul eine klumpige Brühe in tiefe Teller und stellte sie neben kleine Reisschalen auf ein Tablett, das er zum Tisch trug, »Haut rein!«, er setzte sich uns gegenüber vor den dampfenden Teller.
Ich tauchte den Löffel in die Brühe, die jetzt eher wässrig aussah. Auf ihrer Oberfläche schwammen große rote Fettaugen, darunter lagen dicke Wurststücke, kleine gelbe Kügelchen, grobe Stücke grünes Schotengemüse und würfelig geschnittene Kartoffeln. Beim ersten Bissen brannten mir Salz und Schärfe auf Zunge und Gaumen.
»Und?«, Paul schaute mich gespannt an.
»Mhh!«, ich verzog das Gesicht zu einem Lächeln.
Paul schaute zu Felix hinüber, der auch »Mhh!« machte und nickte.
Pauls Wangen liefen rot an, er beugte sich über seinen Teller und löffelte ihn, ohne abzusetzen, leer.
Ich steckte mir den Löffel ein zweites Mal in den Mund und biss auf ein zähes Stück Wurst, dessen harte, glatte Haut zwischen meinen Zähnen quietschte. Im Augenwinkel sah ich, wie Felix den Löffel langsam an den Mund führte und große Kaubewegungen machte.
»Ah, jetzt müsste das Wasser kalt sein!«, Paul eilte zur Spüle, füllte drei Gläser, stellte sie auf den Tisch, nahm seinen Teller, füllte ihn beim Herd wieder auf, kam zum Tisch zurück, erhob sein Weinglas und sagte, »Auf ein gutes Zusammenleben in der alten Bruchbude!« Wir stießen an.
Ich nahm einen kleinen Schluck: der Wein schmeckte sauer und wässrig. Paul leerte sein Glas in einem Zug und schenkte sich gleich nach, »Jetzt werd' ich meinem Chef einfach einmal einen Zettel auf den Schreibtisch legen, auf dem alle meine Überstunden aus diesem Jahr aufgelistet sind. Die Liste füllt sicher sein ganzes Büro. Und dann soll er sich einmal Gedanken machen!«
Ich hatte meinen Teller halb geleert: meine Zunge brannte, meine Geschmacksnerven waren verätzt. In der Hoffnung auf Linderung nahm ich einen Löffel Reis, aber zwischen die Zähne bekam ich einen trockenen Klumpen, der nicht half, Salz und Schärfe zu neutralisieren. Ich sah, dass Paul mich beobachtete, also würgte ich die Kaumasse hinunter und versuchte ein Gespräch anzuleiern: »Was arbeitest du eigentlich?«
»Ich bin Sachbearbeiter für Schadensfälle in einer Versicherung«, Paul klopfte gegen seine Brust, »Da, das bin ich!«, von einem laminierten Plastikschild an der Brusttasche seines karierten Hemdes schaute mich aus einem kleinen Portraitfoto ein ernster Paul mit kurzgeschorenen Haaren an, »Im Juni hab' ich mein fünfzehnjähriges Jubiläum gefeiert. Da haben mich die Kollegen überrascht mit Sekt und Brötchen, und der Chef hat eine Rede gehalten. Ich bin einer von denen, die am längsten dabei sind, sogar der Chef ist nur drei Jahre länger als ich in der Firma. Ich leite ja jetzt auch schon seit zwei Jahren ein eigenes Team. Und wenn dann im nächsten Herbst der Chef eine Ebene aufsteigt, werd' ich mich für seinen Job bewerben. Da steh' ich dann nicht mehr zehn Leuten vor, da ist es dann die Arbeit von achtzig Mitarbeitern, die ich koordiniere. Aber es ist nicht so, dass ich von dem, was ihr da macht, nicht auch was verstehen würde. Ich habe auch Schauspielunterricht genommen, früher, da war ich sechzehn. Bei der Susi Nikoletti. Und als Kind hab' ich Ballett getanzt, bin sogar einmal mit dem Nurejew aufgetreten – in der Staatsoper! Die Nikoletti hat jeder gekannt. Sie hat ja auch viele Filme gemacht. Zu der sind wir alle gerne hingegangen, wir von der Balettschule. Ein paar haben dann auch weiter gemacht als Schauspieler. Über mich hat die Nikoletti gesagt, ich sei sehr begabt, aber zu schüchtern. Das war auch nicht meins, aber interessant war's schon. Angefangen habe ich mit dem Ballett, da war ich sieben, und aufgehört hab' ich mit achtzehn. Mein Vater wollte, dass ich Ingenieur werde, so wie er«, Paul verstellte seine Stimme: »Ein echter Mann trippelt nicht in Strumpfhosen über eine Bühne und macht dabei weibische Verrenkungen«, er räusperte sich, »Das hätte sowieso keine Zukunft gehabt, so gut war ich nicht. Das war schon richtig so, wie mein Vater das wollte. Ich habe dann eben Maschinenbau studiert«, Paul zog eine Packung Weiße Marlboro aus der Brusttasche seines Hemdes und zündete sich eine an, »Hat es euch nicht geschmeckt? Ihr habt ja beide die Hälfte übriggelassen! Bei dir verstehe ich das ja: du bist eine Frau, Frauen essen nie viel. Aber bei dir, Felix? Du bist dünn, viel zu dünn! Und du genauso Negomi: dir täten ein paar mehr Rundungen sicher auch gut – als Frau. Ich stell’ es euch kalt. Und deinen Wein hast du auch nicht getrunken! Na, auch typisch Frau, die wollen die Kontrolle nie verlieren«, er zwinkerte Felix zu.
»Das ist auch besser so!«, entgegnete dieser, »Mit Alkohol sollte man sich wirklich nicht einlassen. Einmal abhängig, kommt man sehr schwer davon los. Ich hätte mich fast umgebracht mit dem Gift.«
Paul schaute Felix groß und ernst an: »Ja, da hast du Recht. Ich schütte ihn in die Flasche zurück, wollte das Glas jetzt einfach auch noch trinken, aber das lass' ich dann doch besser sein.«