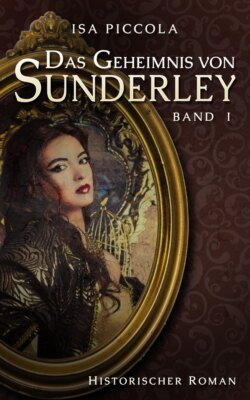Читать книгу Das Geheimnis von Sunderley - Isa Piccola - Страница 10
5
ОглавлениеAls die letzten Gäste gegen zwei Uhr morgens Stonehall verlassen hatten, sank Vater offensichtlich erschöpft in einen Sessel im Grünen Salon.
Solche Empfänge wurden mit den Jahren immer anstrengender für ihn. Ich mußte feststellen, daß er in der Zeit, während der wir uns nicht gesehen hatten, merklich gealtert war. Immer mehr Silberfäden durchzogen sein dunkles Haar, und die Linien um die Augen und auf der Stirn waren tiefer geworden.
Ich setzte mich zu ihm, nachdem wir meine Tante für die Nacht verabschiedet hatten. Sie litt, so sagte sie, unter entsetzlichen Kopfschmerzen. Die Bediensteten waren angewiesen, zumindest die große Halle, die zum Ballsaal umfunktioniert worden war, noch aufzuräumen. Wir wollten nicht am nächsten Morgen mit diesem Durcheinander konfrontiert werden. Schließlich wurden sie dafür bezahlt, und nicht zu knapp, wie ich Vater kannte.
Vater ließ uns einen Tee bringen und das Feuer im Salon erneut entfachen. Ungeduldig wartete ich, daß das Dienstmädchen endlich wieder den Raum verließ. Ich hatte Vater viel zu erzählen und noch mehr zu fragen. Nachdem wir allein waren, begann ich also ohne Umschweife:
„Vater, es ist schön, wieder hier zu sein. Ich hätte nicht gedacht, daß wir noch einmal hierher zurückkehren würden. Ich fühle mich… ja, ich fühle mich heimisch, obwohl ich noch ein Kind war, als wir fortgingen. Aber nun sage mir bitte endlich, warum ihr vor sechs Jahren so plötzlich Paris verlassen habt. Ich war sehr überrascht, als ich deinen Brief bekam. Ich hatte ja gerade erst meinen Dienst bei der Marine angetreten, und dann kam diese Neuigkeit! Du hast nie etwas über die Gründe schreiben wollen, und wir haben uns seitdem nicht mehr von Angesicht zu Angesicht gesehen. Bitte, sage mir, was geschehen ist.“
Vater seufzte tief, als ob eine schwere Last auf seiner Seele liege, die er nicht unbedingt teilen wollte. Schließlich sagte er scheinbar leichthin:
„Louis, der Grund ist ganz einfach. Es gefiel deiner Tante nicht mehr in Paris. Ihr bekam die Luft in dieser großen, schmutzigen Stadt nicht. Da gab es nur die eine Möglichkeit. Wir beschlossen, wieder nach Hause zurückzukehren.“
Etwas an seinem betont unbeschwerten Ton gefiel mir nicht. Ich war es gewohnt, Dinge zu hinterfragen, und gab deshalb nicht so schnell nach.
„Aber wieso hat sie es zuvor über fünfundzwanzig Jahre dort ausgehalten? Weshalb kam euer Entschluß so plötzlich? Noch in den Monaten, bevor ich fortging, ging es ihr ganz ausgezeichnet. War es wirklich so unerträglich für sie, daß ihr all unsere Freunde und die Annehmlichkeiten des Lebens in einer Weltmetropole einfach aufgeben konntet?“
Er nickte und sagte:
„Freunde findest man überall. Auch du wirst neue Bekanntschaften machen und vielleicht deine alten Freundschaften wieder aufnehmen. Aber die Gesundheit meiner Schwester ist mir heilig. Sie litt unter der Enge und dem Schmutz, ihr fehlte die Natur, die frische Luft. Mir selbst ging es ähnlich, Louis. Und du weißt doch, daß wir seit Generationen an das Landleben gewöhnt sind. Es ging einfach nicht mehr, glaube mir.“
Ich weiß nicht, warum, aber ich konnte ihm nicht ganz glauben und sann über das Gesagte nach. Plötzlich kam mir eine weitere Unstimmigkeit in den Sinn. Er hatte von Freunden gesprochen. Doch über den Verlust eines sehr teuren Freundes war ich sehr betrübt:
„Weißt du, was ich mich auch all die Jahre gefragt habe? Was ist aus meinem Freund François geworden? Seit damals habe ich nichts mehr von ihm gehört.“ Ich zögerte einen Moment, der Gedanke, der sich mir förmlich aufdrängte, erschien geradezu absurd. „Hat eure Abreise etwas mit ihm zu tun?“
Vater wand sich sichtlich und suchte nach Worten.
„Nein, mein Sohn. Es… war wirklich nur das Klima. Du weißt, jahrelang kann man an einem Ort leben, und plötzlich … So war das auch bei deiner Tante. Frage sie doch morgen früh selbst.“
Er lächelte, und ich wußte, daß ich in diesem Moment keine weitere Auskunft erhalten würde. Ich versuchte, die etwas angespannte Atmosphäre durch eine belanglose Frage aufzuheitern:
„Was denkst du über unsere Nachbarn, diese Familie Devane?“
Ich sah Vater gleichsam an, wie er sich entspannte. Er schien froh zu sein, daß ich nicht weiter in ihn drang. Gleichzeitig ahnte ich auch, daß es nicht mehr viel gebraucht hätte, um das zu erfahren, was ich wissen wollte. Aber nun war es zu spät. Vater nahm die Gelegenheit wahr und äußerte sich ausführlich zu unserer neuen Bekanntschaft:
„Nun, die Devanes sind recht angenehm. Ich kann mir nicht erklären, weshalb wir nie Kontakt mit ihnen aufgenommen haben… Die Eltern haben anscheinend auf eine gute Erziehung der Töchter Wert gelegt. Die jüngere ist zudem ausgesprochen hübsch. Du bist anscheinend derselben Meinung, mein Sohn, sonst hättest du ihr keine drei Tänze geschenkt.“ Ich runzelte leicht die Stirn, denn ich fühlte mich ertappt. Vater lächelte wissend. „Jaja, mein Junge, ich habe genau mitgezählt - oder vielmehr deine Tante. Sie hat mir von jedem erneuten Tanz etwas konsterniert berichtet. Sie hätte dich lieber mit einer der anderen Damen gesehen, die eher deiner gesellschaftlichen Stellung entsprechen… Die ältere Tochter – Elizabeth heißt sie, glaube ich? - ist etwas rundlich... und anscheinend etwas scheu, denn ich habe sie nach der Begrüßung nicht mehr gesehen. Wo mag sie nur abgeblieben sein?“
Ich tat, als ob ich angestrengt nachdachte, doch meine Gedanken waren eigentlich woanders. Ich spürte, daß mir ob der Beobachtung meiner Tante das Blut in den Kopf schoß. Sollte ich Helena Devane wirklich zu viel Aufmerksamkeit gewidmet haben? Daher antwortete ich beiläufig:
„Ich weiß es nicht, Vater, ich habe nur die Eltern und eine Tochter kennengelernt. Gibt es demnach eine zweite?“
„Ja, Elizabeth, die Ältere.“
„Ah ja. Jedenfalls macht Helena ihrem Namen alle Ehre. Sie ist außergewöhnlich schön und weiß, diese Schönheit zur Schau zu tragen. Aber... du sagst, die andere Tochter war rundlich? Und auch ungewöhnlich groß?“ Vater nickte. „Ja, ich erinnere mich... da gab es noch eine andere junge Dame, eben eine rundliche, große. Als ich eintrat, war sie die erste, die ich sah. Sie saß in einer Ecke gegenüber dem Eingang. Unsere Blicke trafen sich kurz. Aber auch sie habe ich später nicht mehr gesehen.“
„Vielleicht war es Elizabeth? Trug sie ein schwarzes Kleid?“
Ich überlegte kurz.
„Ja! Oh… Eine auffällige Farbe für eine junge Dame auf einem Ball. Das wird sie gewesen sein… Nun, wir werden sie mit Sicherheit noch öfter sehen. Vielleicht nehmen wir in den nächsten Tagen die Einladung von Mrs Devane an und besuchen Sunderley?“
Vater lächelte sein undurchdringliches Lächeln. Ich wußte in diesen Fällen nie, was er wirklich dachte oder meinte.
„Wenn du es möchtest. Wir können gleich morgen einen Ausritt machen, damit du die Umgebung wieder kennenlernst. Schließlich warst du noch ein Kind, als wir nach Paris gegangen sind. Du wirst dich nicht mehr erinnern, oder? Das Haus der Devanes ist nicht weit entfernt.“
Ich stimmte zu. Vater hatte recht, meine Erinnerungen an das Haus und die Umgebung waren nur sehr vage. Ich war gespannt, ob ich dennoch einzelne Orte wiedererkennen würde.
Wir schwiegen eine Weile und jeder hing seinen eigenen Gedanken nach. Ich dachte wieder an die wirklich recht hübsche Helena. Wie war es nur zu den drei Tänzen gekommen? Ich konnte mich nicht mehr erinnern, zu viel hatte ich an diesem Abend gesehen und gehört, zu viele neue Gesichter waren an mir vorbeigezogen. Ich erinnerte mich an keine meiner anderen Tanzpartnerinnen – nur an Helena Devane. Sollte ich mich durch mein Verhalten kompromittiert haben? Nicht, daß sie sich Hoffnungen machte! Ich sah zu Vater und beobachtete, wie sich seine Miene verfinsterte. Ob ihm der gleiche Gedanke wie mir gekommen war? Ich wagte nicht, ihn darauf anzusprechen. Doch schließlich fragte er unvermittelt:
„Louis, ich bitte dich um eine Erklärung: wie kommt es, daß Armand Hugues mit dir hier aufgetaucht ist?“
Aus seiner Frage konnte ich erahnen, daß etwas vorgefallen sein mußte, seit Armand und er sich das letzte Mal in Paris gesehen hatten. Nur was? Mein Freund hatte mir gegenüber nichts von einem Zerwürfnis mit meinem Vater erwähnt. Deswegen war ich vorsichtig mit meiner Antwort:
„Nun, wir blieben über all die Jahre in brieflichem Kontakt. Als abzusehen war, daß ich bald heimkommen würde, unterrichtete ich ihn davon und bat ihn, mich auf Stonehall besuchen zu kommen. Wir trafen uns zufällig in London, wo er ursprünglich noch ein paar Tage bleiben wollte, bevor er mir den Besuch abstatten wollte. Ich entschied, daß ich ihn gleich in dem Wagen mitnehmen könnte, den du mir freundlicherweise geschickt hattest. War das nicht in deinem Sinne, Vater?“
Sein Blick wurde noch ein wenig finsterer, das konnte auch sein Lächeln nicht überdecken. Dennoch bemühte er sich um einen neutralen Tonfall: „Nun, ich muß gestehen, daß es mir lieb wäre, wenn wir uns in Zukunft gegenseitig geplante Besuche anzeigen würden. Auch wenn du im Westflügel dein eigenes Regiment führen wirst und ich hier das meine, fände ich es doch angebracht, nicht wahr?“
Ich nickte ergeben. Ich war es gewohnt, seine Bitten nicht in Frage zu stellen.
„Natürlich, Vater. So gehört es sich in einer Familie. Armand wird ohnehin morgen früh abreisen, weil er Verwandte in Rochester besuchen will. Er wird dir nicht länger zur Last fallen, nur diese eine Nacht.“
Vater schien zufrieden zu sein:
„Gut. Ich danke dir, mein Sohn. Aber nun verzeih bitte, so viel es auch noch zu berichten gäbe, ich bin jetzt zu müde dazu. Laß uns zu Bett gehen.“
Es gelang mir, meine Enttäuschung über seinen plötzlichen Entschluß zu überspielen. Ich nahm an, daß er weitere unangenehme Fragen fürchtete, auf die er in dieser Nacht nicht mehr eingehen wollte. Meine eigene Müdigkeit hielt sich dank des genossenen Champagners in Grenzen. Ich hätte noch stundenlang mit ihm reden können. Dennoch antwortete ich:
„Gut, wie du meinst. In ein paar Stunden wird es auch schon wieder hell. Der Gedanke mit dem Ausritt, den du vorhin geäußert hast, gefällt mir ausgezeichnet. Ich wünsche dir eine gute Nacht, Vater!“
Wir schüttelten einander die Hände und begaben uns in unsere jeweiligen Schlafzimmer, nachdem Vater mir die Lage des meinen beschrieben hatte. Es befand sich im ersten Stock des Westflügels am Ende des Korridors.
Ich griff nach einem Kerzenleuchter, da die Bediensteten schon alle Kerzen in den Leuchtern an den Wänden und der Decke gelöscht hatten und zu Bett gegangen waren. Damit begab ich mich zu dem beschriebenen Zimmer. Ich lief durch endlose, düstere Flure, bis ich schließlich glaubte, mein Zimmer gefunden zu haben. Ich öffnete die Tür und leuchtete erwartungsvoll hinein. Ich erkannte die vertrauten Silhouetten meiner Pariser Möbel. Aber was war das neben dem Fenster?
Ich hielt den Leuchter so, daß der Schein der Kerzen in diese Richtung fiel, doch bevor ich etwas erkennen konnte, erhellte ein Blitz die Dunkelheit, gefolgt von einem Knall. Instinktiv wollte ich zurücktreten, doch dann sah ich, wie sich eine dunkle Gestalt aus dem Schatten neben dem Fenster löste und sich hinausschwang. Kurz darauf hörte ich sich schnell entfernenden Hufschlag. All dies geschah innerhalb weniger Sekunden.
Ich wurde mir nun eines stechenden Schmerzes im Nacken bewußt und ließ beinahe den Leuchter fallen. Nur meine Disziplin bewahrte uns in dieser Nacht vor einem Brand. Ich umkrampfte den Leuchter fester mit der Rechten und faßte mir mit der Linken in den Nacken. Es fühlte sich feucht an, und als ich die Hand im Kerzenlicht betrachtete, erkannte ich, daß es Blut war. Ich sah mich um – mein alter Spiegel, der neben der Tür gehangen hatte, war in tausend Stücke zersprungen. Einige Splitter mußten mich getroffen haben, zwar nicht tief, aber es schmerzte trotzdem arg. In der Mitte der Wand war ein winziges Loch zu sehen. Offenbar hatte der Mensch neben dem Fenster auf mich geschossen, aber zum Glück nur den Spiegel getroffen.
Ich stellte den Leuchter auf die Kommode neben der Tür und holte ein Taschentuch hervor, um das Blut notdürftig zu stoppen. Inzwischen waren Vater, Tante Sarah und einige Bedienstete, sicher alarmiert von dem Lärm, herbeigeeilt und fragten aufgeregt, was passiert wäre. Auch mein Freund Armand traf nach wenigen Minuten ein. Er bewohnte ein Gästezimmer im Hauptgebäude und hatte deswegen einen etwas weiteren Weg. Ich berichtete von dem, was ich gesehen hatte, während Tante Sarah mit Hilfe zweier Bediensteten die Wunde auswusch und verband. Vater, umsichtig wie immer, bemerkte:
„Wir müssen den Constable benachrichtigen. Noch gibt es vielleicht Spuren, die man vom Täter entdecken könnte.“
Er schickte einen der Dienstboten zu der nahegelegenen Polizeiwache in Langton Green.
Deren Constable Smith, ein fülliger Mensch mit einem gelangweilten Gesichtsausdruck und nur noch wenigen Haaren, kam erst nach einer geschlagenen Stunde. Er brachte zwei müde wirkende Assistenten mit und ließ sich die Ereignisse schildern. Dann beauftragte er seine Assistenten damit, sowohl draußen vor dem Fenster als auch drinnen in meinem Zimmer nach Spuren zu suchen. Schließlich, schon leicht außer Atem und mit Schweißperlen auf der Stirn, verlangte er nach einem Raum, in dem wir ungestört wären. Vater schlug vor, in meinen Salon zu gehen, der sich direkt nebenan befände. Dankbar nickte ich ihm zu und führte Smith hinüber. Er setzte sich wie selbstverständlich an meinen Schreibtisch und wies mir einen Stuhl zu. Offensichtlich sah er meinen Salon als Ersatz für sein Büro auf der Wache an. Ich beschloß, die Angelegenheit nicht noch durch meinen Protest zu verzögern und fügte mich.
Smith begann mit der Befragung. Dabei notierte er meine Antworten äußerst langsam in einem Notizblock, so daß zwischen jeder Antwort und der nächsten Frage eine lange Pause entstand. Er faßte die Ereignisse noch einmal zusammen und stellte dann seine erste Frage an mich:
„Haben Sie etwas Auffälliges an dem Mann bemerkt?“
Ich holte tief Luft. Welch eine Inkompetenz bewies sich hier bereits am Beginn des Gesprächs! Dennoch versuchte ich, ruhig zu bleiben und antwortete:
„Nein, natürlich nicht, ich sah ihn doch nur ganz kurz. Wenn man überhaupt von ‚sehen‘ sprechen kann. Schließlich war es dunkel, und mein Leuchter hat nicht das ganze Zimmer erhellt.“
Der Constable erkannte offenbar, daß die Frage nicht besonders gut gestellt war. So forschte er weiter:
„Nun, können Sie eventuell sagen, wie groß die Gestalt in etwa war? Verdeckte sie zum Beispiel das Fenster?“ Ich überlegte.
„Ja, sie war vergleichsweise groß. Ungefähr so groß wie ich.“
Smith schien erleichtert.
„Nun, das ist doch immerhin schon ein Hinweis. Können Sie sich vorstellen, wer es war? Haben Sie Feinde? Wer könnte einen Grund haben, Sie zu töten?“
Ich zögerte einen Moment, bevor ich antwortete, denn die Antwort wollte gut überlegt sein. Doch mir fiel beim besten Willen kein Mensch ein, der mir womöglich Übles wollte:
„Nein, ich kann mir nicht vorstellen, wer so etwas tun könnte. Jedenfalls niemand, den ich kenne. Ich dachte auch bis vor kurzem nicht, daß ich Feinde hätte. Aber da habe ich mich wahrscheinlich geirrt.“
Der Inspektor schien ratlos, nachdem er meine letzte Antwort notiert hatte. Seine Assistenten kehrten zurück und meldeten, daß sie nichts außer ein paar Fuß- und Hufspuren vor dem Fenster gefunden hätten. Er entließ sie mürrisch nach Hause, doch nur einer der beiden ging, der andere wartete geduldig an der Tür. Smith faßte zusammen:
„Nun, dann haben wir tatsächlich jede Menge Ansatzpunkte. Im Prinzip kommt jeder in England lebende Mann in Betracht, der größer ist als sechs Fuß. Ausgezeichnet. Sie hören von mir! Guten Morgen!“
Er erhob sich und wollte das Zimmer verlassen, als der zurückgebliebene Assistent an ihn herantrat und ihm etwas ins Ohr flüsterte. Der Constable nickte erstaunt und richtete erneut das Wort an mich:
„Mein Assistent teilte mir soeben mit, daß der Spiegel genau in der Mitte getroffen worden wäre. Er hat es genau ausgemessen. Man kann die Konturen sehr gut erkennen, weil das Muster der Tapete unter dem Spiegel weniger ausgebleicht war. Schwer vorzustellen, daß dies ein Zufallstreffer war... Vielleicht wollte der Täter Sie gar nicht töten; vielleicht war es…“ - er senkte verschwörerisch die Stimme - „… eine Warnung?“ Er machte eine bedeutungsschwere Pause und schien über seine Worte nachzusinnen. Doch er kam zu keinem unmittelbaren Ergebnis und fuhr fort: „Ich muß darüber genauer nachdenken, und das werde ich erst gegen Mittag tun. Warum müssen sich die Übeltäter auch immer die Nacht für ihre Untaten aussuchen, wenn jeder vernünftige Mensch schläft? – Danke, ich finde den Weg allein.“
Er entfernte sich grummelnd. Auf die Idee, die anderen Bewohner des Hauses zu fragen, kam er offenbar nicht. Ein unfähiger Mensch!
Ich kehrte zurück in mein Schlafzimmer. Vater schloß gerade das Fenster, durch das der Eindringling gekommen war, und gab mir dann eine Pistole, die ich neben mein Bett legen sollte. Nur für den – relativ unwahrscheinlichen - Fall, daß der Täter zurückkehren sollte. Vater und Tante Sarah zogen sich danach zurück, weil ich ihnen sagte, daß sie nichts mehr für mich tun könnten. Nur Armand blieb mit einem sehr betroffenen Gesichtsausdruck zurück.
Eine Weile starrten wir beide schweigend an die Wand, auf das Loch, das die Kugel dort geschlagen hatte. Die Scherben waren von den Bediensteten bereits weggeräumt worden. Schließlich äußerte ich eine Bitte an meinen Freund:
„Armand, ich kenne deine kriminalistischen Fähigkeiten. Erinnerst du dich, wie du in Paris die verschwundenen Juwelen von Mademoiselle Denier gefunden hast? Die Polizei hatte schon alle Anstrengungen aufgegeben, aber du hast noch einmal sämtliche Anhaltspunkte und Spuren überprüft und schließlich die Lösung gefunden. Würdest du das auch hier noch einmal versuchen?“
Er zögerte mit seiner Antwort und erklärte mir auch, weshalb:
„Louis, so gern ich es versuchen würde, ich glaube nicht, daß ich zu einem anderen Schluß als der Constable kommen würde. Es gibt einfach nicht genügend Spuren.“
Ich gab nicht so schnell auf:
„Das mag sein, mein Freund, aber laß uns dennoch gemeinsam den Tathergang rekonstruieren. Vielleicht sehen wir etwas, das der Constable übersehen hat.“
Er mußte erkennen, daß ich nicht kapitulieren würde, bis ich ihn überredet hatte. Schließlich stimmte er zu:
„Gut, laß uns beginnen. Die wichtigste Frage ist sicherlich folgende: wie ist der Täter in dein Zimmer gelangt? Was wäre dein erster Gedanke?“
Ich überlegte nicht lange.
„Durch das Fenster. Es war offen und der Mann stand direkt daneben. Die Bediensteten werden es geöffnet haben.“
Er trat an das Fenster und öffnete es wieder. Dann schien er es lange und gründlich zu untersuchen, bis er sagte:
„Die Nacht ist kalt. Der Kamin enthält noch Glut. Zu der Zeit, als der Anschlag geschah, muß das Feuer noch gelodert haben. Keiner deiner Angestellten würde aber bei einem brennenden Feuer und dieser Kälte das Fenster geöffnet lassen. Es war mit Sicherheit den ganzen Abend über geschlossen. Und ich erkenne keine Möglichkeit, es von außen zu öffnen. Sieh selbst.“
Ich trat zu ihm und betrachtete den Rahmen und den Öffnungsmechanismus lange und gründlich. Er hatte natürlich Recht. Dann lehnte ich mich aus dem Fenster und wurde beim Blick nach unten daran erinnert, daß wir uns im ersten Stock befanden. Es gab keine Möglichkeit – außer mit einer Leiter – das Zimmer von außen zu erreichen. Die Wände waren vollkommen glatt, ohne jegliche Vorsprünge, und boten selbst einem geübten Kletterer keinen Halt. – Ich zog meinen Oberkörper wieder hinein und ließ Armand mit seinen Ausführungen fortfahren.
„Wie du sicher auch gesehen hast, gibt es keine Möglichkeit, ohne eine Leiter von außen in das Zimmer zu gelangen. Und es ist weit und breit keine zu sehen. Der Täter hatte sicher keine Zeit, sie wegzuräumen und Spuren wurden, soweit ich das verstanden habe, auch nicht gefunden. Das läßt nur einen Schluß zu: der Mann muß aus dem Hause gekommen sein. Er muß entweder ein Bediensteter… oder einer der Ballgäste gewesen sein.“
Ich schauderte. Ich stellte mir vor, wie leicht es für jeden Gast gewesen war, sich unbemerkt von der Ballgesellschaft zu entfernen und so lange in meinem Zimmer auf mich zu warten, bis ich kam. Niemand konnte wissen, wann dies geschehen war. Im größten Trubel oder als schon die meisten Gäste gegangen waren? Er mußte einfach nur hier heraufgehen, unbemerkt, denn die Bediensteten waren alle mit dem Ball beschäftigt. Es gab niemanden, der darauf achtete, daß bestimmte Bereiche des Hauses nicht betreten wurden. Er kam hier herein, suchte sich einen guten Platz gegenüber der Tür. Sobald er meine Schritte hörte, öffnete er das Fenster als Fluchtweg, wartete, bis ich die Zimmertür geöffnet hatte und schoß in dem Moment, als ich durch das Licht der Kerzen deutlich zu sehen war. Dann schwang er sich aus dem Fenster – eine gefährliche Angelegenheit, außer, er hatte ein Pferd unter dem Fenster zu stehen. Ein Wunder, daß er mich verfehlt hatte!
„Kein Wunder“, meinte Armand, als ich meine Gedanken mit ihm teilte. „Ich bin der gleichen Ansicht wie der Constable. Der Täter wollte dich nicht treffen, er wollte dich wahrscheinlich nur warnen. Oder – und das ist eine gewagte Theorie – er wollte nicht dich, sondern jemand anderen treffen. Vielleicht glaubte er ursprünglich, dies sei das Zimmer deines Vaters. Als er seinen Irrtum erkannte, begnügte er sich sozusagen mit einem Schuß in den Spiegel.“
Ich fand diese Theorie sehr abwegig:
„Aber weshalb? Wenn er seinen Irrtum bemerkte, warum ist er dann nicht gleich geflohen? Und die Tatsache, daß der Spiegel genau in der Mitte getroffen wurde? Und überhaupt, wie sollte es zu einem solchen Irrtum kommen, wer sollte etwas gegen meinen Vater haben? Nein, das paßt alles nicht zusammen.“
Armand zuckte die Schultern.
„Es war nur eine Theorie. Vielleicht keine besonders überzeugende, aber eine, die man in Betracht ziehen sollte. Vielleicht war es auch nur Zufall, daß der Spiegel in der Mitte getroffen wurde.“
Ich nickte zerstreut. Tausend Gedanken schossen mir durch den Kopf. Um ehrlich zu sein, hatte ich mir mehr von Armand erhofft. Zwar wußten wir nun mit ziemlicher Sicherheit, daß der Täter nicht von draußen gekommen war, aber das war auch alles. Der Rest war reine Spekulation.
Ich dankte ihm dennoch und verabschiedete ihn für die Nacht. Etwas anderes blieb im Augenblick nicht zu tun. Es war unwahrscheinlich, daß der Unbekannte noch in derselben Nacht oder gar überhaupt zurückkehren würde. Vielleicht war alles wirklich nur als Warnung gedacht. Doch wovor? Und von wem? Ich zermarterte mir den Rest der Nacht über den Kopf, fand aber keine Lösung. Erst gegen sechs Uhr morgens fiel ich in einen unruhigen, traumlosen Schlaf, aus dem ich wenige Stunden später mit schmerzendem Kopf und immer noch den gleichen quälenden Gedanken erwachte.
***