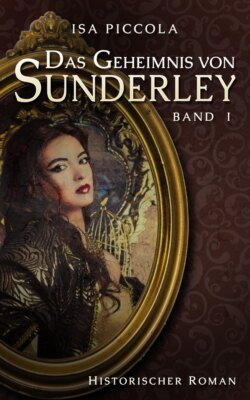Читать книгу Das Geheimnis von Sunderley - Isa Piccola - Страница 6
1
Оглавление„Elizabeth! Lizzie!! Kind, wo steckst du nur wieder?“
Ich sah nur noch, wie meine Frau Catherine leicht kurzatmig die Treppe zum Obergeschoß unseres Hauses hinaufeilte. Dort lag das Zimmer unserer älteren Tochter, die sie verzweifelt suchte.
Ich hatte Catherine eine Minute zuvor eine wichtige Nachricht überbracht - eine, wie man sie nicht alle Tage erhält. Und diese durfte sie Elizabeth und deren Schwester natürlich nicht vorenthalten.
Lizzies Zimmer lag am Ende des Korridors, im Turm unseres Hauses. Catherine vermutete lautstark, daß sie wegen der Entfernung das aufgeregte Rufen nicht gehört hatte. Im oberen Stockwerk angekommen, holte sie noch unsere jüngere Tochter Helena aus deren Zimmer und zwang sie, mit ihr zu gehen. Ich folgte den Damen gemächlich. Warum sich an einem sonnigen Septembermorgen dermaßen echauffieren? Es wurde Herbst, und die einsetzende Ruhe der Natur sollte sich auch auf uns übertragen. Zumindest wünschte ich mir das. Aber meine Wünsche wurden in diesem Hause leider selten respektiert…
Als meine Frau die Tür zu Lizzies Zimmer öffnete, sah ich meine Tochter an ihrem Schreibtisch sitzen. Sie schlug erschrocken ein kleines Buch zu, als die beiden Damen in ihr Zimmer stürzten. Sie fragte etwas verstört:
„Mama, was ist denn geschehen? Warum so aufgeregt?“
Catherine ließ sich erschöpft in einem Sessel nieder. In ihrem Alter war sie solche Dauerläufe nicht mehr gewöhnt. Zwar hatte sie sich ihre gertenschlanke Figur bewahrt, doch der Zahn der Zeit nagte auch an ihr. Sie litt in letzter Zeit immer häufiger unter Kurzatmigkeit, wenn wir längere Spaziergänge unternahmen. Das machte mir ein wenig Sorgen, aber sie schob es auf die Nachwirkungen des feuchten Sommers, der sich auf ihre Lungen gelegt habe. Und wenn meine Frau sich einmal etwas fest eingeredet hatte, war sie davon nicht mehr abzubringen.
Helena blieb erwartungsvoll neben dem Sessel stehen, in dem ihre Mutter Platz genommen hatte. Sie trat ungeduldig von einem Fuß auf den anderen. Offenbar konnte sie es kaum erwarten zu erfahren, was denn geschehen war. Ich vermutete, daß sie vom Fenster ihres Zimmers aus den Boten gesehen hatte, der den Brief gebracht hatte. Und ein Brief versprach immer eine willkommene Abwechslung in unserem für junge Damen sicherlich eintönigen Alltag hier auf dem Lande. Vielleicht war es eine Einladung zum Ball oder gar zu einer Reise zu einer entfernten Verwandten? Mir wurde plötzlich bewußt, wie abgeschieden wir hier auf Sunderley eigentlich lebten. Das nächste Dorf, Langton Green, war eine gute Stunde Fußmarsch entfernt. Und unsere nächsten Nachbarn, die im Vergleich dazu nur einen Katzensprung entfernt auf dem Anwesen Stonehall lebten, wollten nichts mit uns zu tun haben. Doch so war es immer für die Devanes gewesen; sie kannten es nicht anders und waren gewöhnt an die Einsamkeit. Und auch ich hatte mich letztendlich daran gewöhnt und war einer der Ihren geworden, der das Landleben schätzte und die Vorzüge der Großstadt London bald vergessen hatte.
Als Catherine endlich ihren Atem wiedergefunden hatte, ergriff sie das Wort und verkündete die Neuigkeit des Tages. Dabei wedelte sie aufgeregt mit dem Brief:
„Elizabeth, Helena, heute ist ein besonderer Tag für euch und überhaupt für uns alle. Wir haben soeben eine wichtige Einladung erhalten. Ihr könnt euch nicht vorstellen, von wem!“ Sie machte eine bedeutungsvolle Pause und zeigte uns allen den Briefumschlag. Auf der Vorderseite stand unsere Adresse; die Handschrift war mir unbekannt. Ich wollte Catherine gerade bitten, uns doch nicht so sehr auf die Folter zu spannen, als sie aufgeregt fortfuhr:
„Ihr werdet es nicht glauben: in vier Wochen – genauer gesagt, am neunten Oktober - gibt unser verehrter Nachbar, der gute Mr LeFroy, einen großen Ball! Und wir sind eingeladen! Was sagt ihr nun? Ist das nicht eine sensationelle Neuigkeit?“
Das war es in der Tat! Selbst ich war angenehm überrascht. Immerhin hatten wir den geheimnisvollen Gastgeber bisher nicht persönlich kennengelernt, und das, obwohl er bereits seit mindestens fünf Jahren dort wohnte. Er schien entweder sehr menschenscheu zu sein oder, so hatte Helena einmal vermutet, er hatte einen besonders guten Grund, sich auf seinem Anwesen zu verstecken. Ich hatte ihr jedoch verboten, über die Gründe zu spekulieren – das ging uns nichts an. Wenn Mr LeFroy entschied, daß er niemanden sehen wollte, so war das seine Sache. Meine Frau fuhr fort, ihren Gefühlen Luft zu machen:
„Ich bin noch immer ganz außer mir! Nach all den Jahren! Immerhin hatten wir die Hoffnung, jemals bei ihm einen Ball besuchen zu dürfen, schon aufgegeben. Denn ihr wißt ja selber: der Herr hat seit seinem Einzug auf Stonehall keine einzige Gesellschaft gegeben, was eine Schande ist, wenn man der reichste Gutsbesitzer in der gesamten Umgebung ist.“ Ich verstand nicht, wie meine Frau immer wieder solche langen, kunstvollen Sätze bilden konnte, ohne den Faden zu verlieren. „All die Jahre lang hat er sich kaum einmal außerhalb seines Anwesens blicken lassen! Aber das scheint nun glücklicherweise vorbei zu sein! Dieser Ball wird für euch Kinder die ideale Gelegenheit sein, endlich einen jungen Mann kennenzulernen! Wie ich hörte, sind die bedeutendsten Familien der Grafschaft eingeladen, unter anderem auch die Abrahams und die Sallfields! Was sagt ihr nun? Ist das nicht unglaublich?!“
Mrs Devane (ich nenne sie häufig so, es schafft in manchen Situationen einfach den nötigen Abstand) hatte so schnell gesprochen, daß sie ganz rot geworden war und erst einmal Atem holen mußte. Helena benutzte die Pause im Redeschwall ihrer Mutter, um ihrerseits ihren Gefühlen Luft zu machen. Ich weiß ja, wie sehr sie Bälle liebt und wie sie darunter leidet, daß diese auf dem Lande so selten gegeben werden. Aber warum mußte sie immer so pathetisch werden?
„Oh Mama, das ist einfach herrlich! Außerordentlich! Beinahe unfaßbar! Wir waren gewiß seit einem halben Jahr auf keinem Ball mehr! Weshalb hatte Mr LeFroy nicht schon früher diese Idee? Für einen so reichen Mann ziemt es sich nicht, keine Bälle zu geben! Und sein Sohn, wie alt ist er? Ist er ansehnlich?“
Ich sah, wie Mrs Devane die Stirn runzelte. Sie mochte keine Fragen, auf die sie keine Antwort wußte. Deswegen betonte sie in solchen Fällen immer, daß sie nicht die einzige Unwissende war:
„Helena, das weiß bisher kein Mensch hier. Du erinnerst dich jedenfalls, wie Mr LeFroy vor fünf oder sechs Jahren Stonehall gekauft hat. Mit ihm kam wohl eine Miss LeFroy, so erzählte mir einmal Mrs Anderson. Aber niemand weiß, warum die beiden so zurückgezogen lebten. Weißt du noch, William, wie verfallen Stonehall damals schon war, weil sich der alte Eigentümer nicht besonders darum gekümmert hatte? Und dieser Kerl… Berket, hieß er, glaube ich, hat den LeFroys auch noch viel zu viel Geld abverlangt! Ich weiß noch sehr genau, daß Berket damals, vor etwa dreißig Jahren, seinerseits das Gebäude in deutlich besserem Zustand von den Vorbesitzern erworben hatte. Wie hießen die noch gleich?“ Sie überlegte mit angestrengter Miene, doch ihr Gedächtnis war auch nicht mehr das beste. “Nun, jedenfalls waren diese Leute noch schlechtere Nachbarn als die LeFroys. Nicht ein einziges Mal haben sie uns eingeladen! Geschweige denn, uns einmal besucht! Wenn ich mich doch nur noch an ihren Namen erinnern könnte… Kinder, werdet nur nicht alt!“
Sie sann noch einige Minuten nach, kam aber nicht auf den Namen unserer ehemaligen Nachbarn. Es stimmte, bevor Stonehall an Mr Berket verkauft worden war, lebte dort ein junges Ehepaar mit einem kleinen Sohn. Die Familie hatte dort mindestens genauso lange gelebt wie wir Devanes hier auf Sunderley. Und doch bestand kein freundschaftliches Verhältnis zwischen den beiden Clans. Im Gegenteil, sie schienen sich nicht ausstehen zu können. Ich als derjenige, der in die Familie einheiratete, konnte jedoch nie den Grund dafür in Erfahrung bringen. Catherine behauptete stets, ihn selbst nicht zu kennen. Niemand wüßte mehr, was die Ursache für die Abneigung zwischen den beiden Familien war. Ihre Mutter war kurz nach Catherines Geburt gestorben, und ihr Onkel, der bis zu ihrem einundzwanzigsten Lebensjahr ihr Vormund war, hatte nie ein Wort darüber verloren. Catherine hatte wohl öfter Versuche unternommen, die Wahrheit herauszufinden – sie waren jedoch allesamt erfolglos geblieben. So lebte man nebeneinander her, ohne daß die Rivalität bedrohliche Ausmaße angenommen hätte. Man ignorierte sich einfach, bis die Familie mit dem vergessenen Namen vor etwa dreißig Jahren die Gegend verlassen und Stonehall an Mr Berket verkauft hatte.
Catherine hatte ihre Überlegungen erfolglos beendet und fuhr fort:
„Nun, jedenfalls hat seit ihrem Einzug in Stonehall niemand mehr etwas über diese LeFroys erfahren. Eine Schande ist das, wenn man nicht weiß, wer seine eigenen Nachbarn sind! Aber das wird sich in vier Wochen ändern!“
Ich stöhnte innerlich auf. Mir tat der arme Mr LeFroy bereits leid. Meine Frau würde ihn den ganzen Abend mit Fragen belästigen und uns dabei unsäglich blamieren. In dieser Beziehung hatte sie leider keinerlei Skrupel. Sie tat stets alles, um ihre unstillbare Neugier zumindest in Ansätzen zu befriedigen. Dabei vergaß sie unglücklicherweise, daß in manchen Fällen das Zauberwort ‚Diskretion’ hieß. Helena machte sich darum weit weniger Sorgen, im Gegenteil:
„Mama, das ist einfach eine wunderbare Neuigkeit! Nicht wahr, Lizzie?“, wandte sie sich an ihre etwas bedrückt wirkende Schwester. Ich erkannte, daß sich Lizzie überhaupt nicht auf diesen Abend freute. Doch Helena, die gar keine Antwort erwartet hatte, brachte sofort ein schwerwiegendes Problem auf das Tapet: „Aber, Mama, ich habe überhaupt gar nichts anzuziehen! Das Kleid vom letzten Ball ist längst aus der Mode! Aber ich habe in Mrs Beetons Domestic Magazine gerade ein reizendes Modell gesehen…“
Catherine unterbrach ihre Tochter etwas unwirsch.
„Kind, nun übertreibe bitte nicht. Das stellt alles kein Problem dar. Ich habe bereits ins Dorf nach Mrs Mellington geschickt. Wir gehen gleich hinunter und sehen, daß wir dir ein neues Kleid nähen lassen. Was mich betrifft - ich denke, ich trage das schwarze von der Beerdigung von Mr Pollies. Daran wird sich sicher niemand mehr erinnern, es waren ja kaum Leute da, um dem armen Steve die letzte Ehre zu erweisen. Überdies ist schwarz gut für die Figur, und in meinem Alter geht man nicht mehr so farbenfroh wie ihr Kinder... Lizzie, wie sieht es mit deiner Garderobe aus?“
Die Angesprochene schaute auf. Ich sah die Traurigkeit in ihren Augen und ahnte, was in ihr vorging. Sie wirkte dennoch sehr beherrscht, als sie antwortete:
„Ich brauche kein neues Kleid, Mama. Ich möchte nicht mitkommen.“
„Elizabeth!“ Mrs Devane war schockiert und schien beinahe persönlich beleidigt. „Was fällt dir ein? Welchen Unsinn redest du denn da? Auch du mußt langsam einen Mann finden, so gehört es sich nun einmal. Außerdem bist du deutlich über das übliche Heiratsalter hinaus! Also wirst du gefälligst mitkommen und dich für unsere hübschen jungen Männer der Umgebung empfehlen. Oder willst du dir und mir unser eigenes Grab schaufeln?“
Mrs Devane war sicher, daß dieser pathetische Abschluß ihrer Rede auf Lizzie Eindruck machen würde. Ich kannte ihre Ansichten über die Ehe zur Genüge. Für Catherine gab es nichts Erstrebenswerteres für eine Frau, als sich für ihren Ehemann aufzuopfern und stets für ihn da zu sein – nur leider vergaß sie das in ihrer eigenen Ehe manchmal zu leicht. Diese Einstellung hatte sie Helena erfolgreich vererbt. Von frühester Jugend an kokettierte Helena mit jedem Mann, der ihr einen bewundernden Blick schenkte – immer in der Hoffnung, er würde sie erwählen. Bisher hatte sie sich jedoch die falschen Männer ausgesucht. Sie waren entweder bereits verheiratet oder verlobt, oder zu intelligent, um an Helena Gefallen zu finden. Nur meine Lizzie war immun gegen Catherines Reden und interessierte sich nicht für das sogenannte stärkere Geschlecht. Zumindest erweckte sie diesen Eindruck. Und so war Lizzie von der Rede ihrer Mutter natürlich überhaupt nicht beeindruckt:
„Mama, ich habe gewiß nicht die Absicht, dir weh zu tun. Es ist nur so, daß ich das Gefühl habe,… ich passe einfach nicht in diese Gesellschaft. Du weißt doch, ich bin gänzlich ungeeignet, um mit wildfremden Menschen Konversation zu machen. Außerdem... schau mich doch an. Es würden mich alle nur auslachen. Kannst du das nicht verstehen?“
Das konnte sie natürlich nicht, und Mrs Devane wurde dann schnell wütend. Sehr schnell.
„Nein!! Diese fadenscheinige Begründung lasse ich nicht gelten. Hier geht es ums Prinzip. Demzufolge wirst du mitkommen, ob du willst oder nicht. Deinetwegen lasse ich mir nichts nachsagen. Dann heißt es wieder: die Devanes sind uneins. Sie haben ihre Kinder nicht anständig erzogen! – Deine Schwester war schon mit fünfzehn auf ihrem ersten Ball. Du hast dich bisher erfolgreich deinen gesellschaftlichen Pflichten entzogen und warst ein einziges Mal mit achtzehn auf der Hochzeit einer entfernten Cousine. Danach bist du immer krank geworden, wenn ein größeres Ereignis anstand. Aber das ist nun vorbei. Du hast vier Wochen Zeit, um dich seelisch darauf vorzubereiten. Helena wird mit dir Tanzen und Konversation üben. Und damit basta! - Helena, du kommst jetzt mit; wir werden sehen, was Mrs Mellington an Stoffen anzubieten hat. Wenn du dich an den Gedanken gewöhnt hast, Elizabeth, kannst du auch in den Salon kommen.“
Mrs Devane erhob sich und schwebte mit rauschenden Röcken aus dem Zimmer. Helena folgte, nachdem sie Lizzie einen mitleidigen Blick zugeworfen hatte. Solch eine Einstellung war ihr unerklärlich. Ich wußte, worauf Lizzie anspielte – auf ihre etwas zu füllig geratene Figur. Auch wenn wir ihr immer wieder versicherten, daß sie eine hübsche junge Frau sei, schämte sie sich ihrer üppigen Formen und mied fast jeden gesellschaftlichen Umgang außerhalb ihrer Familie. Ich wollte sie trösten und sie überzeugen, daß sie doch mitkommen möge, aber sie wollte nichts hören und bat mich, sie allein zu lassen. So ging ich und hörte noch, nachdem ich die Tür geschlossen hatte, wie sie in heftiges Schluchzen ausbrach.
Dennoch begab ich mich nun zu den anderen beiden Damen in den Salon. Dort war Mrs Mellington, die Näherin aus dem Dorf, bereits eingetroffen und hatte ihre edelsten Stoffe zur Ansicht ausgebreitet. Catherine und Helena begannen, diese zu begutachten und die Vorteile des hellblauen Seidenstoffes im Vergleich zu einem blumendurchwirkten Brokatgewebe… Ich überließ die Damen ihrem Schicksal und begab mich zu meinem Kleiderschrank. Ich verstand die Aufregung überhaupt nicht. So suchte ich meinen Abendanzug heraus, der nicht so schnell aus der Mode kam. Wir Männer haben es diesbezüglich bedeutend einfacher.Solange unsere Anzüge nicht dem allerletzten Schrei entsprechen und wir dadurch bei jedem gesellschaftlichen Anlaß auffallen, benötigen wir nicht viel. Ich sage immer: solange der Anzug sauber, ordentlich und dem Anlaß angemessen ist, können wir ihn so oft tragen, wie wir wollen. Für diesen Ballabend genügten mein schwarzer Frack mit der passenden Hose, eine schwarze Weste und eine kleine, schwarze Krawatte. Schließlich gingen wir nicht in die Oper oder ins Theater, wo ich das weiße Exemplar benötigt hätte.
Ich probierte alles an und fand, daß es noch tadellos paßte. Mottenlöcher waren auch nicht zu entdecken, alles war sauber und ohne Falten. Zum Abschluß überprüfte ich noch die Sauberkeit meiner weißen Handschuhe. Es war alles in bester Ordnung, meine Garderobe für den großen Abend würde mir keine Sorgen bereiten. Ein Glück, daß Catherine immer für Ordnung im Kleiderschrank sorgte.
Anschließend zog ich mich in die Bibliothek zurück und widmete mich der monatlichen Haushaltsabrechnung. Es war bereits Anfang September, und ich hatte noch keine Zeit gehabt, die Rechnungen vom August durchzusehen und aufzulisten. Es dauerte gut eine Stunde, bis ich damit fertig war. Danach wollte ich mich einem guten Buch widmen, doch da hörte ich plötzlich Mrs Devanes schrille Stimme. Seufzend unterbrach ich meine kaum begonnene Lektüre und kehrte in den Salon zurück.
Catherine verlangte in noch gereizterer Stimmung als zuvor, daß ich Lizzie holte.
„Sie soll endlich herunterkommen, damit wir sehen, was sie in vier Wochen anziehen kann. Sage ihr, daß ich ihr Verhalten auf keinen Fall billigen werde. Entweder führt sie mir ein anständiges Kleid vor oder… “ Offenbar wußte sie nicht, womit sie drohen konnte.
Ich war nun meinerseits auch etwas ärgerlich geworden. Während ich erneut die vielen Stufen zum ersten Stock emporstieg, dachte ich bei mir, daß Catherine doch das einzige vernünftige weibliche Wesen in diesem Hause in Ruhe lassen sollte. Mir war jedoch auch bewußt, daß ich meine Große überzeugen mußte mitzukommen. Sonst würde meine Frau unverzeihlich böse sein und mindestens eine Woche nicht mit uns reden. (Was an sich eine Wohltat wäre, wenn nicht ihr Redeschwall nach dieser einen Woche - sollte sie so viel Durchhaltevermögen überhaupt besitzen - noch unerträglicher würde…) Wenn Catherine doch nicht immer so stur wäre! Und wenn sie diesen Sturkopf nicht auch noch an Lizzie vererbt hätte!
Schließlich war ich oben angelangt und klopfte an Lizzies Tür. Keine Antwort. „Lizzie, ich bin es, ich weiß doch, daß du da herinnen bist, also laß mich bitte eintreten.“
Es dauerte ungewöhnlich lange, bis sie endlich die Tür öffnete. Meine Tochter wirkte noch unglücklicher als zuvor. Die rotgeweinten Augen zeugten von ihrer Verzweiflung. Ich nahm sie für einen Moment in den Arm und sagte:
„Bitte komm mit herunter, mein Kind. Deine Mutter verlangt nach dir. Sie will wissen, was du anziehen wirst. Komm und verärgere sie nicht noch mehr.“
Sie nickte stumm und tat mir dann den Gefallen. Sie holte ein Kleid aus ihrem Schrank. Es war ein schwarzes Seidenkleid, das sie vor einigen Jahren zur Beerdigung ihres Großonkels Robert tragen wollte. Da wir jedoch wider Erwarten nicht dazu eingeladen worden waren, blieb es quasi unbenutzt. Gemeinsam gingen wir damit in den Salon.
Dort erklärte Lizzie ihrer Mutter, daß sie dieses und kein anderes Kleid anziehen werde. Meine Frau reagierte zwar etwas unwirsch – schwarz wäre keine Farbe für junge Frauen -, doch stimmte sie schließlich zu, froh, daß ihre Tochter nun doch mitkommen würde und sie nicht dem unerträglichen Klatsch der Nachbarschaft ausgesetzt wäre. Sie hatte schließlich einen Ruf zu verlieren.
Auch, wenn dieser schon seit Jahren ruiniert war.
***