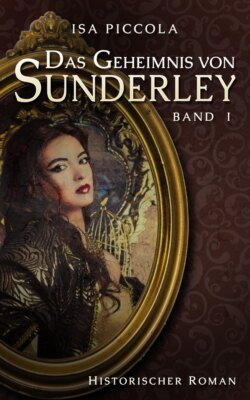Читать книгу Das Geheimnis von Sunderley - Isa Piccola - Страница 14
9
ОглавлениеVater und ich erreichten Stonehall zur gleichen Zeit wie die örtliche Feuerwehr. Ich weiß nicht, wer sie gerufen hatte. Wahrscheinlich einer der Bediensteten. Diese hatten bereits eine Eimerkette zum Brunnen im Garten gebildet und versuchten zu retten, was zu retten war.
Uns bot sich ein Bild, das ich nie im Leben vergessen werde. Der gesamte Dachstuhl des Westflügels stand in Flammen. Der Blitz mußte dort an einer Stelle eingeschlagen und sich durch das trockene Dachgebälk rasend schnell ausgebreitet haben. Warum gab es auch keinen Blitzableiter? Ich erinnerte mich, daß Vater einen solchen hatte installieren wollen – doch meine Tante war dagegen, sie fürchtete, daß das Erscheinungsbild des Hauses durch eine solche neumodische Metallspitze entstellt würde.
Meine Tante! Wo war sie? Ihre Wohnung befand sich im Westflügel. Sie hatte sich mit Sicherheit dort aufgehalten. Ich sah auf die Uhr an der Hauptfassade. Kurz nach elf Uhr. Sie war sicher schon zu Bett gegangen. Sie ging immer um zehn Uhr ins Bett.
Ich fühlte mich wie gelähmt in all dem Chaos um mich herum. Menschen rannten hin und her, Befehle wurden gebrüllt. Die Feuerwehr pumpte Wasser auf das Haus. Es herrschten ein ungeheurer Lärm und ein Durcheinander, das seinesgleichen suchte. Ich hielt nach Vater Ausschau. Er war nirgends zu sehen. Mein Blick irrte hilflos umher. Wenn ich mich doch nur entschließen könnte, etwas zu tun! Nur was? Jeder der Umstehenden konnte meine Aufmerksamkeit nur für Sekunden fesseln, bevor sie von einer anderen hektischen Bewegung in Anspruch genommen wurde. Wo war nur Vater? Warum konnte er mir nicht sagen, was ich tun sollte?
Plötzlich schien dieser ganze Ameisenhaufen um mich herum in bestimmte Bahnen gelenkt zu werden, und zwar in Richtung des Nebeneinganges zum Westflügel. Auch ich machte mich auf den Weg dorthin. Vielleicht konnte ich dort endlich helfen. Ich kämpfte mich durch die Menschenmassen nach vorn. Und endlich sah ich Vater.
Soeben hatte man meine Tante aus dem brennenden Haus geholt. Sie schien bewußtlos zu sein. Oder war sie schon tot? Nein, das konnte nicht sein. Immer noch wie gelähmt sah ich zu, wie der Dorfarzt, Dr Shelley, ihr den Puls fühlte. Die Menschenmasse um uns herum wich zurück. Vor Schreck? Aus Ehrfurcht vor dem Tod? Ich blieb stehen und beobachtete mit Bangen, wie der Doktor etwas zu Vater sagte. Ich konnte es nicht verstehen, obwohl ich nur einen Meter entfernt stand. Zu laut toste das Feuer in meinen Ohren.
Vater sah sich um und erkannte mich. Endlich. Er winkte mich zu sich heran und legte mir die Situation kurz und knapp dar. Er wirkte, als hätte er sich und alles um ihn herum vollkommen unter Kontrolle. Man hatte Tante Sarah unter einem auf sie gefallenen Balken herausgezogen. Wahrscheinlich hatte sie Quetschungen und eine Rauchvergiftung erlitten – wenn nicht noch mehr. Sie schwebte auf alle Fälle in Lebensgefahr. Wir mußten einen Ort finden, an dem sie gepflegt werden konnte.
Der einzige Ort, der mir einfiel, war Sunderley. Vater schien der Gedanke nicht zu gefallen, doch konnten wir eine Kranke schlecht in den Stallungen oder im um diese Jahreszeit viel zu kalten Gartenhäuschen unterbringen. Und wer wußte schon, wie sich der Brand weiter ausbreiten würde? Also stimmte er schließlich zu. Wir baten also Mr Devane, der einige Minuten zuvor zu uns gestoßen war, um Asyl. Es wurde gewährt, und er kümmerte sich persönlich darum, daß meine Tante vorsichtig nach Sunderley transportiert wurde. Vater begleitete sie und übertrug mir die Leitung der Löscharbeiten.
Dank des wieder stärker gewordenen Regens konnte das Feuer nach zwei Stunden endlich unter Kontrolle gebracht werden. Allerdings wäre an ein Bewohnen dieses Teils von Stonehall für längere Zeit nicht zu denken. Das Dachgeschoß und die darunter liegende Etage des Westflügels waren komplett zerstört. Die Räume im Erdgeschoß hatten wahrscheinlich durch das Löschwasser erheblichen Schaden erlitten. So sagte es mir zumindest der Mann, der die Löscharbeiten organisiert hatte. Er erklärte mir auch, was das schreckliche Unglück wahrscheinlich ausgelöst hatte. Ein Blitz war in einen der hohen Bäume eingeschlagen, die in unmittelbarerer Nähe des Anwesens standen. Von dort hatte das Feuer schnell auf das Dachgeschoß übergegriffen.
Ich warf einen letzten Blick auf die rauchenden Ruinen. Im Moment konnte ich nicht mehr tun, und mir war auch nicht danach zumute. Ich ließ die Bediensteten zu Bett gehen. Glücklicherweise war das Gebäude, in dem die meisten von ihnen untergebracht waren, nicht beschädigt. Einige wenige lebten im Dorf und sollten zu ihren Familien zurückkehren. Ich setzte ein Treffen zur Klärung der Lage am nächsten Tag um die Mittagsstunde an. Dann begab ich mich nach Sunderley um zu sehen, was aus meiner Tante geworden war.
Als ich dort eintraf, war das Haus in heller Aufregung. Ich traf Mrs Devane in der Halle. Sie schien der einzige Ruhepol zu sein und alles um sie herum zu regeln. Sie berichtete mir, daß man meine Tante in einem der Gästezimmer untergebracht hatte. Leider war Dr Shelley nicht mehr abkömmlich. Er war zu einem anderen Notfall gerufen worden, und da meine Tante, wie er meinte, stabil wäre und er nichts weiter für sie tun könnte, war er ins Dorf geeilt. In der Zwischenzeit kümmerte sich eine heilkundige Bedienstete der Devanes und versorgte die Schwerverletzte. Ich hatte es schon von Vater gehört: Shelley war kein Arzt für ernsthafte Krankheiten und Verletzungen; auch hatte ihn noch nie jemand außerhalb seines Behandlungszimmers einen Kranken heilen sehen.
Doch war all dies kein Grund, meiner Tante nicht die bestmögliche Pflege angedeihen zu lassen. Ich bat Mrs Devane also, einen Mann in das etwas weiter entfernte Rochester nach einem Chirurgen zu schicken. Die Künste der heilkundigen Bediensteten genügten vielleicht zur Behandlung eines Schnupfens und zu ersten Hilfsmaßnahmen, aber nicht zu mehr. Was wir brauchten, war ein erfahrener Praktiker.
Es dauerte über zwei Stunden, bis Dr Dodgson aus Rochester endlich eintraf. Ein dünner, hochaufgeschossener Mensch mit wenigen Haaren auf dem Kopf und einer großen Ledertasche in der Hand. Ich führte ihn hinauf zu dem Gästezimmer, in dem meine Tante unter der Obhut meines Vaters lag. Dann hieß es warten für mich. Die Devanes hatten sich im Salon versammelt, doch mir war nicht nach Gesellschaft. Ich blieb im Flur in der Nähe des Krankenzimmers, um notfalls zur Stelle zu sein, falls man mich brauchte.
Dr Dodgson blieb nicht länger als eine Viertelstunde bei meiner Tante. Er machte ein bedenkliches Gesicht, als er das Zimmer wieder verließ. Ich wechselte einige Worte mit ihm, denn ich wollte Vater nicht stören. Der Arzt bestätigte die erste Diagnose von Dr Shelley: sie hatte neben Quetschungen des Brustkorbes zusätzlich eine schwere Rauchvergiftung und Verbrennungen erlitten, vermutlich auch innere Blutungen. Aber er konnte ihr nicht anders helfen als mit der üblichen Gabe vonz Laudanum. Dann ging auch er. Er wollte am nächsten Vormittag wieder nach der Patientin sehen.
Ich begab mich nun doch in den Salon und berichtete unseren Gastgebern in knappen Worten von der gegenwärtigen Lage. Die Familie brachte ihr Mitgefühl zum Ausdruck. Mrs Devane stellte uns freundlicherweise ein weiteres Gästezimmer im ersten Stock zur freien Verfügung. Vater und ich würden dort wohnen. Wobei mir bewußt war, daß Vater die meiste Zeit bei seiner Schwester wachen würde.
Es war Zeit, daß ich mich im Krankenzimmer sehen ließ, und so stieg ich erneut die Stufen zum ersten Stock hinauf. Leise trat ich ein. Der Anblick erschütterte mich. Tante Sarah lag in einem mit dunkelblauen Samtvorhängen umschlossenen Bett. Nur an einer Seite waren die Behänge nicht zugezogen, und dort saß Vater auf einem Stuhl und hielt die Hand der Ohnmächtigen. Ich ging zu ihm und legte ihm stumm die Hand auf die Schulter. Er schien mich nicht einmal zu bemerken, sah nur zu seiner Schwester und ich glaubte, eine Träne in seinem Auge glitzern zu sehen. Ich wußte, wie sehr er an ihr hing und wie sehr ihn dieses Unglück treffen mußte.
Vater würde die ganze Nacht über am Krankenbett bleiben. Es hatte keinen Sinn, wenn ich ihm Gesellschaft leistete, also begab ich mich noch einmal in den Salon, wo die Devanes auf einen Bericht warteten. Ich ergriff mit leicht bebender Stimme das Wort:
„Mrs Devane, ich darf Ihnen, auch im Namen meines Vaters, unseren tiefempfundenen Dank dafür aussprechen, daß Sie uns in dieser schweren Stunde zur Seite stehen. Wir werden Ihre Gastfreundschaft wahrscheinlich mehrere Monate in Anspruch nehmen müssen, da ein großer Teil des Hauses ein Raub der Flammen geworden ist. Doch sobald wir Ihnen lästig werden, ziehen wir selbstverständlich aus. Ich hoffe, daß wir Ihnen nicht zu viele Umstände machen und biete als kleine Gegenleistung, die natürlich in keinem Verhältnis zu den empfangenen Diensten steht, unsere Arbeitskraft an.“
Ich ließ mich müde in einem Sessel nieder. Mrs Devane erwiderte:
„Mr LeFroy, Sie müssen sich nicht bedanken. Es ist eine alte Sitte der Familie und auch der hiesigen ländlichen Gegend, daß man Notleidenden auf alle erdenkliche Art und Weise hilft. Darum verlieren Sie bitte kein Wort mehr über diesen kleinen Freundschaftsdienst, denn mehr ist es nicht. Im Gegenteil, ich muß Ihnen...“
Sie verstummte, und ihr Blick richtete sich auf die Treppe zum ersten Stock. Ich drehte mich um. Mein Vater, aschfahl, taumelte langsam die Stufen herunter. Am Fuße der Treppe brach er zusammen. Man holte eilig ein Glas Wasser und versuchte, ihn mit Riechsalz und feuchten Tüchern wieder zu Bewußtsein zu bringen. Ich ahnte, was geschehen war. Als er wieder zu sich kam, konnte ich nur flüstern:
„Ist sie...?“
Er nickte erschöpft. Er versuchte, sich aufzurichten, doch die Beine versagten ihm den Dienst. Ich nahm all meine Kräfte zusammen und trug Vater zusammen mit Mr Devane hinauf in das Gästezimmer, das neben dem Krankenzimmer lag.
Es war nun zum Sterbezimmer geworden.
***