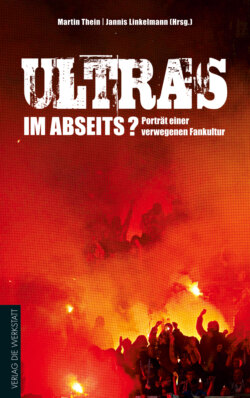Читать книгу Ultras im Abseits? - Jannis Linkelmann - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Fanidentität im Nachkriegsdeutschland
ОглавлениеDie Entstehung der Fanidentität in Deutschland weist viele Parallelen zu den englischen Verhältnissen auf. So sehen Schulze-Marmeling und Dembowski auch für Deutschland die Einführung des Acht-Stunden-Arbeitstages als wichtigste Voraussetzung für die Ausbreitung des Fußballs.45 Die Entkopplung traditioneller kultureller Manifestationen spiegelt sich in der nachkriegszeitlichen Orientierungslosigkeit der Menschen wider. Die Förderung seitens einzelner Unternehmen sowie verschiedenster Konfessionen und des Staates zeigte sich, anders als in England, besonders in der Ausweitung des Sportstättenbaus.46 Wie in England waren es auch in Deutschland die Arbeitervereine, die durch spielerische Leistung die bürgerlichen Vereine über die Jahre immer mehr ins Abseits drängten.47
Vor Einführung der Bundesliga 1963, also weit vor der Kommerzialisierung und Professionalisierung des Sports, waren Spieler für die Zuschauer noch greifbare Repräsentanten ihres Viertels, des Orts oder der Stadt und waren ihren Anhängern sozial, kulturell und finanziell nahe. Es war der „Kumpel von nebenan“, mit dem man sich identifizieren konnte.48 So war es undenkbar, dass sich der Spieler auf dem Platz im Regen abrackern musste und der Fan im Stadion unter einem Regendach stand.
Diese Spieler-Fanbeziehung besteht heute, wenn überhaupt, nur noch in Ortsvereinen der unteren Ligen.49 Vielmehr entfernte sich der Spieler vom Fan oder umgekehrt, je nachdem, wie man es sehen mag. Es herrscht zurzeit ein Verhältnis voller emotionaler Spannung, wobei Verehrung und Verachtung nahe beieinanderliegen. Hortleder beschreibt dies treffend, wenn er sagt: „Man ist bereit, ihn begeistert zu feiern, wenn er gut ist, um ihn ebenso schnell zu verfluchen, wenn er versagt.“50
Mit der Professionalisierung des Fußballs entwickelte sich ein neuer Typus Spieler, der nur so lange seinem Verein treu bleibt, bis ein finanziell besseres Angebot für ihn vorliegt oder der sportliche Erfolg des Vereins gewährleistet ist. Dieser Spieler zeichnet sich nicht nur durch die eben beschriebene räumliche Mobilität aus, sondern auch durch die Distanz zum Fan.51
Bedingt durch stadionbauliche Veränderungen (z. B. das Trennen der Blöcke durch Zäune) für die WM 1974 in Deutschland konnte sich erstmals eine eigenständige jugendliche Fankultur entwickeln. Diese sammelte sich von nun an in den Kurven hinter den Toren eines Stadions, da hier die Eintrittspreise aufgrund der schlechten Sicht am günstigsten waren. Von diesen Bereichen aus entstanden nach britischem Vorbild bestimmte Rituale wie das Anfeuern einer Mannschaft oder das Schwenken von Fahnen.52 Die Stehkurve entwickelte sich zu einem Ort, an dem vorwiegend Jugendliche unter sich und doch vor den Augen der übrigen, zumeist älteren Stadionbesucher Formen körperbetonter Selbstdarstellung entwickeln konnten. Der Platz in der Kurve fungiert für jugendliche Fans als Freiraum außerhalb der Erwachsenenwelt, wo sie ihre Ideale ausleben können und sich so ihre eigene Ordnung schaffen.53