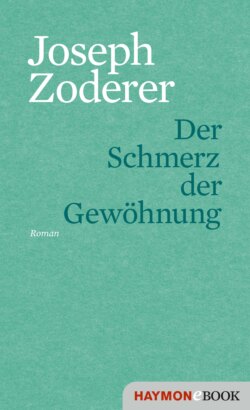Читать книгу Der Schmerz der Gewöhnung - Joseph Zoderer - Страница 11
7
ОглавлениеEr fühlte sich angekommen. Und er wusste nun auch, warum es gut war, hier zu sein. Hier, woher Maras Vater kam und daher auch Maras andere Welt, von hier aus wollte er die Entfernung messen, die Meter seines Lebens, nicht nur das mit Mara und Natalie. Auch wenn er den Koffer noch immer nicht ausgepackt, sondern nur aufgeklappt am Bettende deponiert hatte, sagte er sich: Ich bin da. Lag ausgestreckt auf dem Bett oder saß auf dem einzigen Stuhl zwischen Bett und Duschraum und starrte auf den gelblichweißen abblätternden Wandverputz, auf die haardünnen Risse, die sich zu einem Netz ausbreiteten, aus dem Gesichter auftauchten, je nachdem, wie er die Augenlider bewegte, sie leicht oder fester zusammenzog.
Er hatte in einem Schreibwarengeschäft, das eigentlich ein Souvenirladen war (mit den girgentischen Tempelruinen in Gips oder Kork), ein paar blaue Schulhefte gekauft und wollte darin – wann und solange er konnte oder mochte – einiges notieren, was sein Leben ausgemacht hatte, was immer ihm einfiel, auch das scheinbar Unwichtige.
In der Nacht wachte er regelmäßig nach zwei, drei Stunden Schlaf auf und später mindestens noch zweimal, und jedes Mal schien ihm, nun müsse er bis zum Morgen wach bleiben. Manchmal setzte er sich dann an das Tischchen, im Mauerwinkel zwischen Fenster und Badetür, und schrieb ein paar Zeilen, meistens war er zu mehr nicht imstande – doch es kam auch vor, dass er kaum aufhören wollte. Einerseits, weil er den Schmerz nicht ertrug, wenn das Erinnern … aber anderseits lebte er auf, lebte noch einmal ein Stück Zeit. Und manchmal legte er gerade deshalb den Kugelschreiber weg und schluckte Tabletten. Um zu vergessen, um zu verdrängen, versuchte er an alles Mögliche zu denken, an Fußball, ja sogar an die nächsten Parlamentswahlen in Schweden. Nur um wegzudenken von Mara und Natalie. Und auch, warum er zu keinem Facharzt gegangen war. Tatsächlich schlief er irgendwann wieder ein, bis um sechs oder halb sechs, dann schaffte er es nicht mehr. Der Druck in seinem Kopf. Als ob sich in seinem Schädel etwas verknäuelte (ein Reptil). Er sprang aus dem Bett, schob einen Fensterladen auf, stellte sich unter die Dusche.
Am Sonntagmorgen um halb sieben ging er durch eine tote Stadt; die Sonne schien schon auf die Hausdächer der Hauptstraße (die gerade breit genug war für die Durchfahrt der kleinen städtischen Busse), niemand überholte ihn, niemand kam ihm entgegen, kein Tabakladen, kein Zeitungskiosk, keine Bar oder Pasticceria geöffnet. Ja, drei Arbeiter räumten eine Wohnung im ersten Stock über einem Laden aus, einer warf das Zeug in großen Pappkartons herunter, einer seiner zwei Kollegen fing die Schachteln jeweils auf. Kurz bevor Jul auf den Platz gelangt mit dem Magnolienbaum, den Stechpalmen und Kakteen und all den anderen mediterranen dunkelgrünen Blätterbäumen, aus denen die Spatzenscharen schon längst zu diesem Tag ausgeschwärmt sind, vertreten ihm plötzlich zwei Männer den Weg und fragen ihn, ob er schon einmal von „Geova“ gehört habe, und bevor er im Weitergehen weiß, was sie meinen, haben sie ihm ein Faltblatt zugesteckt, auf dem er lesen kann: dass Jehova das verlorene Paradies wiederherstellen werde auf Erden für alle jene, die bereit sind, ihm zu gehorchen wie Kinder („Er wird jede Träne in ihren Augen trocknen und es wird den Tod nicht mehr geben“). Im Park hat ein Zeitungskiosk geöffnet und ebenso das Pavilloncafé „Milano“. Er setzt sich unter einen Spatzenbaum, lässt sich einen Cappuccino mit Cornetto bringen und liest, dass der Brasilianer Ronaldo endlich wieder ein Tor geschossen hat für Inter Mailand und: „Hunderttausende betroffen von Reaktorunfall in Tokaimura“. Am Nachbartisch sitzen zwei ältere Männer – einer mit Spazierstock scheint gehbehindert, jedenfalls gebrechlich – und ein etwas jüngerer mit dichtem schwarzen Haargewuschel und Sonnenbrille; die Sonnenbrille ist immer wieder auf Jul gerichtet. Doch jetzt will er nicht mehr den Platz wechseln, will in Ruhe sein Cornetto kauen und lesen. Das litaneienhafte, mundartliche Reden am Nebentisch kann er so und so nicht verstehen, aber er sieht, wie zu dem Gebrechlichen von Zeit zu Zeit ältere Herren hinzutreten, auch junge Burschen, und ihn respektvoll begrüßen, manche küssen sogar seine Hand. Ein beliebter alter Mann (oder ein Boss?) in unansehnlicher Kleidung, cremig helles, kurzärmeliges Hemd und kaffeebraune Hose.
Die Stadt ist eine Kasbah, ein labyrinthisches Winkelwerk, mit Gässchen, die sich ständig verzweigen, man kommt, wenn man sich nicht auskennt, nie dorthin, wo man will, doch immer wieder tut sich unerwartet eine Verbreiterung auf, ein abgeschiedenes Plätzchen (cortile) mit dem Duft nach frischgebackenem Brot und neben dem Panificio ein Gemüseladen und manchmal auch die Officina eines Handwerkers. Die meisten Häuser sind mit diesen ockergelb bräunlichen Quadern aus Tuffstein gebaut (an einem sah er die noch grünen Blätter wilder Weinreben bis zu den Fenstern des vierten Stockes hinaufranken), darunter Palazzi aus der Renaissance und aus dem Barock mit monumentalen, von Wind und Salzluft zerfressenen Portalen (und in den Stockwerken darüber nicht selten diese Romeo-und-Julia-Balkönchen mit Eisengeländer). Über dem Schild eines Dentisten (Franco Siracusa) las er auf einem zweiten Schild: „Qui riceve la maga di Caldea“ (Hier empfängt die Magierin von C.). Wenn er jetzt zu Natalie hätte sagen können: Ich weiß, wo die Zauberin von Caldea wohnt. Er konnte von einer Terrasse des Aldo-Moro-Platzes auf den Bahnhof, auf das Dach der Bahnhofshalle und auf die Geleise schauen. Aber er stieg nicht hinunter.