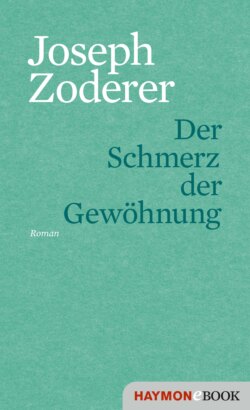Читать книгу Der Schmerz der Gewöhnung - Joseph Zoderer - Страница 18
14
ОглавлениеAls sie sich zum ersten Mal alleine in einer Großstadt trafen, in Rom, kam Mara in blauverwaschenen Jeans und einer Strohtasche, worin sie ihre paar Sachen hatte, aus ihrer Universitätsstadt Mailand, nach Tagen von Straßenkämpfen mit der Polizei (in ihrer Hochschule hatten sie Arbeitslose und Obdachlose zu Hunderten einquartiert und sich mit ihnen verbarrikadiert). Sie kam mit dem Morgenzug kurz nach sieben. Er wartete am Ende des Bahnsteigs im Gewühl der Ankommenden und Abreisenden und sah sie trotzdem sehr schnell, ihr weißes, schmales Gesicht, fast ohne Lächeln, die Augen scheinbar gesenkt, da kam sie mit müde geschwenkter Strohtasche, ihrem einzigen Gepäck, auf ihn zu. Sie liebten sich in einem rottapezierten Attica-Zimmer, das man nur über einer offenen Dachterrasse des Hotels erreichen konnte. Und nachdem sie auf ausgebreiteten Zeitungen, noch immer auf dem Bett, Wurst und Käse, auch kalte Hühnerstücke, zusammen mit Oliven und Essiggurken gegessen und Wein dazu getrunken hatten, lasen sie gemeinsam in dem Roman „Vogliamo tutto“. Ein wenig irritierte, ja befremdete ihn dieses Buch oder das Lesen darin, andererseits aber verstärkte diese Mischung von intimer Existenz und politischer Solidarität sein Daseinsgefühl, vor allem diese Liebe, und ließ ihn alles intensiver erleben, bewusster und weltverbundener.
Sonntags sonnten sie sich auf der Treppe der Piazza di Spagna, mit der Zeitung in der Hand, lasen von den Rückschlägen der Amerikaner in Vietnam, bummelten durch die Via Babbuino zur Piazza del Popolo, tranken unterwegs in einer Bar ein Glas Martini dry mit grüner Olive, schauten durch das Auslagenglas der Feltrinelli-Buchhandlung und lasen später auf den Marmorquadern des Forum Romanum wieder in „Vogliamo tutto“.
Wie das alles zugedeckt, so tief vergraben werden kann, sagte Mara damals in Rom, ich merke, wie unfähig ich bin, die Bilder wiederzufinden für meinen Vater. Oder hat man, fragte sie sich, mit einem Vater doch nicht viel Gemeinsames? Ihr Vater sei für sie vor allem abwesend gewesen, die meiste Zeit einfach nicht da gewesen, und wenn er zu Hause war, habe er gearbeitet —, und da mussten wir alle auf Zehenspitzen gehen. Ihr Vater habe sie oft in sein Arbeitszimmer gerufen, auf dessen Boden ein ockerfarbener Teppich lag, die Vorhänge aus goldglänzendem Damast (für Mara waren sie aus goldener Seide, damals). Hinter dem Tisch die Bücherstellage aus Nussholz, an der Wand gegenüber ein altes Madonnenbild aus seiner Geburtsstadt Agrigento. Auf dem im Barockstil nachgemachten Tisch – er hatte Holzwurmlöcher, worauf der Vater stolz gewesen sei wie auf einen Altertumsbeweis – musste Mara für den Vater multiplizieren und dividieren. Oft eine halbe, manchmal auch eine ganze Stunde lang. Sie tat dies nicht besonders gerne, ihr Vater habe sehr schnell die Geduld verloren, habe sie angeschrien: Rechne genau, kontrollier noch einmal, bist du ganz sicher, dass alles so stimmt, hast du dich nicht verrechnet? Sie sei ihm gegenüber gesessen an dem schweren Tisch, auf dem sich immer Berge von Papieren getürmt hätten. Er habe ihr nur kleinformatige Blätter gegeben, eine Art Blockzettel, es sei auch wenig Platz gewesen auf diesem Tisch zwischen den Aktentürmen. Während ich rechnete, erzählte Mara, stand er meistens auf und sah mir über die Schulter oder er ging auf und ab, und wenn ich mit allem fertig war, sagte er: Geh jetzt. Wahrscheinlich überdachte er, was herausgekommen war, und wollte nicht gestört sein.
Wann immer Mara von ihrer Kindheit erzählte, stand stets der Vater im Vordergrund, und vor allem sein Tod, der ihr den ersten und größten Verlust zugefügt hatte: An jenem Jahreswechsel im winterlichen Ferienhaus, mitten in den Vertrautheitstagen zwischen Weihnachten und Neujahr, plötzlich dieser Herzinfarkt und kein Arzt zu erreichen in dieser Feiertagszeit, genau an Silvester.
Damals, als Mara das letzte Jahr in die Oberschule ging, sprachen die italienischen Sportlehrer in Bozen den Namen ihres Vaters noch fast ehrfürchtig aus. Sein Name stand hier für das Erziehungssystem der Jugend unter Mussolini, er war für die Ausbildung der jungen Faschisten, für ihre sportliche und geistige Entwicklung verantwortlich gewesen. Aber Mara behauptete, sie habe sich nie besonders um die Vergangenheit ihres Vaters gekümmert. Als Jul sie einmal (noch vor Natalies Geburt) fragte, ob sie in ihrer Schulzeit etwas von der faschistischen Karriere des Vaters zu spüren bekommen habe, sagte sie mit einem halben Lächeln: Meine italienische Turnlehrerin behandelte mich besonders streng, anscheinend weil ich die Tochter von dem und diesem war, ich sollte wohl so etwas wie ein sportliches Vorbild abgeben. Ganz anders sei es ihr in der Volksschule ergangen, die sie in deutschen Klassen am Fuße des Skiberges „Kronplatz“ besucht hatte. Sie habe sich von Anfang an als etwas anderes als ihre Mitschülerinnen gefühlt, nicht als etwas Besseres oder Minderes, bloß als etwas anderes: Ich spürte, dass ich irgendwas nicht gemeinsam mit den anderen hatte, wusste aber nicht, was, später dachte ich – weil ich keinen deutschen Vater hatte.
Maras jüngerer Bruder Carmine, den Jul ebenfalls in der Garage kennengelernt hatte als einen linken Aktivisten, auch Carmine hatte sich angeblich nie belastet gefühlt von der Vergangenheit seines Vaters. Das Erste, was mir in den Sinn kommt, wenn ich an meinen Vater denke, hatte er zu Jul gesagt, ist sein Brüllen, sein Schreien, Papà war einer, der immer laut sein musste, jedenfalls bei uns zu Hause. Und einer, der – ganz gleich, ob in der Stadtwohnung oder im Ferienhaus am Land – sich stets mit vielen Menschen umgab, Freunden, Bekannten, Geschäftspartnern, immer schleppte er Gäste an, und Mama kochte und kochte, und wenn irgendetwas nicht so war, wie er es haben wollte, dann brüllte er los.
Carmine erzählte das in einem Tonfall, der ohne Vorwurf war, eher etwas wie Verständnis, auch Zuneigung anklingen ließ. Seine Augen zwinkerten belustigt. Carmine sprach von seinem Vater wie von einem, der in der Familie ein geliebter Kauz (oder ein geliebter Fremder?) gewesen war, einer, den man gern hatte und doch belächelte, jedenfalls jetzt, lange nach seinem Tod. So unbefangen wie Mara erzählte, dass sie sich auf Wunsch der Mutter in das Studio geschlichen habe und, während Papà dort sein Mittagsschläfchen hielt, aus seiner über einen Stuhl gehängten Jacke die Geldtasche herausstibitzte, so erzählte Carmine schmunzelnd von dem Barometer, auf dem sie dem Vater mehr als einmal Schönwetter-Aussichten herbeigeschwindelt hätten, Papà habe nämlich eine Art meteorologischen Tick gehabt und sich einen Dosenbarometer ins Speisezimmer gehängt, morgens, mittags und abends, vor und nach jeder Mahlzeit habe er einen prüfenden Blick darauf geworfen, und da er sich bei Schlechtwetteraussichten immer ärgerte, hätten sie manchmal heimlich die drehbare der zwei Lanzetten so eingestellt, dass Papà sich auf einen Sonnentag habe freuen können, wenigstens ein paar Stunden lang.
Eine andere Marotte sei die Absicherung der Besitzgrenzen gewesen, im Besonderen rund um das Ferienhaus. Papà habe zu diesem Zweck eines Tages eine große Anzahl von riesigen, leeren Blechdosen herangeschafft, Dosen, die einmal zehn Kilogramm Marmelade gefasst hatten, er, Carmine, habe sie (und wie stolz er auf diese Aufgabe gewesen sei!) mit Zement und Wasser füllen müssen – als eine Art Marksteine hätten diese Betondosen den Besitz abgrenzen sollen, da sie aber nie in die Erde versenkt worden seien, hätten die Nachbarn sie beliebig verrücken können.
Über Politik hatte Carmine angeblich nie mit seinem Vater geredet. Carmine war sechzehn, als sein Vater starb. Meine Freunde, gab er beim Mittagessen an einem Sonntag in ihrem Berghaus, kaum zwei Jahre nach Natalies Tod, zu bedenken, waren Italiener wie ich, keine deutschen Südtiroler, und sie hatten eigentlich alle ehemalige Faschisten als Väter. Mussolini hat nun einmal keine Kommunisten heraufgeschickt, um das deutsche Etschland zu italianisieren. Wie hätte ich Söhne von italienischen Kommunisten oder Sozialisten meines Alters kennenlernen können? Er war sich in diesem Augenblick seiner Distanz zur Vatervergangenheit so gewiss, dass er lachen konnte.
Carmine hatte eine begeisternde Pfadfinderzeit hinter sich, war mit sechzehn ein Oberfuchs gewesen. Schon ein paar Jahre zuvor waren in einer Herzjesu-Nacht (was Herzjesu für Andreas-Hofer-Tiroler bedeutete, begannen die Italiener im Lande erst damals allmählich zu erfahren) Dutzende von Strommasten in die Luft geflogen, die Landeshauptstadt Bozen war ohne Strom, Licht und Telefon. Und dann explodierten nicht nur Hochspannungsleitungen, sondern auch fast fertiggestellte Wohnbauten, die für italienische Zuwanderer aus dem Süden geplant waren.
Italien hatte den Südtirolern nach dem Zweiten Weltkrieg ihre kulturellen Rechte als Minderheit garantieren müssen, hatte aber dieses Versprechen dann die längste Zeit nicht eingehalten. Carmine wusste davon nichts, er wusste nur von den Anschlägen auf die Brenner-Bahnlinie, auf die „heiligen Gebeinhäuser“ der angeblich in Südtirol gefallenen Italiener und von den Anschlägen auf Carabinieri- und Finanzpolizeiposten. Also demonstrierte er mit seinen italienischen Freunden vor dem faschistischen Siegesdenkmal in Bozen („Von hier aus haben wir / die anderen / durch Sprache, Gesetze und Künste / veredelt“) gegen die Südtiroler Terroristen, gegen die Deutschen (Daitschn/crucchi) und marschierte mit Hunderten von grölenden MSI-Faschisten durch die Museumstraße zum Obstmarkt und schrie mit den anderen: „Siamo in Italia – Il Brennero è nostro – Qui si parla italiano!“ Und denk, was du dir heute denken magst oder musst: Aber ich habe drei Monate nach der letzten Anti-Südtirol-Demonstration mit meinen italienischen Mitschülern das italienische Lyzeum besetzt. Da war Papà noch nicht lange tot. Wir Söhne von Ex-Faschisten haben unsere Schule besetzt, und unser Vorbild war Rudi Dutschke. Von da an hatte ich auch Südtiroler Freunde, viele sogar, und sie sprachen wie meine Mutter deutsch. Eigentlich habe er sich, meinte schließlich Carmine, im Grunde nicht anders benommen als sein Vater. Denn wie er habe er sich gesellschaftlich einmischen wollen, etwas tun wollen, nicht abseits stehen, und sei so aktiv geworden in der außerparlamentarischen Bewegung. Natürlich seien Vaters Jugendzeiten anders gewesen, dennoch sei Papà Idealen gefolgt und einer der jüngsten politischen Führer seiner Stadt geworden, auch wenn freilich als Federale, als Parteiführer des Duce in seiner Stadt Agrigento, während er, Carmine, als Oberfuchs nur für zwanzig, später aber immerhin für vierzig Pfadfinder Verantwortung getragen habe – trotzdem.