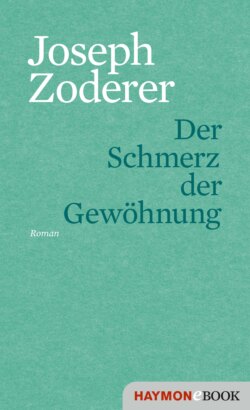Читать книгу Der Schmerz der Gewöhnung - Joseph Zoderer - Страница 24
20
ОглавлениеNatürlich wusste Mara bereits (wie vermutlich viele seiner Freunde in der Garage), dass er verheiratet und noch nicht geschieden war, er selbst hatte es ihr auf dem Spaziergang erzählt, als er den Ring seiner Mutter in den Bach warf. Und später in Rom hatten sie lange darüber geredet, während das erste Frühlingsgewitter, das sie gemeinsam erlebten, sich mit Blitz und Donner über der Stadt entlud; vom Bett aus sahen sie durch die offene Mansardentür, wie die dicken Regentropfen auf den Fliesen der Terrasse aufsprangen und zerplatzten. Er war schon fast drei Jahre von seiner Frau getrennt, hatte sich aber in all dieser Zeit nie ernsthaft Gedanken über eine Scheidung gemacht. Es war früher Nachmittag, als Mara und er dem Regentrommeln in Rom zuhörten, und Jul schwor sich wortlos, diese Nähe mit Mara für immer zu bewahren.
Mein Vater erzählte gerne, aber welche Geschichten? fragte Mara sich selbst in diesem römischen Hotelzimmer. Besonders erinnerte sie sich, dass er vom Krieg erzählte, und zwar vom Krieg in Albanien, doch sogar davon war ihr nur seine oft wiederholte Beschreibung der kahlen Berge in Erinnerung geblieben. Er wollte immer, sagte sie, dass ich Tänzerin würde, ich war noch sehr klein und durfte auf seinem Schoß sitzen, ich wollte ihn nicht enttäuschen und tanzte auf dem grauen Teppich in der Stube, bis ich schwindlig wurde und hinfiel. Später malte ich Bilder für ihn, er legte sie in eine Schublade, und als er starb, gab mir Mutter einige davon, und ich habe sie verloren.
Mara und Jul gingen nicht tanzen, das heißt, sie gingen nie auf einen Ball oder in ein Night, aber sie tanzten miteinander auf dem gemeindeeigenen Wiesenstück gegenüber dem väterlichen Ferienhaus. Sie tanzten auf dem Kirchweihfest im Juni, auf der Bretterbühne und zu den üblichen Schlagerschnulzen, deutschen Marsch- und Foxtrottrhythmen. Nein, sie gingen nie am Abend aus, um zu tanzen. Obwohl sie viel getanzt haben auf ihre Weise, wollte ihm scheinen, sogar wenn sie sich stocksteif gegenübersaßen und nichts als redeten.
Mara erzählte gerne von ihrer Kindheit, vom Leben in den Wäldern und auf den Wiesen rund um das Landhaus, aber sie erzählte auch gerne von den frühen Jahren in der Stadt, zuerst in dem villenartigen Haus hinter dem Corso d’Italia, an einem schmalen Wiesenkanal gelegen, in den sie ihre Füße hineintauchen konnte, an dem sie und ihr jüngerer Bruder Mühlen bauten und Bootsanlegestellen und in den sie einmal hineingerutscht und beinahe darin ertrunken wäre; dieser Stadtbach durchquerte kaum fünfzig Meter hinter dem Corso damals noch Wiesen mit Kirschbäumen und Weinpergeln. Nicht weit davon entfernt hatte ihr Vater eine ganze Häuserzeile errichten lassen, eine solide Miethäuserfront. Und das erste Haus davon stand, als es fertig war, für eine längere Zeitspanne beinahe idyllisch allein da; auf den Weinäckern an seiner Rückseite wurden im Frühherbst noch Trauben geerntet, während die Frontseite auf einen weiten, noch unasphaltierten Platz sah, den zwei protzige Gebäude aus der Faschistenzeit flankierten (mit breit angelegten Treppenaufgängen): der Justizpalast und das Finanzamt. Ich ging in die erste Klasse der Mittelschule, als wir von der Villa am Bach in das Haus am Gerichtsplatz zogen, erinnerte sich Mara. Links und rechts ihres Hauses sei noch an den anderen (vom Vater finanzierten) Häusern gebaut worden. Wir Kinder lebten zwischen Baustellen, es gab große Erdhügel, auf denen wir kurvige Bahnen für Murmeln anlegten, und auf der damals noch nicht geteerten, sondern mit weißem Splitterkies bedeckten Piazza spielten wir den Giro d’Italia nach. Der große, weite Platz sei für sie und für ihren jüngeren Bruder aber nicht nur Spielplatz, sondern im buchstäblichen Sinn auch ein Schauplatz gewesen, so etwas wie eine Kino- oder Theaterbühne, auf die sie vom Küchenfenster des dritten Stockes in schulfreien Stunden hinuntergeschaut hätten, zum Beispiel am Sonntag, wenn die Erwachsenen auf dem Kies „tamburello“ spielten, eine Art Schlagballspiel.
Später, sagte Mara, als aus der Piazza ein Parkplatz geworden sei, habe sie oft gegen Abend am Küchenfenster sitzend auf das Auftauchen von Vaters Auto gewartet. Immer wieder einmal habe sie mit ihrem Bruder Carmine die Autos gezählt, die vom Corso zum Gerichtsplatz einbogen. Und sie hätten gewettet, wer der Anzahl von Autos am nächsten käme, die innerhalb von einer oder von zwei bis drei Minuten auf den Parkplatz einfahren würden. Es war immer am Abend (er sah Maras Lächeln noch jetzt im Erinnern), und wir dachten nur an Vater und fragten uns, ob er jetzt oder in fünf Minuten oder wann endlich er mit seinem Fiat in den Platz einböge. Er war ja viel unterwegs, aber am Freitagabend kam er immer von Bruneck nach Hause, in Bruneck hatte er nach dem Krieg eine Kanzlei in der rötlichbraun getäfelten Stube unserer Großmutter, seiner Schwiegermutter, eingerichtet. Das Erste, was wir sahen, wenn er aus dem Auto stieg, war seine dicke, schwarze Aktentasche, die er aus der Tür hinausreckte, dann erst tauchte vorsichtig seine Stirnglatze auf, die weißseidigen Haare. Carmine rannte das Stiegenhaus hinunter, um Papà die Aktentasche abzunehmen, aber viel an Papier war darin nie, eher etwas zum Essen, oft ein großes Stück Speck, das er von einem bäuerlichen Klienten bekommen hatte. Wenn er guter Laune gewesen sei, habe Papà nach dem Abendessen meistens etwas erzählt, Carmine habe die Pantoffeln geholt und ihm die Straßenschuhe von den Füßen gezogen, und sie, Mara und Carmine, hätten links und rechts des grüngepolsterten Sessels sitzen dürfen, aber auf diesem Polstersessel sei Vater leider schnell müde geworden und eingeschlafen. Wir Kinder durften dann im Wohnzimmer nur mehr auf Zehenspitzen gehen, hatte Mara sich nicht nur im Hotelzimmer in Rom erinnert, sondern ihm auch noch später mehrmals erzählt: Mama ließ uns dort nicht einmal lesen oder die Schulaufgaben machen, ich habe noch heute Papàs Schnarchen nach dem Essen im Ohr.
Wirklich fröhlich sei Vater ausnahmslos an Sonntagen und Feiertagen gewesen, da habe Mama ja besonders üppig und köstlich gekocht, rotoli alla siciliana zum Beispiel, und dazu habe Papà meistens Freunde eingeladen. Wir Kinder, zürnte (im Nachhinein) Mara, auch wenn vergebungsvoll, durften dann aber am Tisch nicht dabei sein, wir hörten sie nur hinter der Wand kreischen, schreien, diskutieren, und sie aßen sehr lange und sehr viel.
An gewöhnlichen Tagen jedoch sei Vater oft müde und dann ein ganz anderer gewesen. Schon wenn Geringfügiges am Gewohnten gefehlt habe, sei er außer sich geraten. Nun ja, er habe Gemüse geliebt, habe Knoblauch sogar am liebsten zehenweise in den Mund geschoben, gekaut und geschluckt, besonders gerne habe er coste gegessen, weißgrünes Rippenmangold, in Wasser mit Knoblauch gesotten. Wehe aber, sagte Mara, es war einmal nicht richtig gesalzen oder nicht mit dem richtigen kleinen Maß Olivenöl angemacht, da konnte er jäh explodieren: Er kippte den Teller, schüttete alles auf den Boden, auf den Teppich des Speisezimmers. Ähnlich sei es mit seinem Pfeifenbesteck gewesen (dafür sei sie zuständig gewesen, nicht Carmine, betonte Mara fast noch mit Stolz), wenn diese läppische Nettapipa einmal nirgends zu finden gewesen sei, da habe Papà augenblicklich die Nerven verloren. Und dann sei dieses Zeug doch immer wieder unter seinen Papieren im Studiozimmer gelegen. Aber wir wussten ja auch, sagte Mara, dass es weder die zu wenig gesalzenen Mangoldstängel noch die verlegten Pfeifenbürsten waren, sondern irgendetwas uns Unbekanntes, das der Vater am liebsten auf den Teppich hingeschüttet hätte, um darauf herumzutrampeln. Anderseits, gab Mara zu bedenken, hielt Vater uns Kindern keine Predigten, dafür war Mama zuständig, aber er kümmerte sich sehr um unsere Ausbildung, hielt sich auf dem Laufenden, wie es in der Schule ging. Uns erzählte Mutter, dass sie im Krieg, als Vater unter anderem auch für die Ausspeisung in den Schulen zuständig war, immer mit den wenigen zugeteilten Lebensmittelkarten habe auskommen müssen; oft sei zu Hause keine Butter mehr gewesen, trotzdem habe Papà, der viele Lebensmittellager zu verwalten hatte, nie ein Stück mitgenommen und der Familie gebracht.
Er war auch nicht außerordentlich eitel, meinte Mara, allerdings legte er Wert darauf, gut gekleidet zu sein, er ging zum Schneider, weil er klein und dick war, und er kaufte auch den Stoff jeweils selbst. Und so wie er nur maßgeschneiderte Anzüge trug, ließ er sich die Schuhe von einem Schuster in Bruneck anfertigen, er freute sich über Solides. Leider, sagte Mara, rauchte mein Vater sehr viel, sie habe ihn oft in der Früh husten gehört, sei beinahe regelmäßig gegen fünf aufgewacht, weil er draußen auf dem Wohnungsflur gehustet habe, ein tiefes, röchelndes Husten.