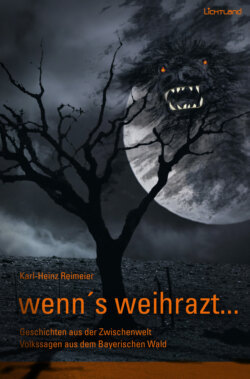Читать книгу wenn's weihrazt - Karl-Heinz Reimeier - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVorwort
Erzählatmosphäre
„Genau a so is` gwen!“ – „De Gschicht is wirkle woah!“ So oder ähnlich enden die meisten der Geschichten, welche den Gewährsleuten entweder durch Erzählungen bekannt sind oder die sie vielleicht sogar selbst erlebt haben. Nur – und das ist das Rätselhafte an diesen „Weihrazgeschichten“, eine schlüssige Erklärung hat noch keiner gefunden. Seit der Kindheit oder Jugendzeit tragen sie ihre Erlebnisse mit sich, Jahrzehnte lang, ein Leben lang. Manche können mit diesen unerklärlichen Erlebnissen entspannt umgehen, sie erzählen gerne davon. Andere wiederum tragen sie gleichsam verborgen mit sich, um in entsprechenden Situationen, Gesprächen und Ereignissen oft sogar schmerzlich daran erinnert zu werden.
Die Gesprächssituation mit dem Sammler und Volkskundler ist für die meisten Gewährsleute neu. Doch nach einer gewissen Zeit des Sich-Kennen-Lernens dauert es selten lange, bis beide eingefangen sind von der Atmosphäre dieser „ganz anderen Geschichten“. Wenn man in die leuchtenden Augen der Erzähler schaut, wenn man das Erregtsein verspürt, das beim Erzählen immer wieder durchbricht, wenn man die tiefe Ehrlichkeit fühlt, mit der sie hinter ihren Geschichten stehen, entwickelt sich zwischen beiden Seiten ein Vertrauen, in dem die „unerklärlichen“ Geschichten glaubhaft werden.
Erzählsituation
Während manche Gewährspersonen ohne Umschweife und unmittelbar zum Kern ihrer Erlebnisse kommen, führen andere allmählich und beinahe behutsam auf ihre Geschichte hin. Dazu nehmen sie sich Zeit, viel Zeit, um den Zuhörer aufnahmebereit zu machen und somit in die Lage zu versetzen, ihre Geschichten so authentisch wie nur möglich aufnehmen, vielleicht sogar miterleben zu können. In kürzeren oder längeren Hinführungen werden deshalb Orte, Personen, Begebenheiten und Situationen äußerst ausführlich beschrieben, bevor man sich an die eigentliche Geschichte wagt. Es geht dem Gewährsmann also auch darum, eine möglichst große Anschaulichkeit zu erzielen.
So führt zum Beispiel Berta Sigl (Thann, Gde. Schöllnach) zu Beginn ihrer umfangreichen und tiefgreifenden Erzählungen auf folgende Weise ein:
„Als ich noch klein war – ich würde ja noch viel mehr wissen, aber die haben mich immer weggeschickt, weil ich mich vor den Geistergeschichten immer recht gefürchtet habe. Die Leute haben sich im Winter vor der Stalltüre versammelt, so um vier oder halb fünf Uhr – und um halb sieben sind sie wieder heimgegangen. Und da sind diese „Weihazgeschichten“ immer erzählt worden. Da war ich fünf oder sechs Jahre alt.“
Anneliese Weidinger (Hundswinkel, Gde. Salzweg), selbst Autorin und Sammlerin von Geschichten, widmet der Hinführung zur Erzählsituation umfangreichen Raum. Ist der Zuhörer mit der originalen Umgebung vertraut, kann er den Gehalt des Geschehens intensiver verspüren.
… und do hands im Winta owei e da Kuchl zammkemma, net e da Wirtsstubm, wei do hättns extra eihoizn müassn. Na hand s olle en da Kuchl so um an Tisch uma gsessn. Do hand eah owei fünf, sechs Manna oda siebme, und do hamand s owei so Gschichtn vozejht. Und i bin do ois Diandl owei mitganga, wenn mei Muadda eahna ghoifa oda mitgoabat hot, und do han e owei zuagluust. E de Ferien bin i aa bo da Tante drinn gwen. Do han e de Manna owei zuagluust mit einer Wollust… und a Onkl vo mir, der hot Zughamanie spejn kinnt, und do hot a si do aussi gsitzt, wei drinn hot a net Zughamanie spejn derft, wei d Muadda owei gsogt hot: „Geh a mit dein Dulat!“ Iatz hot a si do aussi gsitzt und des hamd de Manna owei gern mögn – und i ha me dazua gsitzt und han dene Manna zuagluust.
Do is a Hirta aa dabei gwen, den wo owei s Schnupftawogtröpfe vo da Nosn owatropft is, der hot Gschichtn gwisst, wos eahm oiss passiert is, dass eahm d Hoar geberg gstandn hand, und i han a owei agschaut, so an Boat hot a ghot, olle hamd eahm owei zuagluust und dann hamd s wieder gsogt: „Iatzt host owa wieder aaftrumpft!“ „Des is echt woah! Schlog ei! Des is echt woah!“ Mein Gott, dann hamd s eahm wieder a Hoiwe zoiht, dass a wieder vozejht hot.
Und der hot Sachan vozejht vo de Hund mit de glüahradn Augn – und i ha ma oft nimma es Bett traut – mei Muadda hot dann owei gsogt: „Naa, naa, Deandl, des derfst net oiss glaubm!“ Ja, owa de oane Gschicht is ma unvergesslich, wei de hot a r owei wieder vozejht und is er aa dabei gwen, wia s den gfundn hamd.“
Dr. Otto Wiederer (Freyung, Lkrs. Freyung-Grafenau) erinnert sich noch genau an die Situation, in der er vom großen Innernzeller Brand gehörte hatte:
„Das ist die gruselige Geschichte vom großen Innernzeller Brand im Jahre 1911. Mein Großvater Eduard Wiederer hat sie mir erzählt. Ich weiß es noch genau, es war beim Grasmähen auf unserer Wiese bei der Asbergmühle. Mein Opa zeigte mir einen großen Stein auf dem Wege neben der Mühle. Er nannte ihn den ‘Weiazstoa‘. Da hat es sich abgespielt.“
Elisabeth Oswald (Steinach, Gde. Schöllnach) versucht zu erklären, warum solche und ähnliche Geschichten heute nicht mehr geschehen:
“Früahras hot s o so Sachan vej gebm. Owa des hört ma r iatz nimma. Do han i amoi glesn, a Papst hot des amoi ogschofft, wei so vej Leit durdraht hand. Oiso – mia hot des nix ausgmocht – ehrli – goa nix.“
Zum Gehalt der einzelnen Geschichten
In vorliegender Sammlung ist es unwesentlich, ob die Inhalte einer Geschichte spannend sind oder nicht, ob sie überflüssig erscheinen oder gar banal, so dass man meinen könnte, sie seien nicht der Rede – oder wie hier – des Aufschreibens wert. Dem widerspricht der Grundgedanke des Dokumentierens. Für den Erzähler sind die Geschichten von tiefem Wert, sie ziehen sich durch Generationen, sind in Familien- oder auch Ortsgemeinschaften verhaftet und mit großer Ernsthaftigkeit abrufbar. Dass im Zeitenlauf einzelne Themen durcheinander geraten, miteinander vermischt und zu neuen Geschichten umgewandelt werden, ist der Eigenart der mündlichen Überlieferung zuzuschreiben. Gleich, welchen Gehalts die Geschichten sind, worauf es letztendlich ankommt, ist das Unerklärliche von Ereignissen, Situationen oder Erscheinungen, die den Zuhörer oft noch mehr gefangen nehmen als den Leser.
So sagt die Erzählerin Erna Boxleitner mit Recht: „Sechane Gschichtl kam a net erfindn. Wenn s eahm net passiert is, ka ma s net wissen!“
Sprachliche Umsetzung
Die Mundartschreibung hält sich so weit wie möglich an die Sprache der Gewährspersonen. Dadurch soll die Originalität der Erzählungen erhalten bleiben. Bei intensivem Lesen und Vergleichen kann der sprachinteressierte Leser kleinere und größere Unterscheidungen erkennen, die ihm örtliche und regionale Einordnungen und Zuweisungen ermöglichen. Bei der Umsetzung in die Schriftsprache ging es dem Autor darum, möglichst nahe am Kern und Wahrheitsgehalt der Erzählung zu bleiben, andererseits aber auch darum, die Geschichten für jedermann lesbar und nacherzählbar zu machen. Außerdem wurde, wenn es möglich war, versucht, mit sprachlichen Mitteln an geeigneten Stellen ein gewisses Maß an Spannung einzubauen.
Entstehung des Buches
Die vorliegende Sammlung ist aus drei großen Teilen erwachsen. Ein Teil ergibt sich aus der Sammeltätigkeit in den 80er – und teilweise 90er Jahren. Aus dieser Zeit existieren Fotos von den Gewährsleuten nur sehr spärlich. Der zweite Teil beinhaltet die Geschichten, die in den Jahren 2011, 2012 und 2013 aufgenommen wurden, wobei die Gewährspersonen fotografisch dokumentiert wurden. Der dritte Teil beinhaltet die Bereiche „Aberglaube“ und „Ungewöhnliche Maßnahmen, wie man sich gegen Krankheiten und anderen Wehdam schützen kann“, wobei Querverbindungen zu den beiden vorhergehenden Bereichen immer wieder erkennbar sind.
| Karl-Heinz Reimeier | Sommer 2013 |