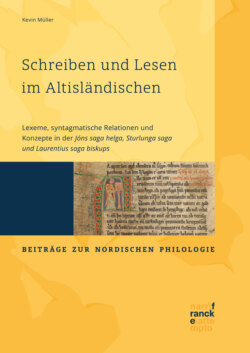Читать книгу Schreiben und Lesen im Altisländischen - Kevin Müller - Страница 13
1. Der mittelalterliche Wortschatz des Schreibens
ОглавлениеWährend die Themenfelder Schriftsystem, Schriftlichkeit, Schriftkultur, Schriftträger, schriftliche Texte und Lesen schon seit langem in der Linguistik, Kodikologie, Paläographie, Philologie, Anthropologie, Literatur- und Geschichtswissenschaft grosses Forschungsinteresse erfahren haben, ist der Akt des mittelalterlichen Schreibens viel weniger gründlich untersucht worden (vgl. Ludwig 2005: 2). Dabei unterscheiden sich die damaligen Schreibpraktiken von den heutigen in vielen Aspekten, denn im Mittelalter waren Schreiben und Verfassen zwei getrennte Prozesse, die sich erst im Laufe des Spätmittelalters vereinten. Das Konzept SCHREIBEN beinhaltete lediglich auf- oder abschreiben, während VERFASSEN einen rhetorischen Akt darstellte, d.h. der zu schreibende Text wurde als Rede konzipiert. Dazu gehören in der klassischen Rhetorik drei Schritte 1. die inventio, die Findung der Gedanken, 2. die dispositio, die Organisation in einen Text, und 3. die elocutio, die Ausformulierung in einzelnen Sätzen und Wörtern, welche zum Schluss dem Schreiber diktiert wurden (Beleg Ludwig 2005: 68). Diese Praxis äussert sich auch im lateinischen Wortschatz, denn scribere bedeutet allein ‚aufschreiben‘. Für das Diktieren wurde im klassischen Latein das Verb dictare verwendet und das Verfassen floss Ende der römischen Kaiserzeit in die Bedeutung von dictare ein, so dass sie sich vom ‚Diktieren‘ auf das ‚Verfassen‘ erweiterte (vgl. Ludwig 2005: 131f.). Die unterschiedlichen Konzepte VERFASSEN und SCHREIBEN widerspiegeln sich also in den mittellateinischen Verben dictare und scribere. Beim Schreiben spielt nicht nur die Unterscheidung in Schreiben und Verfassen eine Rolle, sondern auch der Anteil des Eigenen und Fremden im Geschriebenen. Der Scholastiker Bonaventura unterscheidet dabei in vier Rollen scriptor, compilator, commentator und auctor. Der scriptor schreibt nur ab, also nichts Eigenes. Beim compilator und commentator ist der Anteil an Eigenem kleiner als jener des Fremden, wobei der commentator das Eigene als Erklärung hinzufügt. Beim auctor ist dieses Verhältnis von Eigenem und Fremdem hingegen umgekehrt ist (vgl. Ludwig 2005: 146). Ludwig geht nicht darauf ein, wie sich dieses Verhältnis von Eigenem und Fremden bei den verba scribendi widerspiegelt.
Noch im 12. Jahrhundert diktierten die Autoren ihre Werke mehrheitlich einem Schreiber, welche das Diktat auf einem Wachstäfelchen festhielten und dann auf dem Pergament ins Reine schrieben. Das 13. Jahrhundert stellt eine Übergangsphase dar, in dem immer mehr Autoren ihre Texte selbst schrieben. Schreiben und Verfassen wurden, wie es die Paarformel scribat et dictat ‚er/sie schreibt und diktiert/verfasst‘ zeigt, lexikalisch noch getrennt, wobei beide Handlungen von derselben Person ausgeführt wurden. Im 14. Jahrhundert wurde das selbständige Schreiben der Autoren allmählich die Regel, was sich dann auch auf die Bedeutung von scribere gegen Ende des Mittelalters auswirkt (vgl. Ludwig 2005: 127–132). Beim Briefeschreiben übernahm der Schreiber schon früher die elocutio, weil die inventio vom Absender und die dispositio vom Briefformular vorgegeben waren. Schon Ende des 13. Jahrhunderts wurde von Beamten erwartet, dass sie Briefe verfassen (dictare litteras) konnten (vgl. Ludwig 2005: 149–152).
Innerhalb der nordischen Philologie wurden bisher zwei Themenbereiche des Schreibens näher untersucht: das Schreiben von Runen und das Schreiben der mittelalterlichen Autoren. Obwohl diese Forschung nicht um den Wortschatz herumkommt, ist der mittelalterliche Wortschatz des Schreibens im Gegensatz zum Schreiben der Runen nie systematisch im Rahmen eines grösseren Korpus untersucht worden, sondern es wurden meistens einzelne Belege herangezogen. Im Folgenden soll diese Forschung kurz abgerissen werden, von den Runen ausgehend, denn die Geschichte der Schrift beginnt im Norden Europas mit diesem Schriftsystem, dessen älteste Funde aus der Zeit um 200 n.Chr. stammen. Im Gegensatz zum Schreiben der lateinischen Schrift ist jenes der Runen relativ gründlich von Linguisten erforscht worden: Schulte (2002) untersucht das Wortfeld der Runenproduktion („semantic field of runic production“) in der urnordischen Periode. Dabei kommen drei semantisch weite verba faciendi vor: *taujan/tawōn ‚machen, vorbereiten, herstellen‘, *wurkijan ‚machen, tun, arbeiten‘ und *dālijan (ein Hapaxlegomenon, vermutlich mit der Bedeutung ‚machen, herstellen‘). Ihnen fehlt zum Teil das Akkusativobjekt, so dass nicht zu entscheiden ist, was eigentlich gemacht wurde, die Inschrift, der Schriftträger oder etwas anderes. Die Verben *taujan/tawōn und *dālijan sind in der altnordischen Periode nicht mehr bezeugt, *wurkijan lebt dagegen phonologisch und semantisch verschoben als yrkja ‚dichten‘ weiter. Gemäss Schulte (2002: 58f.) gilt diese Bedeutung für die urnordische Periode nicht, als das Verb die Bedeutung ‚machen, tun; arbeiten‘ wie die Kognaten in anderen älteren germanischen Sprachen wie got. waurkjan, aengl. wyrcian oder ahd. wurchen hatte. Es lässt sich auch nicht beweisen, dass diese Bedeutungsverengung von ‚machen‘ zu ‚dichten‘ mit dem in urnordischer Zeit häufig belegten Akkusativobjekt rūnō(z) ‚Rune(n)‘ zusammenhängt, indem das Verb seine Bedeutung vom äusserlichen Machen der Schrift auf das inhaltliche Machen von Texten oder Gedichten verengt hat. Eine engere auf handwerkliche Tätigkeiten bezogene Bedeutung haben die beiden Verben *talgijan ‚kerben, ritzen, schnitzen‘ und *faihijan ‚malen, schmücken‘. Sie referieren auf das Einritzen und Bemalen der Inschrift, sind aber weitgehend synonym mit den verba faciendi (vgl. Schulte 2002: 660). Das Verb par excellence für das Schreiben von Runen ist das relativ häufig belegte *wrītan, das mehrfach mit dem Akkusativobjekt rūnō(z) ergänzt ist (vgl. Schulte 2002: 661). Die Verben *faihijan und *wrītan kommen als anord. fá und ríta in wikingerzeitlichen Runeninschriften weiterhin vor, sind aber in den norwegischen Inschriften im jüngeren Fuþark, welche Spurkland (1994: 4–7) ausgezählt hat, nicht die häufigsten verba scribendi, denn fá ist nur einmal sicher belegt und ríta 15 Mal, während das Verb rísta ‚ritzen‘ mit 78 Belegen und das 14 Mal belegte schwache synonyme Pendant rista deutlich überwiegen. Nur vereinzelt kommen die Verben gera ‚machen‘, skrifa ‚schreiben‘, penta ‚malen‘, marka ‚markieren, kennzeichnen‘, berja ‚schlagen‘ und hǫggva ‚hauen‘ vor, während das schwache Verb rita gar nicht belegt ist. Die weniger häufige Verwendung der Verben ríta und skrifa hängen wahrscheinlich mit der lateinischen Schriftkultur zusammen, denn Spurkland vermutet, dass urnord. *wrītan bzw. anord. ríta als Verb für das Runenschreiben im Norden verschwindet und durch andere Verben wie rísta ersetzt wird. Hingegen etabliert sich ríta als Terminus in der lateinischen Schriftkultur, beeinflusst durch das aengl. wrītan, weil die Britischen Inseln die westnordische Schriftkultur in der Anfangszeit wesentlich prägten. Daneben breitet sich auch das schwach konjugierte Pendant rita aus. Das Verb skrifa ist aus dem Mittelniederdeutschen entlehnt und noch im 13. Jahrhundert nur vereinzelt belegt, im 14. Jahrhundert hingegen schon wesentlich häufiger. Je nach Schriftsystem werden also in norwegischen Runeninschriften unterschiedliche Verben verwendet, für das Ritzen von Runen vor allem rísta und rista und für das Schreiben lateinischer Buchstaben ríta, rita und skrifa. Eine ähnliche lexikalische Differenzierung zwischen ráða und lesa gibt es für das Dekodieren der beiden Schriftsysteme (vgl. Kap. III.1.). Spurkland (2004: 334f.) stellt zwei Arten von Schriftlichkeit fest, die sich sprachlich, schriftlich und materiell unterscheiden. Die lateinische Schriftlichkeit ist nicht nur an das lateinische Alphabet, sondern auch an die lateinische Sprache gebunden, sowie an Feder, Tinte und Pergament. Es gibt aber durchaus Ausnahmen wie die in Runen geschriebene, altnordische Pergamenthandschrift Codex Runicus (AM 28, 8vo), oder Runeninschriften in lateinischer Sprache. Um die runische Schriftlichkeit von der lateinischen unterscheiden zu können, kreiert Spurkland (2004: 340f.) analog zu literacy den Terminus runacy. Das Verhältnis von Schreiben und Verfassen bezieht Spurkland in sein Modell nicht mit ein.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der altnorwegische Wortschatz entlang dieser beiden Schriftlichkeiten sprachlich, materiell und schriftlich unterscheidet, wobei es zahlreiche Schnittmengen im Wortschatz und auch im Gebrauch der Schriftsysteme gibt. Trotzdem lassen sich eine stereotype literacy und runacy als Ausgangspunkt nehmen.
Bei der Erforschung des Schreibens im lateinischen Alphabet ist vor allem die Autorschaft der Texte von Interesse. Lönnroth (1964: 58, 84) beschäftigt sich im Zusammenhang der Schreiber- und Verfassertätigkeit isländischer Laien auch mit dem Wortschatz des Schreibens in verschiedenen Quellen, v.a. in Prologen und der Sturlunga saga. Wie im Lateinischen lässt sich der Wortschatz im Altisländischen in zwei Gruppen, Schreiben und Verfassen, einteilen. Zu ersterer zählt Lönnroth die Verben rita, ríta und skrifa, auf deren möglichen Bedeutungsunterschiede er nicht näher eingeht. Rita kommt zudem in der Kausativkonstruktion láta rita ‚schreiben lassen; etwas Geschriebenes in Auftrag geben‘ vor, deren Subjekt der Auftraggeber (beställare) ist. Dieser Auftrag wurde dann von einem oder mehreren Schreibern ausgeführt, wofür Lönnroth (1964: 54, 58, 84) zahlreiche Beispiele nennt. Zudem ist rita im Briefverkehr synonym mit senda ‚senden‘, d.h. es erfährt eine metonymische Verschiebung und darf nicht als ‚aufschreiben‘ verstanden werden. Die Verben der letzteren Gruppe unterscheiden sich semantisch voneinander: setja saman entspricht dem lateinischen componere und steht für die kompilatorische und redaktionelle Tätigkeit, während dikta in den ältesten Belegen ‚vorschreiben‘ später ‚verfassen, stilistisch ausformen‘ bedeutet und somit semantisch lat. dictare entspricht (vgl. Lönnroth 1964: 17). Von dictare ist auch segja fyrir beeinflusst und bedeutet einerseits ‚bestimmen, vorschreiben‘, andererseits ‚diktieren, verfassen‘, wobei es schwierig zu entscheiden ist, welche dieser beiden Bedeutungen in den einzelnen Belegen zutrifft (vgl. Lönnroth 1964: 18, 59, 82). Dies ist bei Quellenbelegen zur Autorentätigkeit gerade entscheidend, denn bei der Bedeutung ‚bestimmen, vorschreiben‘ wäre das Subjekt von segja fyrir der Auftraggeber und nur bei ‚diktieren, verfassen‘ der Autor.
Einen expliziten „semantic approach“ wagt Steblin-Kamenskij (1966: 24–28) bei der Untersuchung des altnordischen Autorenbegriffs, in dessen Rahmen er sich auch mit der Bedeutung der altnordischen Verben des Schreibens auseinandersetzt. Dabei stützt er sich hauptsächlich auf Wörterbücher und einzelne Belege. Er unterscheidet zwar zwischen den Konzepten SCHREIBEN und VERFASSEN, überträgt diese aber zu wenig konsequent ins Englische, so dass bei der Verwendung von write nicht in allen Fällen klar ist, ob es sich um ‚aufschreiben‘ oder ‚verfassen‘ handelt. Obwohl er das mittelalterliche Schreiben als scribal activity versteht, übersetzt er setja saman als writing und compiling, so dass auch da unklar bleibt, ob das Subjekt von setja saman ein Schreiber oder Verfasser ist. Zu write zählt er die Verben rita (ríta), skrifa, setja saman, setja á bók, samsetja. Segja fyrir, sitja yfir, ráða fyrir und láta rita identifiziert er mit dictate und compose. Das Verb dikta verengt er auf Latin composition. Setja saman scheint hingegen eine engere Bedeutung ‚kompilieren‘ zu haben und dikta ‚verfassen auf Latein‘.
Auf Steblin-Kamenskijs Untersuchung stützt sich Tómasson (1988: 181–184) in seiner Arbeit zu den Prologen isländischer Sagaschreiber (formálar íslenskra sagnaritara) im Kapitel zur „Arbeit oder Schöpfung“ (vinna eða sköpun) dieser Sagaschreiber. Er stellt darin fest, dass der Grenzraum zwischen Schreiber und Kompilator dünn sei. Zu einem ähnlichen Schluss kommt Würth (2007) in ihrer Untersuchung zu mittelalterlichen Übersetzungen ins Altnordische, nämlich dass je nach Situation Teile wörtlich übersetzt, andere geändert wurden. Sie bezeichnet diese Arbeitsweise als Patchwork-Produktion. Dies entspricht im Übrigen dem mittelalterlichen Kopierverständnis, bei dem keine vollständige und exakte Abschrift angestrebt wurde (vgl. Ludwig 2005: 85). Vermutlich wurden die vier Rollen Bonaventuras auch gar nicht so klar getrennt. Dies bedeutet natürlich nicht, dass diese verschiedenen Arbeitsweisen nicht lexikalisch unterschieden wurden, was ebenfalls die oben erwähnte Paarformel scribat et dictat demonstriert.
Es lässt sich so weit festhalten, dass zu den bei Spurkland (1994, 2004) schon erwähnten Verben rita, ríta und skrifa, welche wahrscheinlich für Aufschreiben (lat. scribere) stehen, bei Lönnroth (1964) und Steblin-Kamenskij (1966) verschiedene Verben für das Verfassen wie dikta, segja fyrir und setja saman hinzukommen, welche semantisch weitgehend mit lat. dictare übereinstimmen. Dabei steht setja saman wahrscheinlich für die Tätigkeit von Bonaventuras compilator und dikta für die elocutio in der Rhetorik.
Auch die jüngste Forschung beschäftigt die Frage der Autorschaft in der altnordischen Literatur und der damit verbundene Wortschatz des Verfassens, wie folgende beide Aufsätze zeigen: Tómasson (2012: 240) unterscheidet zwischen Verfassen von Versen mit dem oben schon erwähnten Verb yrkja und teilweise metaphorisch smíða ‚schmieden‘, sowie von Prosa mit den Verben semja ‚verfassen‘, gera ‚machen‘ und setja saman ‚kompilieren‘. Gera wird aber durchaus für Skaldenstrophen verwendet (vgl. Mundal 2012: 217). Im Prolog der Íslendingabók verwendet Ari inn fróði das Verb gera für sein Werk, dessen Verfasser und Schreiber er ist, so dass gera beide Tätigkeiten abdeckt (vgl. Tómasson 2012: 243) und somit ein Hyperonym darstellt. Auf Verben wie rita und skrifa, welche ebenfalls in diesen Prologen vorkommen, geht Tómasson nicht näher ein. Mundal (2012: 222f.) präsentiert für setja saman drei Lesarten: 1. „to describe composition at the oral stage“, 2. „to describe the work of the original author“ und 3. „about the rewriting process“. Diese Dreiteilung ist allerdings problematisch, weil Mundals Lesarten zu sehr vom Kontext der Einzelbelege abhängen. Das orale Verfassen deutet Mundal anhand eines Belegs aus der Þorgils saga ok Hafliða, einem Teil der Sturlunga saga, der nur in frühneuzeitlichen Abschriften erhalten ist. Die Szene handelt zwar im Jahre 1119, als noch keine Sagas aufgeschrieben worden waren, aber die Kompilation ist um 1300 entstanden, so dass bei setja saman ein Verfassen in einem schriftlichen Kontext, was der Auffassung dieser Zeit entspricht, nicht ausgeschlossen werden kann und sich nicht grundsätzlich von der zweiten Lesart unterscheidet, die sie aus einem Beleg aus der Flateyjarbók interpretiert hat. Auch die dritte Lesart ist lediglich ein Aspekt des Kompilierens, indem Textteile neu zusammengesetzt werden. Auf die Bedeutungen der Verben rita und skrifa wie auch segja fyrir, die ebenfalls in einem zitierten Prolog der Sverris saga vorkommen, geht Mundal (2012: 222, 224) wie Tómasson nicht näher ein. Beide Aufsätze argumentieren hauptsächlich mit Einzelbelegen, ohne deren unterschiedliche, zeitliche und handschriftliche Kontexte zu berücksichtigen. Gerade die prominenten Prologe der Íslendingabók und Hungrvaka sind nur in frühneuzeitlichen Handschriften erhalten. Bei der Analyse von Einzelbelegen muss auch die Frage berücksichtigt werden, ob deren Bedeutung überhaupt konventionell ist. Gerade im Fall von setja saman trifft Tómassons Lesart, die auch mit jener Lönnroths übereinstimmt, in allen drei von Mundal erwähnten Belegen zu. Diese Prologe und Einzelbelege sind zwar wichtige Quellen für die mittelalterliche Schriftlichkeit, aber für die linguistische Analyse des Wortschatzes problematisch. Auch der Vergleich mit Lönnroths Resultaten zeigt, dass Unterschiede in den untersuchten Wortfeldern und Texten bestehen.
In meiner Lizentiatsarbeit habe ich die Terminologie der Schriftlichkeit in der Sturlunga saga untersucht; ein Teil der Ergebnisse wurde in einem Artikel zum Schreiben und Lesen in der Sturlunga saga publiziert (vgl. Müller 2018). Im Gegensatz zur obigen Forschung ist dies erstmals eine Analyse im Rahmen eines Textkorpus, in welchem neben der Mehrheit der oben besprochenen Verben (gera, rita, rísta, ríta, segja fyrir, setja saman) noch ein weiteres dazukommt: skrásetja. Das Verb ríta ist nur zweimal sicher als Partizip Perfekt in den expliziten Textverknüpfungen sem fyrr var ritit ‚wie vorher geschrieben wurde‘ belegt (vgl. Müller 2018: 146). Da diese Textverknüpfungen in der Handschrift auf eine in der lateinischen Schrift geschriebene Textpassage verweisen, können bei ríta Runen sicher ausgeschlossen werden. Ausserdem handelt es sich um Aufschreiben bzw. Abschreiben, da der Nebensatz auf das vorher Geschriebene in der Handschrift verweist. Beim einmal belegten Verb rísta ist die Situation weniger klar, weil das Schriftsystem nicht explizit genannt ist. Es handelt sich um eine in der Saga zitierte altisländische Strophe (vísa) auf einem Holzstäbchen (kefli), so dass das Verb materiell und sprachlich sicher auf die runacy verweist (vgl. Müller 2018: 151). Beim häufig belegten rita fragt sich, ob es in einem spätmittelalterlichen Text bereits die Komponente VERFASSEN in der Bedeutung enthält. Wie die beiden Belege von ríta kommen auch die meisten Belege von rita in den expliziten Textverknüpfungen sem fyrr var ritat vor, weshalb dieses Verb mit ríta synonym angesehen werden kann und auf etwas in lateinischen Buchstaben Geschriebenes verweist. Weitere Belege kommen in Kommentaren zu Auslassungen vor, d.h. rita verweist darauf, was in der vorliegenden Handschrift nicht (mehr) schriftlich festgehalten ist, und bedeutet ebenfalls ‚aufschreiben‘ oder ‚abschreiben‘ (vgl. Müller 2018: 146f.). Auch die Belege im sogenannten Prolog verweisen auf die Sagas, die tatsächlich schriftlich festgehalten sind. In der Erzählung der einzelnen Sagas kommt rita dagegen nicht so häufig vor. In drei Belegen ist das Verb Teil der Kausativkonstruktion láta rita/ríta ‚(auf-/ab-)schreiben lassen‘, die auch Lönnroth (1964) und Steblin-Kamenskij (1966) schon erwähnt haben und deren Subjekt Mitglieder der Sturlungenfamilie sind, während die Schreiber unbekannt bleiben. Wie stark das Subjekt in den Schreibprozess integriert war, bleibt offen. Weitere drei Belege haben eine Ergänzung mit der Präposition til, welche auf schriftliche Korrespondenz verweist. Hier ist das Subjekt wahrscheinlich nicht der Schreiber, sondern lediglich der Absender (vgl. Müller 2018: 147–150). Auch dies stimmt mit Lönnroths (1964) Feststellung überein, dass rita in der Korrespondenz synonym mit senda ‚senden‘ ist. Er geht aber nicht näher auf die Valenz von rita ein. Zwei weitere Belege sind schwierig zu interpretieren. Beim einen Beleg verweist rita auf die Schreibarbeit eines Priesters und beim anderen geht es um einen Eintrag in ein Jahrzeitbuch, wo das Subjekt wohl den Eintrag tatsächlich selbst verfasste und schrieb. Die Komponente VERFASSEN kann also nicht bei allen Belegen sicher ausgeschlossen werden (vgl. Müller 2018: 148f.). Die Analyse zeigt, dass die Bedeutung von den unterschiedlichen Valenzen abhängt: Bei láta rita, handelt es sich wohl um Auf- bzw. Abschreiben im Rahmen eines Auftrags oder Diktats, bei rita til um das Versenden eines Briefes, dessen Schreiber nicht mit dem Absender identisch sein muss.
Schwierig von rita abzugrenzen, sind die beiden Belege von skrásetja mit der wörtlichen Bedeutung ‚aufs Pergament setzen‘, das vermutlich ‚in einer Liste aufschreiben‘ bedeutet. In der Bildung ähnlich und ebenfalls schwer von rita zu unterscheiden, sind die Kollokationen gera bók bzw. bréf mit der wörtlichen Bedeutung ‚ein Buch bzw. einen Brief machen‘ (vgl. Müller 2018: 150–152). Laut Tómasson (2012) vereint gera im Prolog der Íslendingabók die Konzepte SCHREIBEN und VERFASSEN, was in der Sturlunga saga im Falle von gera bók tatsächlich zutreffen könnte, da das Subjekt der Kollokation vermutlich Verfasser und Schreiber des Buches war. Dies könnte darüber hinaus auch für gera bréf gelten.
Das Verb segja fyrir, welches nur einmal im sogenannten Prolog belegt ist, stellt die semantische altisländische Entsprechung des lateinischen dictare dar, da es zum einen ‚vorsagen, befehlen‘ bedeutet, zum anderen im Kontext des Beleges sowohl ‚diktieren‘ als auch ‚verfassen‘ meinen kann. Weil es sich hier lediglich um einen Einzelbeleg handelt, fragt sich, ob ‚diktieren, verfassen‘ eine konventionelle Bedeutung von segja fyrir ist (vgl. Müller 2018: 153f.).
Mehrfach belegt ist das Verb setja saman ‚zusammensetzen‘, das wohl eine Lehnübersetzung des lateinischen componere ‚zusammensetzen; verfassen‘ ist (vgl. Müller 2018: 153). Die zweite Lesart ‚verfassen‘ passt auch in die Kontexte der Sturlunga saga. Es bleibt jedoch auch hier offen, wie stark das Subjekt von setja saman in den Prozess des Verfassens integriert war. Ein Massstab wäre die Dreiteilung der klassischen Rhetorik, ein anderer eine oder mehrere von Bonaventuras Rollen.
Die Sprache der Sturlunga saga unterscheidet ähnlich wie das Lateinische in ein konkretes Auf- bzw. Abschreiben (rita, ríta) und ein rhetorisches Verfassen (setja saman, segja fyrir), wobei nicht ganz klar ist, ob die Subjekte die Kriterien eines auctor oder compilator erfüllen. Der eine Beleg von rísta deutet darauf hin, dass in der Sturlunga saga zwischen Spurklands runacy und literacy unterschieden wurde, so dass rita und ríta im Besonderen ‚mit lateinischen Buchstaben auf Pergament auf- und abschreiben‘ bedeuten, rísta hingegen auf das epigraphische, möglicherweise runische Schreiben bezogen sein konnte. Ins Wortfeld schwierig einzuordnen sind die vereinzelt belegten Verben skrásetja und gera. Ersteres ist wohl ein Hyponym zu rita/ríta, da es ‚auflisten‘ bedeutet, letzteres umfasst als Hyperonym die Akte Schreiben und Verfassen. Die vielen Belege von rita zeigen, dass die Bedeutung von der Valenz abhängt, so dass eine Dichotomie von Verfassen und Aufschreiben zu kurz greift und der Polysemie des Verbs nicht gerecht wird.
Die hier vorgestellte Untersuchung in einem Textkorpus zeigt, dass die meisten der bisher erforschten Lexeme darin vorkommen und dass sie mit der Wortfeldtheorie systematisch verglichen werden können. Jedoch kommt auch eine grosse Kompilation wie die Sturlunga saga an ihre Grenzen. Dies äussert sich darin, dass gewisse Lexeme nur vereinzelt belegt sind, was deren Analyse erschwert. Das Lexikon muss also in einem noch umfassenderen Korpus analysiert werden. Ausserdem ist ein anderer theoretischer Ansatz nötig, weil die Wortfeldtheorie und Komponentialsemantik an ihre wohlbekannten Grenzen stossen. Die Bedeutung ist zu komplex, als dass sie in binäre Komponenten zerlegt und in ein zweidimensionales Gefüge eingeordnet werden könnte. Von diesem Entweder-oder ist auch die bisher diskutierte Forschung geprägt, deren Dichotomie von Schreiben und Verfassen vor allem vom Medienwandel von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit geprägt begründet ist.
Neuere Arbeiten haben diese Perspektive allerdings geöffnet. Glauser (2010) beispielsweise bezieht in seiner Untersuchung des Schrift- und Medienbewusstseins in den Prologen verschiedener altisländischer Werke Aspekte der mittelalterlichen Schriftlichkeit mit ein, welche über die Dichotomie von Mündlichkeit und Schriftlichkeit hinausgehen. Einige dieser Aspekte nennt schon Porzig (1973/1934: 83) in seiner Definition von schreiben wie z.B. den Körper (Hand), die Materialität (Schreibmaterial, Schreibwerkzeug), Zeichen oder die Sprache (s.a. Kap. I.3.). Den Körper thematisiert bei Glauser (2010: 313, 326) beispielsweise ein Schreiber in seinem Kommentar, in dem er über die Anstrengung der Augen (augu), Zunge (tunga) und der Hand (hǫnd) klagt. Er nennt im selben Kommentar auch Feder (penni), Tinte (blek) und Pergament (bókfell), welche in den Bereich der Materialität gehören. In den Prologen werden hingegen wesentlich öfter Schriftträger wie bók ‚Buch/Kodex‘, bœklingr ‚Büchlein‘ skrá ‚Pergament, Schriftstück, Dokument‘ erwähnt und auch mit Verben wie gera ‚machen‘, sýna ‚zeigen‘ oder sjá ‚sehen‘ auf sie verwiesen, welche neben der Materialität auch die Visualität des Schriftträgers hervorheben (vgl. Glauser 2010: 313f., 319). Hier ist allerdings einzuwenden, dass gera nicht unbedingt so wörtlich verstanden werden darf, dass dabei der Schriftträger bók gemacht wird, denn bók kann metonymisch für Skript und Text stehen. Auf das Skript oder den Text wird auch mit dem Lexem letr ‚Schrift, Buchstabe, Text, Brief‘ verwiesen. Es spielen also auch immaterielle Aspekte eine Rolle. So gibt es eine Reihe von Bezeichnungen für Textsorten wie saga ‚Saga, Geschichte‘, lǫg ‚Gesetz‘, mannfrœði ‚Biographie‘, þáttr ‚Saga, Erzählung‘ (vgl. Glauser 2010: 315, 317). Mit den Textsorten sind wiederum verschiedene Termini für das Verfassen verbunden wie setja saman ‚zusammensetzen, verfassen‘, láta rita/skrifa ‚(auf)schreiben lassen‘, gera sǫgur ‚Geschichten machen‘ (Glauser 2010: 319). Beim Verfassen werden bestimmte Inhalte bzw. Stoffe (efni) verarbeitet, was schon das Verb setja saman ‚zusammensetzen‘ demonstriert, wobei diese qualitativ und quantivativ verändert werden können, wie die Verben auka ‚vergrössern‘, fegra um ‚verschönern‘, bœta um ‚verbessern‘ zeigen. Die Stoffe stammen aus dem eigenen Gedächtnis (minni), aus Erzählungen (frásagnir) oder aus mündlichen und schriftlichen Quellen, bei denen die Autorität eine wichtige Rolle spielt (vgl. Glauser 2010: 313, 315, 322, 324). Viele Texte wie die Rittersagas sind übersetzt worden, wofür es eine Reihe von Verben des Übersetzens (snara, snúa, venda) gibt, und dazu auch häufig die Sprachen Französisch (franzeiska, valska), Englisch (enska), Latein (latína), Nordisch (norrœna), selten Griechisch (girzka) erwähnt werden (vgl. Glauser 2010: 320f.). In den Prologen wird auch der Zweck des Schreibens thematisiert. Ein wichtiger Zweck ist das Erinnern (minni), denn Stoffe werden aufgeschrieben, damit sie nicht vergessen werden. Daneben werden Texte auch zur Bildung und Unterhaltung geschrieben (vgl. Glauser 2010: 332). Glausers Aspekte erinnern in vielen Fällen an mögliche Attribute eines Schreibframes, jedoch wird nicht deutlich, ob sie jeweils alle zu Lexemen wie rita, skrifa, dikta, setja saman gehören. Sie müssen aber in einer semantischen Analyse unbedingt berücksichtigt werden.
Die bisherige nordistische Forschung war vor allem an zwei Themen interessiert, dem Schreiben von Runen und dem Schreiben der Autoren. Die Runologen haben mit einem grösseren Korpus gearbeitet, jedoch keine syntagmatischen Relationen einbezogen. Trotzdem haben sich zwei stereotype Konzepte herauskristallisiert, das Schreiben von Runen in Volkssprache auf harten Materialien und das Schreiben lateinischer Buchstaben auf Latein auf weichen Materialien, in denen Attribute wie SCHRIFTSYSTEM, SPRACHE, SCHREIBWERKZEUG, BESCHREIBSTOFFE und SCHRIFTTRÄGER im Vordergrund stehen. Beim Schreiben der Autoren hingegen wurden fast immer Einzelbelege herangezogen, bei denen nicht sicher ist, ob die postulierte Bedeutung konventionell ist. Syntagmatische Relationen spielen auch hier nur eine marginale Rolle. Mein erster Versuch an der Sturlunga saga (vgl. Müller 2018) ist nicht nur wegen der geringen Grösse des Korpus, sondern auch wegen der Wortfeldtheorie an seine Grenzen gestossen. Deshalb ist mit dem neuen theoretischen Ansatz der Framesemantik, dem Einbezug der syntagmatischen Relationen und einem grösseren Korpus eine präzisere Analyse der Konzepte dieser Lexeme zu erhoffen. Die Resultate der bisherigen Forschung sollen dabei berücksichtigt werden, wie im Folgenden dargelegt wird.
Die bisherige Forschung liefert zum einen ein umfangreiches Lexikon. Die oben erwähnten Verben des Schreibens – d.h. im Sinne von Schreiben und Verfassen – lassen sich in drei Gruppen Teilen: 1. in das Schreiben von Runen mit den Lexemen berja, fá, gera, hǫggva, marka, penta, rista, rísta, ríta und skrifa, 2. das Schreiben von lateinischen Buchstaben mit den Lexemen gera, rita, ríta, skrásetja und skrifa, sowie 3. das Verfassen von Texten mit den Lexemen dikta, gera, segja fyrir, semja, setja saman, smíða, yrkja. Setja saman hat möglicherweise eine verengte Bedeutung ‚kompilieren‘ und dikta ‚in lateinischer Sprache verfassen oder formulieren‘. Beim Schreiben von Runen und lateinischen Buchstaben gibt es einige Schnittmengen wie gera, ríta und skrifa, wobei gera auch in die dritte Gruppe gehören oder ein Hyperonym darstellen kann. Es liessen sich im hier untersuchten Korpus nicht alle dieser Lexeme bezeugen. Diverse runische Termini wie berja, fá, hǫggva, marka, penta, rista wie auch einzelne Termini für das Verfassen wie semja, smíða und yrkja fehlen.
Die zahlreichen in der bisherigen Forschung diskutierten Aspekte der Schriftlichkeit geben Anhaltspunkte für mögliche Attribute eines Frames. Am Schreiben sind diverse Personen beteiligt, wobei mehrere Aufgaben von einer Person ausgeführt werden können: SCHREIBER, KOMPILATOR, KOMMENTATOR, AUTOR und AUFTRAGGEBER. Zu diesen Menschen gehören die Körperteile HAND, AUGE, OHR, ZUNGE und Hirn, als Organ für das GEDÄCHTNIS. Zum Schreiben werden diverse materielle Objekte benötigt wie SCHREIBWERKZEUG, SCHREIBMATERIAL, SCHRIFTTRÄGER, mit denen der Schreiber das SKRIPT produziert. Beim Abschreiben, Kompilieren, Kommentieren, Verfassen und Übersetzen dürfen auch QUELLE, der darin überlieferte STOFF und der zu schreibende INHALT nicht vergessen werden. Zwischen QUELLE und TEXT bzw. SKRIPT steht das GEDÄCHTNIS, in dem Elemente der Vorlage, des Diktats, des Exzerpts, der mündlichen und schriftlichen Quellen abgespeichert werden. Der TEXT besteht aus einem INHALT, einer Form, der TEXTSORTE, und manifestiert sich visuell im SKRIPT, ist aber primär als immateriell einzuordnen, ebenso die SPRACHE und das SCHRIFTSYSTEM. Der AUFTRAGGEBER gibt nicht nur die Arbeit in Auftrag, sondern hat auch Einfluss auf die QUELLE und den INHALT.
Das nachfolgende Analysekapitel beginnt bei der Schrift, d.h. bei den Verben, welche gemäss den obigen Erkenntnissen für das Konzept SCHREIBEN stehen: rísta, rita, ríta, skrásetja und skrifa. Die Lexeme werden alphabetisch angeordnet, was auch die drei Verben dikta, segja fyrir und setja saman betrifft, welche zum Konzept VERFASSEN gehören. Das Verb gera umfasst wahrscheinlich beide Konzepte, weshalb dieses zuletzt analysiert wird.