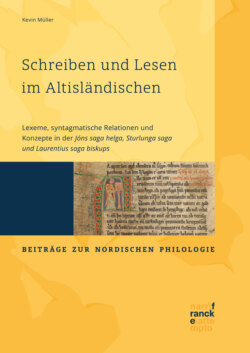Читать книгу Schreiben und Lesen im Altisländischen - Kevin Müller - Страница 26
3.3. Die Frames von rita/ríta der Jóns saga helga und Sturlunga saga im Vergleich
ОглавлениеDie Sturlunga saga weist im Gegensatz zu den beiden Frames der Jóns saga helga eine grössere Vielfalt an Attributen und Konstruktionen auf. Die Konstruktion rita/ríta e-t bildet sowohl syntaktisch als auch semantisch den Kern. Sie verbindet in der Sturlunga saga ebenfalls die Attribute SCHREIBER mit den Werten prestr ‚Priester‘ und prior ‚Prior‘ und SKRIPT mit den Werten saga ‚Saga, Geschichte‘, sǫgubók ‚Buch mit Sagas/Geschichten‘ und rolla ‚Schriftrolle‘. Das Attribut SCHREIBER ist in den meisten Belegen eine Leerstelle. Die Werte prestr und prior bezeichnen wie in der Jóns saga helga Ränge von Geistlichen. In Belegen aus dem ONP (rita) verhält es sich ähnlich. Das Agens ist häufig eine Leerstelle. Wenn nicht, handelt es sich meistens um Geistliche. Belege aus norwegischen Rechtstexten des 13. und 14. Jh. deuten – besonders in einem administrativen Bereich – auf einen Defaultwert klerkr ‚Geistlicher‘ oder notarius ‚Notar‘ hin (vgl. Halldórsson 1970: 288, Hødnebø 1960: 57). Ersterer kann sicher auch in einem administrativ weniger ausgebauten isländischen Kontext erwartet werden.
Das Thema ist hingegen meistens eine Füllung mit verschiedenen Werten, so dass bei einer Reihe von Belegen nicht sicher entschieden werden kann, ob es für die Attribute SKRIPT oder INHALT steht. Dies betrifft die Werte ártíð ‚Jahrzeit‘, ekki ‚nichts‘, fleira ‚mehr‘, orð ‚Wort‘ und saga. Sie können ebenso zum zweiten Frame mit der Konstruktion rita/ríta e-t + Ort/Ziel gehören, wobei die thematische Rolle Ort/Ziel leer bleibt. Bei dieser Konstruktion steht das Thema für den INHALT und der Ort bzw. das Ziel für den SCHRIFTTRÄGER oder das SKRIPT.
Eindeutige Werte für den INHALT sind draumr ‚Traum‘ und fyrirburðr ‚Vision‘. In den Kommentaren kommen zwei Attribute, STOFF (efni) im Präpositionalobjekt mit af und TEIL mit der Bezeichnung hlutr als Thema hinzu, mit denselben Werten wie beim Attribut INHALT. Rückblickend kann diese Aufteilung in TEIL, INHALT und STOFF auf die Jóns saga helga übertragen werden, wo ebenfalls das Lexem hlutr als Thema von rita in einem Kommentar belegt ist. Die Konstruktion rita e-t af e-u ist in der Sturlunga saga zwar nur in frühneuzeitlichen Abschriften erhalten, der Beleg rita sǫgu af vitran (vgl. Johnsen 1922: 80) ‚die Geschichte von der Vision schreiben‘ aus der Óláfs saga helga im ONP (rita) aus dem zweiten Viertel des 13. Jh. beweist aber, dass die Konstruktion durchaus in mittelalterlichen Texten vorkommt. Die Konstruktion steht im ONP (ríta) aber nicht nur für das Verarbeiten von Stoffen, sondern auch für das Abschreiben, wie ein Beleg aus einer undatierten Urkunde von ca. 1300 zeigt: „letom ver ríta af orð æftir orðe, ok her j. sætia a. þænna haatt“ (Hødnebø 1960: 126) ‚wir liessen es Wort für Wort abschreiben und hier auf diese Weise einsetzen‘ (Übers. KM). Es ist bei diesem Beleg allerdings nicht ganz sicher, ob af ein Adverb oder ein elliptisches Präpositionalobjekt af [bréfi] ‚vom Brief‘ ist. Wenn Ersteres zutrifft, handelt es sich um ein Partikelverb rita af e-t, das keine weiteren Belege hat und gesondert zu behandeln ist, bei Letzterem stünde das Präpositionalobjekt für ein Attribut VORLAGE oder QUELLE. Entscheidend wäre dann die Semantik des Werts.
Die thematischen Rollen Ort oder Ziel verweisen nicht wie in der Jóns saga helga nur auf das Attribut SCHRIFTTRÄGER – die Sturlunga saga hat hierzu nur den in neuzeitlichen Abschriften überlieferten Wert vaxspjald ‚Wachstafel‘ im Präpositionalobjekt á e-t/-u –, sondern auch auf das SKRIPT mit dem Wert saga ‚Saga‘ im Präpositionalobjekt í e-t/-u. Beim Adverb hér ‚hier‘ kann nicht sicher entschieden werden, ob es sich auf den SCHRIFTTRÄGER oder das SKRIPT bezieht. Die Belege sind zwar spärlich, es scheint aber, dass die Konstruktion rita/ríta e-t á e-t/e-u SCHREIBER, INHALT und SCHRIFTTRÄGER und rita/ríta e-t í e-t/e-u die Attribute SCHREIBER, INHALT und SKRIPT verbindet. Obwohl die Werte für ein Attribut INHALT sprechen, ist in diesem Kontext das Attribut TEIL treffender, weil in das Skript ein neuer Teil eingefügt wird. Belege aus dem ONP (rita) mit den gleichen Konstruktionen führen zum gleichen Resultat. Im Präpositionalobjekt á e-t/e-u gibt es typische Werte für das Attribut SCHRIFTTRÄGER wie blað ‚Blatt‘ oder legsteinn ‚Grabstein‘ (vgl. Jónsson 1925: 15f.), während in í e-t/e-u typische Werte für das Attribut SKRIPT oder Text wie guðspjall ‚Evangelium‘ (vgl. Indrebø: 1931: 49) oder lǫg ‚Gesetze‘ (vgl. Unger 1877: 304) vorkommen. Bók ‚Buch‘ kommt in beiden Konstruktionen vor, was darauf hindeutet, dass á bókum (vgl. Unger 1874: 791) auf ein Konzept SCHRIFTTRÄGER und í bókum (vgl. Rindal 1981: 147) auf ein Konzept SKRIPT oder TEXT hindeutet.
Die Konstruktion rita/ríta e-t í e-t/e-u gibt eine neue Perspektive auf TEIL und SKRIPT, welche so in der Jóns saga helga nicht vorkommt. Dies hängt mit der Rolle des Kompilators in der Sturlunga saga zusammen, welcher den Stoff auswählt und Inhalte weglassen kann. Eine weitere syntaktische Möglichkeit, SKRIPT und INHALT zu verbinden, repräsentiert in der Sturlunga saga die Konstruktion rita/ríta e-t um e-t. SKRIPT ist hier rolla und der INHALT skipti ‚Händel‘. Diese ist im ONP (rita, ríta) mehrfach belegt – alternativ mit der synonymen Präposition of (vgl. Benediktsson 1944: 10, Bjarnarson 1878: 33, 55) – und erfüllt die gleiche Funktion wie in der Sturlunga saga. Ein weiterer Beleg mit der Konstruktion rita hluti um líf e-s (vgl. Unger 1877: 588) ‚Teile über jds. Leben schreiben‘ aus der Marteins saga biskups verbindet die Attribute TEIL und INHALT. Dabei lässt sich INHALT nicht klar von STOFF abgrenzen, denn líf e-s ist Inhalt dieser Teile und zugleich der Stoff, dem diese Teile entnommen werden.
Der Stoff wiederum entstammt einer Quelle. Obwohl diese wie auch die Vorlagen bei einer Kompilation eine zentrale Rolle spielen, ist das Attribut QUELLE oder VORLAGE nur einmal als Ergänzung im Präpositionalobjekt eptir e-u belegt. Der Wert lautet bók ‚Buch‘. Anhand dieses einen Beleges kann nicht entschieden werden, welches Attribut besser zutrifft. Da rita in der Jóns saga helga in einer Paarformel mit setja saman ‚zusammensetzen, verfassen‘ vorkommt, trifft dort das Attribut QUELLE besser zu, weil der Text vermutlich zuerst kompiliert und dann aufgeschrieben wurde. Für das Attribut Quelle sprechen auch Belege im ONP (rita), wie etwa jener aus der Ólafs saga helga, welcher dem aus der Jóns saga helga gleicht: „En þo rita ec flest eptir þvi sem ec finn i kveþum scallda þeirra er varu með Olafi konungi“ (Johnsen/Helgason 1941: I, 5). ‚Doch schreibe ich das meiste gemäss dem, was ich in den Gedichten der Skalden finde, die bei König Óláfr waren‘ (Übers. KM). Der Relativsatz im Präpositionalobjekt eptir e-u enthält wie in der Jóns saga helga Werte für die Attribute TEXTSORTE (kvæði ‚Gedicht‘) und ZEUGE bzw. AUTOR (skáld ‚Skalde‘). Ob es sich um eine Quelle oder Vorlage handelt, ist schliesslich von der Situation abhängig, denn der Schreiber kann schriftliche Vorlagen abschreiben oder Informationen aus mündlichen Quellen aufschreiben. Die Vorlage ist nur eine besondere Form der Quelle. Es lässt sich auch nicht immer sicher entscheiden, ob die Quelle mündlicher oder schriftlicher Natur ist. Deshalb trifft die semantisch breitere Bezeichnung QUELLE besser auf dieses Attribut zu. Ein im ONP (rita) aus der Barlaams saga ok Josafats fügt dem Attribut Quelle noch einen weiteren Aspekt hinzu:
Her er nu komet til ennda oc lykta þessarar sagu. er ec ritaða eptir minni kunnastu. sua sem ec hevi sannazt nomet. af virðulegom monnum er sannlega. oc firir vttan fals. sagðu mer. með hinum sama hætte (Rindal 1981: 195).
Hier sind nun das Ende und der Schluss dieser Geschichte gekommen, die ich nach meiner Kenntnis schrieb, wie ich es wahrhaft von den ehrwürdigen Leuten vernommen habe, die es mir wahr und ohne Fehler auf die gleiche Weise erzählten (Übers. KM).
Das Präpositionalobjekt eptir minni kunnustu ‚nach meiner Kenntnis‘ verweist nicht auf eine mündliche oder schriftliche Quelle, sondern auf die Kenntnis des Schreibers. Er nennt zwar im nachfolgenden Komparativsatz seine Quellen, die Primärquelle ist aber sein eigenes Wissen. In der Ólafs saga helga kommt das ek ‚ich‘ des Schreibers zwar auch im Präpositionalobjekt eptir e-u vor, jedoch als Subjekt des Verbs finna ‚finden‘, d.h. der Schreiber findet die Informationen in den Quellen und übernimmt sie. Die Kenntnis des Schreibers steht nicht so sehr im Zentrum wie in der Barlaams saga ok Josafats, auch wenn es am Schluss des Satzes wieder mit með hinum sama hætti ‚auf die gleiche Weise‘ relativiert wird, indem der Schreiber seine Kenntnis doch den Quellen gleichsetzt. Die Kenntnis beruht auf dem Gedächtnis, so dass im Beleg aus der Barlaams saga ok Josafats das Attribut GEDÄCHTNIS indirekt als Ergänzung nachgewiesen werden kann. Das Gedächtnis des Schreibers steht immer zwischen Quelle und Skript, weil er sein Wissen wie auch den Text der Vorlage oder das Diktat darin über kürzere oder längere Zeit abspeichert.
Das Schreiben geschieht in vielen Fällen im Auftrag einer Person, die sich im Frame von rita/ríta als Attribut AUFTRAGGEBER bestätigen lässt. Der AUFTRAGGEBER, welcher in der Jóns saga helga als Dativobjekt ergänzt wird, kommt in der Sturlunga saga als Subjekt in Kausativkonstruktionen vor. Im Gegensatz zu den geistlichen Schreibern sind die Auftraggeber Mitglieder des Sturlungenclans, also höhergestellte Laien. Die Kausativkonstruktion wird im ONP (rita, ríta) nicht gesondert behandelt, es gibt aber durchaus Belege, wie beispielsweise aus den Landslǫg mit König Magnus (Magnús konungr) als Subjekt (vgl. Keyser/Munch 1848: 7f.).
Der soziale Rang ist auch für den ABSENDER im Korrespondenzframe entscheidend, welcher wie in der Jóns saga helga als Agens der Konstruktion rita e-t til e-s auf die Ausdrucksseite tritt. Die Werte für dieses Attribut sind ähnlich und die Konstruktion wird im ONP (rita, ríta) nicht gesondert behandelt, obwohl es sich um ein anderes Konzept handelt. Es gibt lediglich eine relativ kleine Belegreihe zur Kollokation rita bréf. Ein interessanter Wert in dieser Reihe ist noch dróttning ‚Königin‘ in einem Beleg aus der Alexanders saga (vgl. Jónsson 1925: 88), weil Frauen in den Schreib- und Lesekonzepten sonst kaum nachgewiesen werden können. Im ONP (rita) gibt es neben rita bréf noch das Partikelverb rita til e-m mit zwei frühneuzeitlichen Belegen, welches aus syntaktischen Gründen mit der Konstruktion rita e-t til e-s nicht gleichgesetzt werden kann. Der Korrespondenzframe ist in der Sturlunga saga mit den Attributen ABSENDER, SCHRIFTTRÄGER, BOTSCHAFT und EMPFÄNGER ähnlich zusammengesetzt. Boten und Siegel bilden hingegen Leerstellen und sind auch im Kontext nicht zu finden. Das Präpositionalobjekt með e-m für das Attribut BOTE ist im ONP (rita, ríta) mehrfach bezeugt, wird aber ebenfalls nicht gesondert behandelt. Darunter befindet sich mit sendiboði ‚Sendbote‘ (vgl. Unger 1869: 109, Baetke 2002: 526) eine mögliche Bezeichnung für das Attribut.
Wie der BOTE kommt im Schreibframe auch die QUALITÄT in der Sturlunga saga nicht als Ergänzung vor. Weil jedes Skript eine Qualität hat, muss diese Teil des Frames sein. Bei den Kommentaren und expliziten Textverknüpfungen ist die QUALITÄT wie SKRIPT und SCHRIFTTRÄGER Teil der Situation, so dass diese für den Leser ersichtlich ist. In der Erzählung scheint sie dagegen eine Nebenrolle zu spielen. Dies gilt auch bis auf den einen Beleg je Redaktion für die Jóns saga helga, wo der Schreiber nach dem Urteil Bischof Jóns fragt. Für die übrigen Skripte ist wiederum ein Defaultwert nötig, der wohl dem stereotypen Aussehen des jeweiligen Skripts entspricht. Auch der Bote ist in der Jóns saga helga nur je einmal eine Füllung, weil die Hauptperson Jón eben dieser Bote ist. Daraus lässt sich schliessen, dass diverse Unterschiede in den Kollokationen und Frames sich nicht nur durch das Alter, sondern auch durch den Inhalt des Textes erklären. Belege für dieses Attribut ausserhalb des hier untersuchten Korpus sind schwierig zu finden. Das ONP (ríta) nennt die Kollokation ríta á þessa lund ‚auf diese Weise schreiben‘ in einem Beleg aus dem norwegischen Homilienbuch (vgl. Indrebø 1931: 106), die mit rita með e-m hætti aus der Jóns saga helga synonym ist. Im Homilienbuch ist damit wahrscheinlich die Schreibweise des Namens Johannes gemeint. Ríta á þessa lund ist ebenfalls im Ersten grammatischen Traktat bezeugt, die sich da auf die Gestalt eines Graphems bezieht (vgl. Benediktsson 1972: 236). Darauf referiert auch die Ergänzung í ǫðru líkneski ‚in einer anderen Gestalt‘ (vgl. Benediktsson 1972: 218). Der Traktat hat ausserdem Belege mit Adverbien. Skynsamliga ‚verständig‘ steht im Zusammenhang der Verwendung des Graphems <y>, welches lateinische Schreiber in griechischen Wörtern verwenden, wenn sie ‚verständig‘ schreiben (vgl. Benediktsson 1972: 238). Die Adverbien illa ‚schlecht‘ und rangt ‚falsch‘ beziehen sich auf die Verwendung der Kapitälchen für Geminaten im Isländischen (vgl. Benediktsson 1972: 242). Somit beziehen sich die Adverbien auf die Orthographie. Der Frame des Attributs QUALITÄT hat also sicher zwei Attribute RICHTIGKEIT und GESTALT. Der Traktat behandelt in erster Linie die Verschriftung der Sprache, so dass die Gestalt der Grapheme und ihre korrekte Verwendung die Hauptrolle spielen. Die Qualität kann aber noch weitere Aspekte des Skripts beinhalten wie Schriftart, Stil oder Ästhetik, die wie Richtigkeit und Gestalt in das Konzept der Graphie gehören. Aus diesem Grund ist GRAPHIE die treffendere Bezeichnung dieses Attributs.
Der Fokus im Traktat auf die Verschriftung äussert sich auch im Thema, das diverse Werte für Grapheme enthält wie stafr ‚Buchstabe‘, hǫfuðstafr ‚Kapitälchen‘, raddarstafr ‚Vokal‘ oder samhljóðandi ‚Konsonant‘ (vgl. Benediktsson 1972: 208, 210, 230, 238, 242). Dazu kommen das Schriftsystem mit stafróf ‚Alphabet‘ (vgl. Benediktsson 1972: 208) und die Sprache mit ebreska ‚Hebräisch‘, enska ‚Englisch‘, girzka ‚Griechisch‘ und latína ‚Latein‘. Da zum Schreiben unweigerlich eine Sprache, ein Schriftsystem (stafróf) und Schriftzeichen (stafr) gehören, sind diese ebenfalls als Attribute zu betrachten. Auf das Attribut SPRACHE referiert im Traktat auch die Ergänzung at váru máli ‚in unserer Sprache‘ (vgl. Benediktsson 1972: 246), für die es im ONP (rita, ríta) gleiche und ähnliche Belege gibt: z.B. at norrœnu máli (vgl. Johnsen/Helgason 1941: I, 1) oder á þesskonar tungu ‚in einer solchen Sprache‘ (vgl. Jónsson 1925: 17). Die Substantive mál und tunga bezeichnen das Attribut, das Adjektiv ist der Wert. Im Traktat kann die Konstruktion rita/ríta e-t e-u die Attribute SPRACHE und SCHRIFTSYSTEM bzw. SCHRIFTZEICHEN verbinden, z.B. rita ensku latínu stǫfum (vgl. Benediktsson 1972: 206, 208) ‚Englisch mit lateinischen Buchstaben schreiben‘. Das Substantiv stafr deutet zwar auf das SCHRIFTZEICHEN hin, der Plural aber auf das SCHRIFTSYSTEM, das in diesem Kontext auch relevant ist. Das einzelne Schriftzeichen ist eher als Teil des Skripts zu betrachten. Vergleichbare Belege befinden sich auch im ONP (rita, ríta): rita/ríta gullstǫfum (Unger 1860: 287, Unger 1877: 278, Jiricek 1893: 25) ‚mit Goldbuchstaben schreiben‘, die auf ein weiteres Attribut im GRAPHIE-Frame verweisen: die FARBE. Der Defaultwert schwarz ist von zahlreichen mittelalterlichen Handschriften bekannt. Das Fehlen dieser Attribute im vorliegenden Korpus erklärt sich eben durch Defaultwerte und Constraints. Für das SCHRIFTSYSTEM ist latínu stafróf ‚lateinisches Alphabet‘ anzunehmen, die Werte für die SPRACHE können über Constraints mit dem TEXT inferiert werden. Liturgische Texte hätten entsprechen einen Wert latína ‚Latein‘, Briefe von und an Laien einen Wert norrœnn ‚nordisch‘.
Gleich verhält es sich mit den postulierten Attributen SCHREIBMATERIAL, SCHREIBWERKZEUG und KÖRPERTEIL (vgl. Kap. II.1.). Diese Aspekte thematisiert Glauser (2010: 326) anhand einer Schreiberklage aus der Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana, die in der Handschrift AM 589e 4to aus der Mitte oder zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts überliefert ist (vgl. Lagerholm 1927: XLIV):
ok lúkum vér hér sǫgu þeirra Egils ok Ásmundar, fyrir því at bókfellit minkar en blekit þykknar, augun þyngjaz, tungan trénar, hǫndin mœðiz, penninn sljófgaz ok bila ǫll ritfœrin. Hafi þeir þǫkk, er skrifat hafa, ok svá sá er las ok þeir er til hlýddu ok sá er þessa sǫgu hefir fyrst saman sett. AMEN. (Lagerholm 1927: 83)
Und hier beenden wir die Geschichte von Egill und Ásmundr, weil das Pergament ausgeht, die Tinte eindickt, die Augen zufallen, die Zunge austrocknet, die Hänge ermüden, die Feder stumpf wird und alle Schreibwerkzeuge versagen. Es haben jene Dank, die geschrieben haben, und dann jener, der las, und jene, die zuhörten, und jener, der die Geschichte zuerst verfasst hat. Amen (Übers. KM).
Die Schreibwerkzeuge, -materialien und Körperteile stehen zwar nicht in direkter syntaktischer Beziehung mit dem im letzten Satz belegten Verb skrifa, aber sehr wahrscheinlich in einer semantischen. Das ONP (rita, ríta) hat mehrere Belege mit dem Substantiv hǫnd ‚Hand‘ als instrumentalem Dativ sinni hendi ‚mit seiner Hand‘ (Unger 1862: 312), sínum hǫndum ‚mit seinen Händen‘ (Kålund 1908: 25) oder als Präpositionalobjekt með sínum hǫndum ‚mit seinen Händen‘ (vgl. Jónsson/Jónsson: 1892–96: 177).
Das SCHREIBMATERIAL bókfell ‚Pergament‘ und das Werkzeug penni ‚Feder‘ werden an einer Stelle in den Vitae Patrum ebenfalls mit dem Präpositionalobjekt með e-u ergänzt: „med einvala bokfellum ok hinum bezta penna ritinn“ (Unger 1877: 533). ‚mit erlesenem Pergament und der besten Feder geschrieben‘ (Übers. KM). Im oben erwähnten Zitat aus der Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana können die erwähnten Körperteile (auga, tunga, hǫnd), Schreibmaterialien (bókfell) und -werkzeuge (penni, ritfœri) aus dem Kontext inferiert werden und bilden beim Verb skrifa, einem Synonym zu rita/ríta, eine Leerstelle. Die körperlichen Aspekte sind reine Defaultwerte, von denen kaum abgewichen werden kann, denn man schreibt mit der Hand und sieht das Geschriebene mit den Augen. Die Zunge ist wohl eher auf den Leser oder den diktierenden Verfasser bezogen, es kann aber auch sein, dass der Schreiber beim Schreiben mitspricht. Bei den Materialien kommen hingegen auch andere Werte als Pergament in Frage. Diese resultieren aus Constraints mit dem SCHRIFTTRÄGER, denn die Blätter des Kodex bestehen aus Pergament, aber die Wachstafel ist mit Wachs beschichtet. Dies gilt auch für das SCHREIBWERKZEUG: Für das Pergament braucht es in der Regel eine Feder, für die Wachstafel einen Griffel. Diese eindeutigen Relationen erklären, dass diese Attribute meistens eine Leerstelle bleiben.
Zum Schluss bleiben noch die beiden Attribute ZEIT und ZWECK übrig, die nicht nur im vorliegenden Korpus selten vorkommen, sondern auch im ONP (rita, ríta) nur wenige Belege haben. In der Sturlunga saga lässt sich das Attribut ZEIT einmal nachweisen, für das es auch im ONP keine vergleichbaren Belege gibt. Die Nennung der Zeit grenzt das Schreiben lediglich von anderen Tätigkeiten eines Geistlichen ab, so dass das Attribut für den Frame wohl nur eine marginale Rolle spielt.
Für das Attribut ZWECK ist ein Beleg aus dem Prolog der Strengleikar in Glauser (2010: 332) von Interesse, weil dort gleich drei Werte genannt werden: „[…] þæim sogum er margfroðer menn gærðo […] ok a bokom leto rita. til ævenlægrar aminningar til skæmtanar. ok margfrœðes viðr komande þioða“ (Strengleikar: 4–7). ‚[…] den Geschichten, die vielwissende Leute machten […], und zum ewigen Andenken, zur Unterhaltung und Wissensvermehrung künftiger Völker auf Bücher schreiben liessen‘ (Übers. KM). Die Werte margfrœði ‚Vielwissen‘ und skemtan/-un ‚Unterhaltung‘ sind semantisch nahe an kenslu ‚Unterricht‘ in der Jóns saga helga und gaman ‚Vergnügen‘ in der Mágus saga jarls (vgl. Kap. II.3.1.2.). Hinzu kommt noch áminning ‚Erinnerung, Andenken‘. Welcher Wert für das Attribut ZWECK zutrifft, hängt stark vom jeweiligen Text ab, der geschrieben wird. So dienen Geschichten der Unterhaltung und Bildung, Psalterien der Andacht oder Urkunden der Beglaubigung. Auch hier können entsprechende Werte über Constraints inferiert werden und setzen die Kenntnis der Attribut- und Werteframes voraus.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Konzepte von rita/ríta in der Sturlunga saga sich von jenen in den beiden Redaktionen der Jóns saga helga kaum unterscheiden. Ein Abgleich mit Texten ausserhalb des vorliegenden Korpus bestätigt die Struktur des Frames und die Valenz weitgehend. Dennoch konnten einige Attribute im vorliegenden Korpus nicht nachgewiesen werden.
Die Analyse des Verbs rita/ríta hat gezeigt, dass es zwei Frames evozieren kann, die bisher nur ansatzweise unterschieden wurden. Zum Schreibframe gehören SCHREIBER (ritari) als Agens, SKRIPT als Thema oder Präpositionalobjekt í e-t/e-u, INHALT als Thema oder Präpositionalobjekt um e-t, TEIL (hlutr) als Thema, SCHRIFTTRÄGER als Präpositionalobjekt á e-t/e-u, QUELLE als Präpositionalobjekt eptir e-u, STOFF (efni) als Präpositionalobjekt af e-u, GRAPHIE als Adverb oder Konstruktionen wie með e-m hætti, ZEIT als Adverbiale und AUFTRAGGEBER als Causer oder Dativobjekt. In der Verwendung der Ergänzung gibt es innerhalb und ausserhalb des vorliegenden Korpus nur geringe Abweichungen. Die folgenden Attribute konnten im vorliegenden Korpus nicht als Ergänzung nachgewiesen werden: KÖRPERTEIL als Dativ- oder Präpositionalobjekt með e-u, SCHREIBMATERIAL und -WERKZEUG (ritfœri) als Präpositionalobjekt með e-u, SCHRIFTSYSTEM als Thema, Dativobjekt oder Präpositionalobjekt með e-u, SPRACHE (mál, tunga) als Thema oder Präpositionalobjekt á e-t/e-u oder at e-u und ZWECK als Präpositionalobjekt til e-s. Diese Attribute evoziert das Verb rita/ríta und man muss sie und ihre Werte kennen, um es zu verstehen.
Dieser umfangreiche Frame zeigt, dass rita/ríta weit mehr beinhaltet als nur Auf- oder Abschreiben. Im Zentrum steht der SCHREIBER, der ein SKRIPT herstellt. Die körperlichen, technischen, materiellen und linguistischen Aspekte sind weitgehend standardisiert, so dass sie in der Regel eine Leerstelle bilden und als Wissen vorausgesetzt werden können. Als Füllung erscheinen sie nur, wenn die Werte von diesem Default abweichen oder wenn bestimmte Aspekte hervorgehoben werden sollen, besonders in spezifischen Reflexionen wie in den grammatischen Traktaten. Das Schreiben umfasst aber noch weitere Attribute: Das SKRIPT besteht aus TEILEN und hat eine GRAPHIE, einen INHALT und SCHRIFTTRÄGER. Es entsteht für einen AUFTRAGGEBER und dient einem ZWECK. Zudem setzt es sich aus einem STOFF zusammen, der in QUELLEN überliefert ist. Die Werte dieser Attribute sind variabler und deshalb seltener Leerstellen. Zudem können diverse Werte aus dem Kontext oder über Constraints inferiert werden.
Der Korrespondenzframe ist hingegen enger. Er wird zwar ansatzweise bei Baetke (2002: 503) und Lönnroth (1964: 54) berücksichtigt, aber eine klare Grenze zum Schreibframe wird bei diesen Autoren nicht gezogen. Das Agens verweist im Korrespondenzframe auf den ABSENDER, das Thema auf die BOTSCHAFT oder den SCHRIFTTRÄGER, das Präpositionalobjekt með e-m auf den BOTEN, das Präpositionalobjekt með e-u auf das Siegel und das Präpositionalobjekt til e-s auf den EMPFÄNGER. In enger Beziehung mit dem EMPFÄNGER steht das ZIEL, das durch Richtungsadverbien ausgedrückt werden kann. Die Prozesse in der Korrespondenz sind ebenfalls weitgehend standardisiert, so dass diverse Attribute des Schreibframes hier eine Leerstelle bilden. Der Schreiber handelt im Auftrag des Absenders, das Schreiben richtet sich nach dem Briefformular etc. Das Schreiben bildet nur einen Teil dieses Frames, denn der Brief muss auch verfasst, diktiert, gesiegelt, überbracht und verlesen werden. Die beiden Frames können nur anhand bestimmter Ergänzungen oder Werte voneinander unterschieden werden.