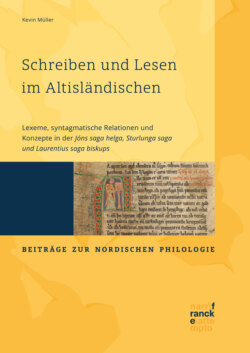Читать книгу Schreiben und Lesen im Altisländischen - Kevin Müller - Страница 27
4. skrásetja
ОглавлениеDas Verb skrásetja hat laut Baetke (2002: 563) die Bedeutung ‚niederschreiben, aufzeichnen‘, welche mit Fritzner (1886–96: III, 375) optegne ‚aufzeichnen‘, nedskrive ‚niederschreiben‘ übereinstimmt. Fritzner nennt unter dem Lemma zudem die Synonyme skrá, gera bzw. setja á skrá. In den etymologischen Wörterbüchern von de Vries (1962) und Blöndal (2008) fehlt ein Lemma skrásetja. Das Verb setzt sich aus dem Substantiv skrá ‚Pergament, Schriftstück, Aufzeichnung, Dokument, Buch‘ (vgl. Baetke 2002: 563, Fritzner 1886–96: III, 374) und dem Verb setja ‚setzen‘ (vgl. Baetke 2002: 527, Fritzner 1886–96: III, 213–219) zusammen. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Juxtaposition des in Fritzner (1886–96: III, 375) als Synonym erwähnten Syntagmas á skrá setja ‚aufs Pergament setzen‘. Laut ONP (skrásetja) ist dieses Verb seit dem zweiten Drittel des 13. Jahrhunderts bezeugt. Im vorliegenden Korpus lässt es sich einzig in der Sturlunga saga mit zwei Belegen nachweisen.
Der erste Beleg stammt aus der Þórðar saga kakala und ist in der Króksfjarðarbók erhalten. Als Þórðr kakali dem König eine Rolle mit den Händeln zwischen den Familien der Haukdœlir und Sturlungar vorlesen lassen hatte, fragte König Hákon Gizurr Þorvaldsson, was er darauf zu erwidern habe. Gizurr antwortet darauf in direkter Rede: a) „ecki hefir ek skra-sett sagnir minar“ (StS2 100) ‚Ich habe meine Aussagen nicht aufs Pergament gesetzt‘ (Übers. KM). Es fragt sich, ob Gizurr, auf den das Personalpronomen ek ‚ich‘ im Subjekt verweist, der SCHREIBER oder der AUFTRAGGEBER ist. Sein Kontrahent Þórðr kakali liess seine Aussagen aufschreiben (lét rita/ríta, vgl. Kap. II.2.2.6.b.), so dass die Rollenverteilung bei ihm klar ist. Diese Verteilung liesse sich auf Gizurr übertragen. Die Konstruktion hafa + Part. Prät. kann nicht nur als Perfekt, sondern auch als Resultativ gedeutet werden, so dass bei einer resultativen Funktion Gizurr seine Aussagen lediglich in geschriebener Form bei sich und nicht selbst niedergeschrieben hätte. Es ist aber auch denkbar, dass sich Gizurr mit einer gewissen Ironie als Schreiber darstellt, um seine Geringschätzung dem neuen Medium Schrift gegenüber auszudrücken, dessen sich Þórðr bedient. Das Attribut, auf welches das Subjekt referiert, lässt sich an dieser Stelle nicht eindeutig klären. Das Akkusativobjekt enthält das Lexem sǫgn ‚Aussage‘, welches als Wert für das Attribut INHALT steht. Das Verb impliziert mit dem Modifikator skrá den Beschreibstoff Pergament, so dass als SCHRIFTTRÄGER ebenfalls ein Pergamentblatt oder eine Rolle wie bei Þórðr als SCHRIFTTRÄGER zu erwarten wäre. Das Attribut SCHRIFTTRÄGER kommt in anderen Texten dennoch als Füllung vor wie beispielsweise á bók, í altíðabók, í kvaterni (vgl. Fritzner 1886–96: III, 375, ONP skrásetja). In der Struktur des Frames wie auch in der Valenz unterscheidet sich skrásetja also nicht von rita oder skrifa.
Der zweite Beleg aus dem Sturlu þáttr, welcher nur in frühneuzeitlichen Papierabschriften erhalten ist, ist nicht weniger leicht zu interpretieren: b) „Réz hann þá til ferðar með konungi ok var skrásettr í skip. Gekk hann þá til skips, ok var fátt manna komit“ (StS2 325). ‚Er [= Sturla] ging mit dem König auf eine Reise und wurde in die Schiffsliste eingetragen. Er ging dann zum Schiff und es waren noch wenige Leute darauf‘ (Übers. KM). Wegen des Passivs ist das Agens eine Leerstelle. Im Subjekt ist das Personalpronomen hann enthalten, welches sich auf Sturla Þórðarson bezieht, wodurch er ein Wert für das Attribut INHALT wäre. Die Person Sturlas wird bei diesem Beleg wohl metonymisch für seinen Namen verwendet. Dafür sprechen Belege aus dem ONP (skrásetja) und Fritzner 1886–96: III, 375) mit dem Thema nafn ‚Name‘ (s.a. Dipl. Norv. I, 187, Hødnebø 1960: 35, Unger 1871: 704). Im Sturlu þáttr gibt es zusätzlich ein Präpositionalobjekt í skip ‚ins Schiff‘, wo in den obigen Beispielen Werte für den SCHRIFTTRÄGER oder das SKRIPT stehen. Bei einem hölzernen Beschreibstoff wäre jedoch eher ein Verb rísta ‚ritzen‘ zu erwarten, zumal skrásetja schon den Schriftträger Pergament impliziert. Deshalb ist skip nicht als SCHRIFTTRÄGER zu verstehen, sondern als ZIEL, nämlich dass der Eintrag des Passagiernamens auf einem pergamentenen Schriftträger den Zugang zum Schiff ermöglicht. Baetke (2002: 563) deutet die Kollokation skrásetja menn á skipinu, á skipit als ‚die Leute in die Schiffsliste eintragen, die die Besatzung bilden sollen‘, so dass skip metonymisch für eine Passagierliste steht. Das Ziel skip kommt auch beim synonymen Verb skrá vor (vgl. Fritzner 1886–96: III, 375).
Die geringe Belegzahl von skrásetja im vorliegenden Korpus verlangt einen Blick in weitere Quellen, wie es bereits beim Beleg a) erfolgt ist. Das ONP (skrásetja) nennt aber nur wenige Belege, was darauf hindeutet, dass skrásetja generell ein selten verwendetes Lexem war. Neben der Sturlunga saga werden noch einzelne norwegische Urkunden, die Landslǫg, Fagrskinna, Abrósíuss saga byskups, Barlaams saga ok Jósafats, Maríu saga und die Vitæ Patrum zitiert. Letztere erlauben einen Vergleich mit dem Lateinischen, skrásetja ist in diesen Fällen eine Übersetzung von lat. scribere (Unger 1877: 484).
Das Agens lässt sich bei diesen Belegen wegen der vielen Leerstellen nur schwer fassen. Die Handlungen finden teilweise ausserhalb der Realität statt, so dass neben skelmir ‚Schurke‘ (vgl. Unger 1871: 176) auch engill ‚Engel‘ (vgl. Unger 1877: 484) und himneskir heimamenn ‚himmlische Hausleute‘ (vgl. Rindal 1981: 88) Subjekt sind. In die Realität gehören noch jene (þeir) der Christkirche in Bergen, wohl die Geistlichen dieses Gotteshauses. Das Thema ist, wie schon erwähnt, mehrfach das Substantiv nafn ‚Name‘, daneben gibt es noch einzelne Belege mit ártíð ‚Jahrzeit‘ (vgl. Hødnebø 1960: 53), bók ‚Buch‘ (vgl. Keyser/Munch 1848: 178), heit ‚Versprechen‘ (vgl. Rindal 1981: 88), hlutr ‚Teil‘ (vgl. Jónsson 1902–03: 262) und rœða ‚Rede‘ (vgl. Unger 1871: 176). Letztere entspräche semantisch dem Substantiv sǫgn aus der Sturlunga saga. Ártíð, bók und hlutr sind schon als Thema von rita vorgekommen. Bók verhält sich bei skrásetja ebenfalls ähnlich und kann zwischen Skript und Schriftträger wechseln. Dies demonstriert ein Beleg im ONP (skrásetja) mit der thematischen Rolle Ort (á bók, vgl. Hødnebø 1960: 92). Die Ähnlichkeit zu rita zeigt sich auch durch das Vorkommen eines AUFTRAGGEBERS in den Landslǫg mit dem Wert konungr in der Kausativkonstruktion láta skrásetja (vgl. Keyser/Munch 1848: 178). Das Verb skrásetja verbindet also im Aktivum wie rita e-t á/í e-t/-u die Attribute SCHREIBER, INHALT und SCHRIFTTRÄGER oder SKRIPT. Die Bedeutung ist allerdings enger, denn die Werte nafn und sǫgn wie auch ártíð, heit und rœða für den INHALT stehen für kürzere Informationen. Deshalb ist es in diesem Zusammenhang besser von TEIL zu sprechen, weil Teile einem Gesamtskript hinzugefügt werden. Dafür spricht auch das Lexem hlutr, auch wenn es nur in einer frühneuzeitlichen Abschrift erhalten ist. Die grösseren Schriftträger bók und rolla deuten darauf hin, dass diese Teile kontinuierlich, wahrscheinlich in der Form einer Liste schriftlich festgehalten werden.