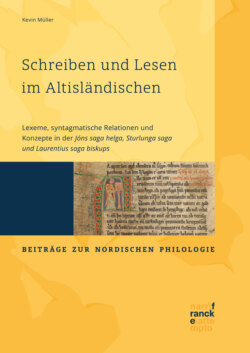Читать книгу Schreiben und Lesen im Altisländischen - Kevin Müller - Страница 25
3.2.6. láta rita/ríta e-t ‚etw. schreiben lassen‘
ОглавлениеDas Verb rita/ríta kommt in der Sturlunga saga dreimal in der Kausativkonstruktion láta ‚lassen‘ + Inf. vor. Bei diesen drei Belegen kommen wegen des Infinitivs immer rita und ríta in Frage. In der Diathese Kausativ werden die thematischen Rollen verschoben: Das Agens kommt in ein zweites Akkusativobjekt, während das Subjekt eine weitere Rolle, den Causer, ausdrückt. Dieser Causer steht im Schreibframe für das Attribut AUFTRAGGEBER. Auf diesen wurde in der Jóns saga helga mit dem Dativobjekt verwiesen.
Der erste Beleg aus der Íslendinga saga erwähnt als einziger Snorri Sturlusons Tätigkeit als Autor oder Kompilator in der Sturlunga saga:
a) Nv tok at batna með þeim Snorra ok Sturlu, ok var Sturla lǫngvm þa i Reykia-hǫllti ok lagði mikinn hvg aa at lata rita sogv-bækr eptir bokvm þeim, er Snorri setti saman (StS1 421).
Nun begann es zwischen Snorri [Sturluson] und Sturla [Sighvatsson] besser zu werden und Sturla war dann lange in Reykjaholt und war sehr daran interessiert Geschichtenbücher von den Büchern, die Snorri verfasste, (ab)-schreiben zu lassen (Übers. KM).
Causer und Subjekt von láta rita/ríta ist Snorri Sturlusons Neffe Sturla Sighvatsson. Das Agens, also der SCHREIBER, bleibt eine Leerstelle. Ein möglicher Wert wäre ein Geistlicher, der sich in Reykholt aufhielt. Das eigentliche Akkusativobjekt bzw. das Thema ist sǫgubók ‚Buch mit Sagas, Sagabuch‘ (vgl. Baetke 2002: 513), ein Determinativkompositum bestehend aus dem Modifikator saga und dem Kopf bók. Der Kopf steht für den SCHRIFTTRÄGER. Beim Wert saga kommen mehrere Attribute in Frage. Im rita-Frame trifft sicher das Attribut SKRIPT zu, beim Kompositum sǫgubók handelt es sich allerdings um einen Kodex, der Texte einer bestimmten Sorte enthält. Folglich gehört saga zum Attribut TEXTSORTE. Weil sich die Textsorte u.U. im Skript äussert, hängen diese beiden Attribute eng zusammen. Der INHALT des Skripts bzw. der Textsorte bleibt dagegen offen (vgl. Kap. II.8.2.b.). Wie in der Jóns saga helga kommt auch hier ein Präpositionalobjekt mit eptir für die QUELLE mit dem Wert bók vor, welches vermutlich eine Ellipse von sǫgubók ist, zumal im Falle einer Abschrift die Textsorten mit der Vorlage übereinstimmen. Mit dem Schriftträger bók wird auf ein neues Attribut des QUELLE-Frames verwiesen, welcher die Kriterien einer VORLAGE erfüllt. Das Präpositionalobjekt verweist entweder auf ein Attribut QUELLE oder spezifischer auf ein Attribut VORLAGE.
Der zweite Beleg stammt aus der Þórðar saga kakala und ist in der Króksfjarðarbók überliefert:
b) Ok aa stefnunni lét Þorðr lesa upp rollu langa, er hann hafði laatið rita vm skipti þeira Hauk-dæla ok Sturlunga. Birtiz þar aa margr skaði, er Þorðr hafði fengit i manna-láatum (StS2 100).
Und auf der Versammlung liess Þórðr eine lange Rolle verlesen, die er über die Händel der Haukadaler und Sturlungen schreiben lassen hatte. Darauf wurde ein grosser Schaden kundgetan, den Þórðr an gefallenen Männern erlitten hatte (Übers. KM).
Der Causer ist hier Þórðr kakali (hann), das Agens wie vorher eine Leerstelle, Thema ist rolla ‚(Schrift-)rolle, Pergamentrolle‘ (Baetke 2002: 505), auf welches die Relativpartikel er referiert. Rolla wäre eigentlich ein SCHRIFTTRÄGER, steht aber metonymisch für das SKRIPT. Das Adjektiv langr ‚lang‘ kann sich sowohl auf die Länge des SKRIPTS als auch des SCHRIFTTRÄGERS beziehen. Zusätzlich gibt es ein Präpositionalobjekt um skipti, welches sich auf den INHALT des Skripts bezieht und den Wert skipti ‚Händel‘ enthält. Im Gegensatz zur Konstruktion rita e-t á e-u, welche die Perspektive auf die Attribute INHALT und SCHRIFTTRÄGER lenkt, verbindet rita/ríta e-t um e-t SKRIPT und INHALT.
Der dritte Beleg aus der Þorgils saga skarða ist nur in den Papierabschriften erhalten:
c) Þá er skip tóku at búaz um várit, lét Þorgils rita á vaxspjǫld ok sendi konungi; var þat þar á, at hann beiddi, at konungr leyfði honum at fara til Íslands eða ella til annarra landa, kvaz eigi lengr vera vilja í ófrelsi (StS2 143).
Als die Schiffe sich im Frühling bereitgemacht wurden, liess Þorgils etwas auf Wachstafeln schreiben und sandte sie dem König. Darauf stand, dass er darum bat, dass der König ihm erlaubte, nach Island oder in andere Länder zu fahren. Er sagte, dass er nicht länger in Unfreiheit sein wolle (Übers. KM).
Der Causer ist Þorgils skarði, Agens und Thema sind Leerstellen. Nur das Präpositionalobjekt á vaxspjǫld ‚auf Wachstafeln‘ kommt noch hinzu. Gerade bei diesem Objekt weichen die Papierabschriften von einander ab, in Stockh. pap. 8, 4to steht vaxspjǫld (Akk. Pl.), aber in Brit. mus. Addit. 11,127, fol., in Advoc. library 21–3–17 aber vaxspjaldi (Dat. Sg.). Letztere entsprechen der Konstruktion rita e-t á e-u aus der Jóns saga helga mit dem Schriftträger als Ort, erstere einer Konstruktion rita e-t á e-t mit dem Schriftträger als Ziel. Dieser Unterschied ist oben in den Kommentaren mit dem Präpositionalobjekt í sǫgu (Akk./Dat.) schon vorgekommen. Der SCHREIBER kann nicht aus dem Kontext erschlossen werden. Auch hier muss man wieder mit einem Defaultwert Geistlicher rechnen. Der INHALT wird im nachfolgenden Satz var þat þar á, at […] ‚darauf stand, dass […]‘ beschrieben. Aus dem Kontext ergibt sich auch der EMPFÄNGER des Schreibens, König Hákon Hákonarson, aus dem Satz ok sendi konungi ‚und sandte [sie] dem König‘. Der BOTE der Nachricht bleibt unbekannt. Obwohl hier Attribute des Korrespondenzframes vorhanden sind, darf rita hier nicht metonymisch verschoben betrachtet werden, denn bei rita til e-s ist das Agens der ABSENDER, bei láta rita ist aber der Causer der AUFTRAGGEBER und somit in diesem Beleg mit dem ABSENDER identisch, das Agens bleibt aber der SCHREIBER.
Die drei Belege im Kausativ sind sehr unterschiedlich zusammengesetzt. Im Subjekt ist immer der Causer, welcher für das Attribut AUFTRAGGEBER steht. Da die Auftraggeber in allen drei Fällen Sturlungen sind, ist der Wert sturlungr anzusetzen. Das Agens ist in allen drei Belegen eine Leerstelle, so dass keine Werte für den SCHREIBER bekannt sind. Es bleibt bei allen drei Belegen offen, wie stark Auftraggeber und Schreiber in die Textproduktion involviert waren, am wenigsten wohl Sturla Sighvatsson, der Snorris Werke abschreiben liess. Er war höchstens bei der inventio beteiligt, indem er die Texte oder Stoffe auswählte. Þórðr kakali und Þorgils skarði hatten sicher Einfluss auf die inventio, und möglicherweise auch auf die dispositio. So fragt sich zudem, welchen Anteil der unbekannte Schreiber an der dispositio und elocutio hatte und ob noch weitere Personen am Text mitarbeiteten. Dies entscheidet mit, ob man beim Thema von SKRIPT oder gar TEXT sprechen kann, das in zwei Fällen die Werte rolla und sǫgubók hat, die eigentlich Schriftträger sind, aber metonymisch zum SKRIPT oder gar TEXT verschoben werden. Ein dritter SCHRIFTTRÄGER vaxspjald ist als Ort (á e-u) oder Ziel (á e-t) belegt. Der INHALT kommt nur einmal als Füllung mit dem Präpositionalobjekt um skipti vor. Die Konstruktion rita e-t um e-t ist neu und verbindet die Attribute SCHREIBER, SKRIPT bzw. TEXT und INHALT. Das Präpositionalobjekt eptir e-u verweist im Gegensatz zur Jóns saga helga präziser auf die VORLAGE und hat den Wert sǫgubók, d.h. ein Wert eines Attributs SKRIPT, SCHRIFTTRÄGER aus dem Attributframe.
Es lässt sich abschliessend für die drei Belege festhalten, dass die Diathese Kausativ für sich betrachtet lediglich die Valenz um eine neue thematische Rolle erweitert, welche auf das Attribut AUFTRAGGEBER referiert. Die Konstellationen des Aktivums bleiben bis auf die Kasus unverändert. Sie umfassen folgende Konstruktionen und Konzepte: rita e-t (um e-t / eptir e-u) für das Herstellen des Skripts (mit einem Inhalt und einer Vorlage) und rita e-t á e-t/e-u für das Festhalten eines Inhaltes auf einem Schriftträger.