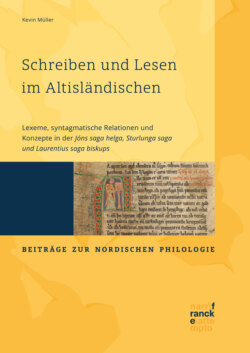Читать книгу Schreiben und Lesen im Altisländischen - Kevin Müller - Страница 17
3.1.1. S-Redaktion
ОглавлениеIn der S-Redaktion ist rita siebenmal belegt, wobei in zwei Belegen auch ríta in Frage kommt. Es gibt jedoch keinen eindeutigen Beleg von ríta, so dass es sich auch bei diesen ambigen Fällen um rita handeln dürfte. Im Folgenden wird in der Analyse eindeutiger Fälle rita bzw. ríta und bei den ambigen rita/ríta geschrieben.
Als erstes soll hier eine ausführlichere Szene betrachtet werden, in der rita zweimal belegt ist: Ein ehemaliger Schüler Bischof Jóns kommt als Priester („prestr“) und guter Schreiber („ritari góðr“) ohne Namen zu ihm: a) „hann hafði með ser bok er hann hafði ritað. ok giorfva presti einvm þeim er þaðan var langtt ibrvt“ (JSH 27). ‚Er hatte ein Buch bei sich, das er geschrieben und für einen Priester gemacht hatte, der weit weg war‘ (Übers. KM). Das aktive Verb rita hat ebendiesen Priester und Schreiber als Subjekt und als Akkusativobjekt bók ‚Buch‘, vertreten durch die Relativpartikel er. Es ist nicht sicher zu entscheiden, ob das Dativobjekt presti einum allein zum Verb gera ‚machen‘ gehört oder auch zu rita. Aus der Erzählung ergibt sich, dass das Buch auf jeden Fall einen Käufer hat, in dessen Auftrag der Schreiber es geschrieben hat. Für den Preis braucht der Schreiber, wie er es mit dem Käufer vereinbart hat, eine Bewertung Bischof Jóns. Das Verb rita rekurriert im folgenden Satz im Passiv: b) „Enn byskvp hyggR at bokinni ok lofvaði miok ok mællti siðan. Goð er þessi bok ok vel ritvð“ (JSH 27f.). ‚Aber der Bischof betrachtete das Buch und lobte es sehr und sprach: „Gut ist dieses Buch und gut geschrieben“‘ (Übers. KM). Das Lexem bók ist nun Subjekt, aber das Verb hat hier noch eine weitere Ergänzung, das Adverb vel ‚gut‘, welches den Modus des Schreibens beschreibt.
Das Verb rita hat in diesen beiden Belegen zusammen vier Ergänzungen, im ersten sind es drei: Subjekt, Akkusativ- und Dativobjekt, welche für die thematischen Rollen Agens, Thema und Dativ stehen, und im zweiten sind es zwei: Subjekt und Adverb, welche für die thematischen Rollen Thema und Modus stehen. Das Thema ist in beiden Belegen identisch. Zu den thematischen Rollen passen vier Attribute im Frame: Der im Kontext als ritari bezeichnete SCHREIBER zum Agens mit einem Wert prestr, der SCHRIFTTRÄGER zum Thema mit dem Wert bók, der AUFTRAGGEBER zum Dativ mit dem Wert prestr und die QUALITÄT zum Modus mit dem Wert vel. Hier lässt sich auch ein erster Constraint feststellen, denn sowohl der SCHREIBER (ritari) als auch der SCHRIFTTRÄGER (bók) haben im Kontext das Adjektiv góðr ‚gut‘ als Attribut, welches als Wert für ein Attribut FÄHIGKEIT im Attributframe des SCHREIBERS und für die QUALITÄT im Attributframe des SCHRIFTTRÄGERS betrachtet werden kann und den gleichen Wert hat wie die QUALITÄT im Frame von rita, denn vel ist das Adverb zum Adjektiv góðr.
Im nächsten Beleg hat rita andere Ergänzungen und die thematischen Rollen sind teilweise verschoben:
c) En hinn næsta dag eptir þaa komv afvnd. heilags J(ons) byskvps þeir menn er þaa vorv nykomnir af hafi ok færðv honvm bok eina. aa þeiri bok var sa atbvrðr ritaðr er aa þessv landi var þaa miok okvnnR (JSH 26).
Aber am nächsten Tag danach kamen jene Leute zu Bischof Jón, die eben gelandet waren, und brachten ihm ein Buch. Auf diesem Buch war jenes Ereignis aufgeschrieben, welches in diesem Land sehr unbekannt war (Übers. KM).
Das Verb ist hier passiv und hat atburðr ‚Vorfall, Ereignis, Vorgang‘ (vgl. Baetke 2002: 30) als Subjekt. Das Präpositionalobjekt mit á þeiri bók ‚auf diesem Buch‘ enthält das Substantiv bók, das oben schon als Thema und Wert für den SCHRIFTTRÄGER vorgekommen ist. Das Thema nimmt bei diesem Beleg hingegen wegen des Passivs die Position des Subjekts. Zum Attribut SCHRIFTTRÄGER mit dem Wert bók kommt nun ein neues hinzu, nämlich der INHALT mit dem Wert atburðr. Der Schriftträger als Ort ergibt bei rita mehr Sinn, weil man ja nicht den Schriftträger schreibt, sondern das Skript. In den vorherigen beiden Belegen verhält es sich eher so, dass bók sich metonymisch vom Schriftträger zum Skript verschoben hat. Der Text wiederum hat einen Inhalt, der beim vorherigen Beleg nicht bekannt ist, aber hier ein Ereignis umfasst, so dass es sich wiederum um eine Metonymie handelt. Der Schreiber des Buches ist dagegen unbekannt, denn er bildet wegen des Passivs im Satz eine Leerstelle und ist auch nicht aus dem Kontext erschliessbar. Das gleiche gilt für die Qualität des Buches. Weil das Buch Jón übergeben worden ist, hat es folglich einen Empfänger bzw. Besitzer, der aber nicht Auftraggeber ist.
Im nächsten Beleg ist das Lexem atburðr wiederum eine Ergänzung von rita/ríta, wobei es sich nicht um dasselbe Ereignis handelt. Wegen des Infinitivs käme hier auch ríta in Frage:
d) þaa heitR diakniN avðrv sinni aa hinn h(eilaga) J(on) byskvp. at syngia hatiðar d(ag) hans allan psalltara ok rita nv atbvrðinn ef heit hans væri heyrtt (JSH 44).
Dann ruft der Diakon ein andermal den heiligen Bischof Jón an, dass er an seinem Festtag den ganzen Psalter singe und das Ereignis aufschreibe, wenn sein Versprechen erhört werde (Übers. KM).
Hier ist rita/ríta Teil eines Infinitivsatzes, dessen Agens identisch mit dem Hauptsatz ist, d.h. der Diakon (djákninn). Das Ereignis (atburðinn) ist Akkusativobjekt und hier wie oben Thema. Das Attribut SCHREIBER bekommt bei diesem Beleg einen neuen Wert djákni, ebenfalls ein Rang eines Geistlichen, während das Attribut INHALT den gleichen Wert atburðr hat. Die Attribute SCHRIFTTRÄGER, AUFTRAGGEBER und QUALITÄT bilden hier Leerstellen, die sich auch nicht mithilfe des Kontextes füllen lassen.
Die beiden nächsten Belege haben die Ergänzung með innsigli ‚mit einem Siegel‘ gemeinsam und stammen aus demselben Kapitel VII, das von Jóns Weihe zum Bischof handelt. Weil sich herausstellt, dass Jón schon einmal verheiratet war, braucht er einen Dispens des Papstes, um zum Bischof geweiht werden zu können. Der Erzbischof von Lund sagt zu Jón: e) „ok ver mvnvm rita með þer með vorv innsigli oc tia pafvanvm þitt mal“ (JSH 14f.). ‚Und wir werden dir ein Schreiben mit unserem Siegel mitgeben und dem Papst deine Angelegenheit darlegen‘ (Übers. KM). Subjekt und Agens ist der Erzbischof von Lund. Dieser wäre folglich der SCHREIBER, allerdings hatten Erzbischöfe Sekretäre, welche die Aufgabe des Schreibens übernahmen (vgl. Ludwig 2005: 150–52), so dass das Agens eher für ein Attribut AUFTRAGGEBER oder ABSENDER steht. Ein Akkusativobjekt fehlt. Im selben Satz ist das Verb tjá ‚darlegen‘ enthalten mit dem Substantiv mál ‚Angelegenheit‘ im Akkusativobjekt, das als Wert für den INHALT stehen könnte, und dem Lexem páfi ‚Papst‘ im Dativobjekt für den EMPFÄNGER. Rita/ríta hat bei diesem Beleg noch zwei weitere Ergänzungen, die Präpositionalobjekte með váru innsigli ‚mit unserem Siegel‘ und með þér ‚mit dir‘. Das Personalpronomen in letzterem verweist auf Jón, welcher den Brief dem Papst überbringt und damit Bote ist. Daraus erfolgt ein neues Attribut BOTE mit dem Wert Jón. Das Siegel ist ein Meronym des SCHRIFTTRÄGERS, der aber eine Leerstelle bildet. Bei innsigli handelt es sich nicht um einen Wert, sondern bezeichnet ein weiteres Attribut SIEGEL. Das Possessivpronomen várr ‚unser‘ determiniert dieses und verweist auf den ABSENDER zurück. Der Wert von SIEGEL ist demzufolge Siegel des Erzbischofs. Der SCHRIFTTRÄGER oder das SKRIPT rit ‚Schreiben, Schriftstück, Brief‘ (Baetke 2002: 503) wird erst bekannt gegeben, als Jón vor dem Papst steht, wo rita bereits ein weiteres Mal eindeutig belegt ist:
f) Ok er *pafvi hafði seeð ritið. þaa veitir hann þat þeckiliga er hann var litillatliga beðin […] ok ritar til hans með sinv innsigli ok gefR honvm leyfvi aa at vigia hinn helga Ion til byskvps (JSH 15).
Und als der Papst das Schreiben gesehen hatte, gewährt er es nachsichtig, worum er demütig gebeten wurde […] und schreibt an ihn [= Erzbischof] mit seinem Siegel und gibt ihm die Erlaubnis, den heiligen Jón zum Bischof zu weihen (Übers. KM).
Subjekt ist der Papst (páfi) und aus den gleichen Gründen wie oben eher ABSENDER als SCHREIBER. Das Akkusativobjekt bleibt wiederum leer, hinzukommt aber das Präpositionalobjekt til hans ‚zu ihm‘, welches wieder auf den EMPFÄNGER des Schreibens, den Erzbischof von Lund referiert. Der INHALT des Schreibens wird wiederum im nachfolgenden Satz paraphrasiert. Das SIEGEL ist ebenfalls in einem Präpositionalobjekt mit með enthalten, determiniert durch das reflexive Possessivpronomen sinn, welches auch bei diesem Beleg auf den ABSENDER páfi zurückverweist, so dass der Wert Siegel des Papstes lautet. Der SCHRIFTTRÄGER bzw. das SKRIPT bréf wird wiederum erst erwähnt, als der BOTE Jón in Lund ankommt (vgl. JSH 15). Die Rollenverteilung unterscheidet sich in diesem Kapitel deutlich von den ersten drei Belegen: Das Agens steht für den ABSENDER. Der geistliche Rang der Person stellt einen Constraint dar, weil ranghohe Geistliche zwar schreiben können, aber über Sekretäre verfügen, welche diese Aufgabe übernehmen. Das leere Thema ist hier möglicherweise das Attribut BOTSCHAFT mit dem Wert mál. Es ist in der Korrespondenz besser von Botschaft zu sprechen als von Inhalt. Im Brieftext ist tatsächlich ein Inhalt festgehalten, jedoch geht es in der Korrespondenz primär um das Mitteilen einer Botschaft in schriftlicher Form. Der SCHRIFTTRÄGER bildet eine Leerstelle, ist aber aus dem Kontext bekannt, mit den Werten rit und bréf. Der EMPFÄNGER ist in der Ergänzung til e-s oder im Dativobjekt enthalten mit den Werten páfi und erkibiskup. Die Ergänzung til e-s erwähnt auch Baetke (2002: 503) für die Korrespondenz. Ausserdem gibt es die Attribute BOTE und SIEGEL im Objekt með e-m bzw. e-u. Die unterschiedliche Konstellation von Attributen hängt mit der Korrespondenz zusammen, worauf insbesondere die Attribute BOTE, EMPFÄNGER und SIEGEL hinweisen. Bei der Korrespondenz ist Schreiben nur eine von mehreren Handlungen. Darauf weisen auch Fillmore/Atkins (1992: 100f.) bei nengl. write to someone hin. Es handelt sich demzufolge um eine Synekdoche.
Der letzte Beleg von rita ist etwas schwieriger zu analysieren, weil es nur eine Ergänzung hat: g) „þat var hinna ellri manna hattR at kenna hinvm yngrvm. En hinir yngri ritvðv þaa er nams varð imilli“ (JSH 21). ‚Es war die Art der Älteren, die Jüngeren zu unterrichten. Die Jüngeren schrieben neben dem Unterricht‘ (Übers. KM). Diese Ergänzung ist das Subjekt hinir yngri ‚die Jüngeren‘, hier wahrscheinlich wieder Wert des Attributs SCHREIBER. Das Adjektiv yngri bezieht sich auf das vorher genannte „menn til læringar“ (JSH 21) ‚Leute zum Unterrichten‘, wodurch ein neues Attribut, der ZWECK ins Spiel kommt, das aber keine Ergänzung von rita ist. Das Schreiben ist bei diesem Beleg Teil der Ausbildung. Darauf verweist auch das im abhängigen Temporalsatz enthaltene mit læring ‚(geistliche) Unterweisung, Unterricht‘ (vgl. Baetke 2002: 397) synonyme Lexem nám ‚Unterricht, Lehre‘ (vgl. Baetke 2002: 437). Die Attribute SCHRIFTTRÄGER und INHALT bleiben leer. Ihre Werte lassen sich jedoch über Constraints inferieren, weil im Rahmen des geistlichen Unterrichts bestimmte Texte abgeschrieben wurden. Der unerfahrene Schüler beschränkt wohl auch die Qualität des Skripts.
Das Verb rita hat in der S-Redaktion folglich zwei Frames:
1 Den Schreibframe evozieren die Konstruktionen rita e-t e-m und rita e-t á e-u. Erstere referiert auf die Attribute SCHREIBER (ritari) als Agens mit den Werten prestr und djákni, AUFTRAGGEBER als Dativ mit dem Wert prestr und SKRIPT als Thema mit dem Wert bók. Nicht zu vergessen ist die QUALITÄT als Adverb mit dem Wert vel. Letztere wiedergibt die Attribute SCHREIBER, der wegen des einzigen Belegs im Passiv eine Leerstelle bildet, INHALT als Thema mit dem Wert atburðr und SCHRIFTTRÄGER als Ort mit dem Wert bók. Da die beiden Konstruktionen zwei verschiedene Attribute verbinden, ergeben sich unterschiedliche Konzepte: rita e-t e-m bedeutet ‚ein Skript für jemanden erstellen‘ und rita e-t á e-u ‚etwas auf einem Schriftträger festhalten‘.
2 Die Konstruktionen rita með e-m / með innsigli sínu / til e-s evozieren hingegen den Korrespondenzframe, welcher aus den Attributen ABSENDER als Agens mit den Werten erkibiskup und páfi, EMPFÄNGER als Ziel (til e-s) mit dem Werten erkibiskup, BOTE (með e-m) mit dem Wert Jón und dem SIEGEL (innsigli). Unsicher sind die BOTSCHAFT mál als Thema und der EMPFÄNGER páfi als Dativ. INHALT und SCHRIFTTRÄGER sind Leerstellen, die sich mithilfe des Kontexts füllen lassen. Für letzteren gibt es die Werte bréf und rit, für ersteren gibt es keine Lexeme als Werte, sondern Sätze. Der SCHREIBER bildet in beiden Belegen eine Leerstelle. Auch für diese Konstruktionen gibt es unterschiedliche Konzepte: rita með e-m bedeutet ‚jemandem einen Brief mitgeben‘, með innsigli e-s ‚einen Brief mit seinem Siegel ausstellen‘ und rita til e-s ‚jemandem schreiben, d.h. einen Brief senden‘.