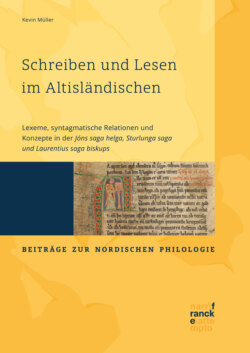Читать книгу Schreiben und Lesen im Altisländischen - Kevin Müller - Страница 18
3.1.2. L-Redaktion
ОглавлениеDie obige Unterrichtsszene (s. Kap. II.3.1.1.g.) kommt auch in der L-Redaktion vor: a) „sumir laasv heil<a>gar Ritningar. sumir Rituðu. sumir sungv Sumir naamu. sumir kenðu“ (JSH 87). ‚Einige lasen die Heilige Schrift, einige schrieben, einige sangen, einige lernten, einige lehrten‘ (Übers. KM). Hier hat das Verb rita ebenfalls nur eine Ergänzung, das Subjekt, das durch das Indefinitpronomen sumir ‚einige‘ (vgl. Baetke 2002: 618) besetzt ist, welches sich entweder allgemein auf die Geistlichen in Hólar bezieht oder auf das vorher genannte menn til kenslu ‚Leute zur Unterweisung‘. Somit ist wiederum der ZWECK erwähnt mit dem Wert kensla ‚Unterweisung, Unterricht‘ (vgl. Baetke 2002: 323), einem Synonym zu den in der S-Redaktion erwähnten Substantiven nám und læring. Sowohl der ZWECK kensla als auch die Schüler als Agens schränken die Inhalte, Skripte und Schriftträger ein. Schreiben wird hier neben anderen Tätigkeiten wie Lesen, Singen, Lernen und Lehren aufgeführt, die typisch für den geistlichen Alltag sind, so dass auch die Abschreibetätigkeit von Geistlichen als Gottesdienst und zum Zwecke der Buchproduktion gemeint sein könnte. Von diesen Verben hat allein lesa ‚lesen‘ ein Akkusativobjekt, nämlich heilagar ritningar ‚die Heilige Schrift‘. Sowohl syntaktisch als auch semantisch ist es möglich, dass die fünf Verben dieses Akkusativobjekt teilen, so dass die Heilige Schrift den Inhalt der Lektüre, Schreibarbeit, Liturgie und des Unterrichts bildete. Sie wäre somit ein möglicher Wert für das Attribut SKRIPT. Man kann hier also nur mutmassen, wie sich der Frame zusammensetzt. Als Schreiber kommen Geistliche und Schüler als Werte in Frage. Der Zweck kensla ist implizit vorhanden, aber keine Ergänzung von rita. Im ONP (rita) gibt es allerdings einen Beleg aus der Mágus saga jarls mit der Kollokation rita sǫgu til gamans (vgl. Þórðarson 1858: 175), wo das Attribut ZWECK eine Ergänzung von rita ist.
Nebst diesem Beleg kommt das Verb rita in der L-Redaktion noch sechsmal vor. Da es keinen eindeutigen Beleg von ríta gibt, muss man davon ausgehen, dass es sich auch bei den vier ambigen Fällen um rita handelt. Einer davon gehört ebenfalls in den Schulbetrieb des Bischofssitzes Hólar, welcher in der S-Redaktion fehlt: b) „hafdi hann marga uaska læresueina vndir ser ritandi bækr margar ok merkiligar þær sem tiaz at Holum ok uida annas stadar“ (JSH 87f.). ‚Er [= Jón] hatte viele tüchtige Schüler unter sich, welche viele und bedeutende Bücher schrieben, die in Hólar und anderswo weitherum bezeugt sind‘ (Übers. KM). Rita/ríta hat die Form eines Partizip Präsens, das ein Attribut zu lærisveina ‚Schüler, Jünger‘ (vgl. Baetke 2002: 397) bildet. Das Bezugswort ist gleichzeitig das Agens, somit ist lærisveinar ein Wert für das Attribut SCHREIBER. Das Akkusativobjekt enthält das Lexem bók ‚Buch‘ als Wert für den SCHRIFTTRÄGER oder metonymisch verschoben für das SKRIPT. Der INHALT bleibt eine Leerstelle und ist aus dem Kontext nicht erschliessbar. Die beiden Adjektive margr ‚viel‘ und merkiligr ‚bemerkenswert, ausgezeichnet‘ (vgl. Baetke 2002: 416), sowie der Relativsatz helfen diesbezüglich nicht weiter, machen aber Angaben zur Quantität und Qualität der Bücher. In der S-Redaktion entsprach schon ein solches Attribut góð zu bók dem Adverb vel als Ergänzung zu rita. Die bemerkenswerte Qualität der Bücher gibt Rückschluss auf die Qualität des Schreibens und auf die Fähigkeit der Schreiber.
Zwei weitere Belege von rita mit dem Akkusativobjekt bók kommen in der gleichen Szene vor wie in der S-Redaktion, wo ein Schreiber und ehemaliger Schüler (lærisveinn) Bischof Jóns ihn bittet, sein Buch zu bewerten (s. Kap. II.3.1.1.a. und b.). Anstelle von ritari steht hier das Synonym skrifari, das zusätzlich ‚Maler, Zeichner‘ bedeuten kann (vgl. Baetke 2002: 564). Das Attribut hinn bezti ‚der beste‘ zeichnet seine Fähigkeit aus. Nachdem Jón das Buch angeschaut hat, sagt er: c) „þetta er god bok. enn annaR man eignaz en sáá sem þu hefir ritað hana“ (JSH 96). ‚Dies ist ein gutes Buch, aber ein anderer Mann wird es in Besitz nehmen als jener, für den du es geschrieben hast‘ (Übers. KM). Das Verb rita hat hier drei Ergänzungen: erstens das Subjekt þú ‚du‘, welches auf den Schreiber (skrifari) verweist, zweitens das Akkusativobjekt hana ‚sie (Akk. Sg. f.)‘, welches für das Buch (bók f.) steht, und drittens die Relativpartikel sem, die sehr wahrscheinlich die Stelle des Dativobjektes besetzt und auf den Auftraggeber des Buches referiert. Es kommen also dieselben Attribute SCHREIBER, SCHRIFTTRÄGER und AUFTRAGGEBER wie in der S-Redaktion vor, mit den gleichen Werten skrifari, bók und prestr. Auffällig ist hier der Kontrast von skrifari und rita, welches im Gegensatz zu skrifa nicht die Bedeutung ‚malen, zeichnen‘ hat (vgl. Baetke 2002: 564), was möglicherweise auf fehlende Illuminationen hinweist, obwohl diese in der Kompetenz des skrifari standen.
Beim zweiten Beleg bittet der Schreiber Jón trotzdem das Buch zu bewerten, mit der Begründung: d) „þuiat hann bað mik at ek skyllda rett meðr þessum hætti rita honum bockina“ (JSH 96). ‚Denn er bat mich, dass ich das Buch gerade auf diese Weise schreiben solle‘ (Übers. KM). Subjekt von rita/ríta ist ek ‚ich‘, welches auf den skrifari verweist. Akkusativobjekt ist bók und Dativobjekt ist honum ‚ihm‘, also der Auftraggeber. Das Verb hat aber bei diesem Beleg noch eine vierte Ergänzung, das Präpositionalobjekt rétt meðr þessum hætti ‚gerade auf diese Art und Weise‘. Diese Art und Weise (háttr) bezeichnet das Attribut QUALITÄT, das in der S-Redaktion den Wert vel hat, für den die L-Redaktion eine Entsprechung in Jóns Urteil þetta er góð bók ‚dies ist ein gutes Buch‘ mit dem Wert góðr ‚gut‘ hat.
Der nächste Beleg kommt in der Szene mit dem in einem Buch festgehaltenen Ereignis vor, welche auch in der S-Redaktion erwähnt wird (Kap. Beleg 3.1.1. c.):
e) Enn hinn næsta dag eptir komu menn aa funð hins h(eilaga) Iohannis. þeir er nykomnir voru af Noregi. færandi honum einn litinn bækling aa huerre bok ritaðr var saa atburdr er monnum var miok ukunnigr […] (JSH 93f.).
Aber am nächsten Tag danach kamen Leute zum heiligen Johannes, welche eben aus Norwegen angekommen waren, und überbrachten ihm ein kleines Büchlein. Auf diesem Buch war das Ereignis aufgeschrieben, welches den Leuten sehr unbekannt war […] (Übers. KM).
Rita steht hier im Passiv. Subjekt ist wie schon in der S-Redaktion atburðr ‚Ereignis‘ und der Schriftträger wird als Ort im Präpositionalobjekt á bók wiedergegeben. Das Lexem atburðr ist ein Wert für das Attribut INHALT und bók für den SCHRIFTTRÄGER.
Im Briefverkehr zwischen dem Papst und Erzbischof von Lund ist rita/ríta in der L-Redaktion nur einmal belegt, als der Erzbischof sagt: f) „enn ver skulum rita meðr þer ok tia þitt maal fyrir herra pafanum“ (JSH 79). ‚Aber wir werden dir ein Schreiben mitgeben und deine Angelegenheit dem Papst darlegen‘ (Übers. KM). Hier hat rita zwei Ergänzungen, das Subjekt vér ‚wir‘ für den Erzbischof und das Präpositionalobjekt meðr þér ‚mit dir‘, das sich an den Priester Jón, den Boten des Briefes, richtet. Die Attributkonstellation ist gleich wie in der S-Redaktion (s. Kap. II.3.1.1.e.) mit dem ABSENDER erkibiskup und dem BOTEN Jón. Der INHALT mál und der EMPFÄNGER páfi werden im selben Satz als Ergänzungen von tjá ‚darlegen‘ genannt, welche möglicherweise auch zu rita gehören könnten. Dass damit ein Brief (bréf) mit Siegeln (innsigli), welche in der S-Redaktion als Füllung belegt sind, gemeint ist, wird erst explizit genannt, als Jón vor dem Papst steht. Im Kontext lassen sich also dieselben Attribute finden, von denen aber nur zwei Ergänzungen von rita bilden.
Der letzte Beleg von rita stammt aus einem Kommentar des Autors der Saga, der in der S-Redaktion fehlt:
g) MEÐR þi at wer siaaum at gudligh miskunn auðsynir ok fagrliga birtir meðr berum jarteinum ok haaleitum taaknum. / dyrdar fulla uerdleika heilags Ions Hola byskups. er oss hardla naud synligt at rita ok saman setia. þa luti er honum eru til lofs ok dyrdar. eptir þi sem til vaar er komit af Roksamligri fra sogn margra skilrikra manna (JSH 98).
Weil wir sehen, dass die göttliche Gnade mit deutlichen Zeichen und erhabenen Wundern die grossartigen Verdienste des heiligen Bischofs Jón von Hólar offenbart und schön kundtut, ist es nötig, dass wir die Teile schreiben und zusammensetzen, welche ihm zu Lob und Herrlichkeit gereichen, gemäss dem, was zu uns aus zuverlässigem Bericht vieler verständiger Leute gekommen ist (Übers. KM).
Das Subjekt fehlt, denn rita/ríta ist Teil eines Infinitivsatzes und das finite Verb ist Teil einer unpersönlichen Konstruktion mit dem Personalpronomen oss ‚uns‘, welches auf den Autor referiert, der somit das Agens von rita ist. Die 1. Person Pl. ist laut Foote (2003: CCXL) typisch für alle Redaktionen der Jóns saga helga und hat ihr Vorbild in der lateinischen Schriftsprache. Der Plural könnte aber durchaus für eine Gruppe, bestehend aus Autor und Schreibern, stehen. Zu diesem Schluss kommt auch Lönnroth (1964: 85f.) beim Vergleich der Pronomina und im Prolog der Heimskringla, wo ek ‚ich‘ Subjekt von láta rita ‚schreiben lassen‘, aber vér ‚wir‘ Subjekt von rita ist. Dieses Teamwork wird möglicherweise dadurch bestätigt, dass vér nicht nur Agens von rita, sondern auch von setja saman ‚zusammensetzen, kompilieren, verfassen‘ ist.
Im Akkusativobjekt ist hlutr ‚Stück (eines Ganzen), Teil‘ (vgl. Baetke 2002: 262) enthalten, das gleichzeitig auch Akkusativobjekt von setja saman ist, welches weiter unten (vgl. Kap. II.7.1.b.) genauer besprochen wird. Die Paarformel rita ok saman setja erinnert an die von Ludwig (2005: 129) zitierte lateinische Inschrift hic scribat et dictat über einer Darstellung Johannes von Buxtehude als Schreibenden aus dem 13. Jahrhundert. Verfassen und Schreiben werden auch da von einer Person ausgeführt, aber lexikalisch unterschieden. Der Singular im Lateinischen spräche wiederum gegen die obige Annahme, dass es sich um Teamwork handelte.
Es sind also die Bestandteile der Erzählung, welche der Autor oder Kompilator zusammenfügt und entweder von ihm selbst niedergeschrieben wird oder von einem Schreiber. Es kann bei diesem Beleg wegen des Pronomens im Plural nicht sicher entschieden werden, welchen Wert das Attribut SCHREIBER hat. Es bleibt auch unklar, in welcher Form diese Teile an den Schreiber gelangen, als Diktat oder als Notiz auf einer Wachstafel, wenn der Autor nicht aus seinem Gedächtnis schreibt. Es kann sich um die Teile des INHALTES, welche aufgeschrieben werden, oder auch des SKRIPTES handeln, welche abgeschrieben werden. Der SCHRIFTTRÄGER ist zwar eine Leerstelle, ergibt sich aber aus der Situation, da das Skript der Saga in einem handschriftlichen Kodex vorliegt.
Neben dem Akkusativobjekt hat rita noch eine weitere Ergänzung, welche bisher noch nicht vorgekommen ist, das Präpositionalobjekt eptir því mit einem Relativsatz. Die Präposition eptir ‚übereinstimmend mit, entsprechend, nach; nach dem Vorbild von, in Anlehnung an‘ (vgl. Baetke 2002: 113) weist daraufhin, nach welchem Vorbild die Bestandteile (hlutir) zusammengesetzt und aufgeschrieben wurden, nämlich dem Bericht verständiger Leute. Somit gibt es ein neues Attribut QUELLE, deren Wert nicht auf ein Lexem reduziert werden kann, weil hier diverse Attribute eines Attributframes vorkommen, die nur postuliert werden können, wie AUTORITÄT, auf welche die Adjektive rǫksamligr ‚zuverlässig‘ und skilríkr ‚verständig‘ referieren, TEXT mit dem Wert frásǫgn ‚Erzählung‘, wobei nicht entschieden kann, ob dieser schriftlich oder mündlich ist, und AUTOR oder ZEUGE mit dem Wert menn ‚Leute‘. Das Demonstrativpronomen því steht in Beziehung zur Relativpartikel sem, welche das Subjekt des Verbs koma ‚kommen‘ im Relativsatz besetzt. Dieses Verb hat zwei weitere Ergänzungen til vár ‚zu uns, d.h. zum Autor (und den Schreibern)‘ und af […] frásǫgn […] ‚von der […] Erzählung […]‘. Im Zentrum steht also das Lexem frásǫgn und wird deshalb an dieser Stelle als Wert zum Attribut QUELLE gerechnet.
Das Attribut ZWECK lässt sich zwar in der Jóns saga helga nicht als Ergänzung nachweisen, aber ein Beleg aus dem ONP (rita) bestätigt, dass das im Kontext erwähnte til kenslu ‚zur Unterweisung‘ durchaus in den Frame von rita gehört. Wahrscheinlich besteht zwischen den Werten der Attribute ZWECK und TEXT ein Constraint, weil der Wert kensla die Werte für den TEXT auf im Unterricht verwendete Texte einschränkt.
Es lässt sich anhand dieser Belege festhalten, dass die L-Redaktion in den meisten Punkten mit der S-Redaktion übereinstimmt. Es gibt wiederum zwei Frames: Den Schreibframe evozieren zwei Konstruktionen:
1 rita e-t e-m með e-m hætti bestehend aus den Attributen SCHREIBER (skrifari) als Agens mit den Werten lærisveinn ‚Schüler‘ und menn til kenslu ‚Leute zur Unterweisung‘, dem SKRIPT mit dem Wert bók ‚Buch‘ als Thema, dem AUFTRAGGEBER mit dem Wert prestr ‚Priester‘ als Dativobjekt und der QUALITÄT, welche das Lexem háttr ‚Art und Weise‘ im Präpositionalobjekt með e-m bezeichnet. Hierzu kann auch das Attribut ZWECK gerechnet werden mit Präpositionalobjekt [til e-s].
2 rita e-t á e-u bestehend aus dem SCHREIBER als Agens, dem INHALT als Thema mit den Werten atburðr und dem SCHRIFTTRÄGER als Ort mit dem Wert bók. Das Attribut QUELLE mit dem Wert frásǫgn im Präpositionalobjekt eptir e-u kann beiden Konstruktionen zugerechnet werden, da das Thema für den INHALT oder das SKRIPT mit dem Wert hlutr ‚Teil‘ stehen kann.
Beim Korrespondenzframe ist der ABSENDER mit dem Wert erkibiskup das Agens. In der L-Redaktion ist nur der BOTE mit der Präposition með und dem Wert Jón als Füllung sicher belegt. Aus dem Kontext ergeben sich aber dieselben Attribute wie in der S-Redaktion: EMPFÄNGER, INHALT, SCHRIFTTRÄGER und SIEGEL (innsigli).
Die Konstruktionen rita e-t e-m, rita e-t á e-u und rita e-t með e-m sind also synonym mit jenen in der S-Redaktion. Neu ist rita e-t eptir e-u mit dem Konzept ‚etw. nach Vorgabe/Vorbild von jdm. oder etw. auf- oder abschreiben‘.