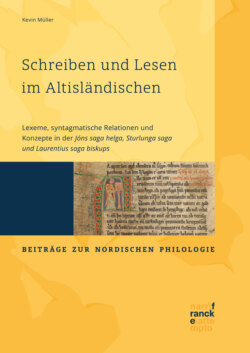Читать книгу Schreiben und Lesen im Altisländischen - Kevin Müller - Страница 6
1. Einleitung
ОглавлениеAls Lexeme für das Schreiben und Lesen im Altisländischen kommen vermutlich unmittelbar skrifa und lesa in den Sinn. Aber was bedeuten diese beiden Verben eigentlich? Sie leben zwar als skrifa ‚schreiben‘ und lesa ‚lesen‘ im Neuisländischen weiter, aber diese beiden neuisländischen Bedeutungen lassen sich nur bedingt auf das Altisländische übertragen, da sich die Konzepte SCHREIBEN und LESEN in diesen beiden Sprachstufen grundlegend unterscheiden. Schreiben und Lesen sind zwei zentrale Aspekte der mittelalterlichen Schriftlichkeit, die seit Jahrzehnten durch verschiedene Disziplinen erforscht wird (vgl. Glauser/Heslop 2018, Raible 1994, Sigurðsson 2005). Diese Forschung interessierte sich bis in die jüngste Zeit vor allem für den Medienwandel von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit und betrachtete die Schreib- und Lesepraktiken hauptsächlich aus dieser Perspektive (vgl. Green 1994 und 2007, Ludwig 2005, Parkes 1999, Saenger 1999). Für die Erforschung dieser Praktiken spielen der lateinische und der volkssprachliche Wortschatz eine zentrale Rolle, weil sich die unterschiedlichen Praktiken teilweise darin widerspiegeln. So war das Konzept VERFASSEN (lat. dictare) als rhetorischer Akt im Konzept SCHREIBEN (lat. scribere) lange Zeit nicht enthalten, und erst im Laufe des Mittelalters setzte sich neben dem lauten Lesen (lat. legere, praelegere) auch stilles Lesen (lat. videre, inspicere) durch. Dies gilt auch für den altnordischen Wortschatz. Spurkland (2000) stellt beispielsweise eine Entwicklung beim Lesen vom Nacherzählen und Zeigen des Textes mit dem Verb bera fram ‚vortragen, vorweisen‘, über ein lautes Vorlesen mit dem Verb lesa ‚vorlesen‘ zu einem visuellen Lesen yfirlíta ‚überblicken‘ fest. Im Wortschatz des Altnordischen äussern sich zudem nicht nur unterschiedliche Lesepraktiken, sondern auch zwei Schriftlichkeiten, eine lateinische (literacy) mit den Verben rita ‚schreiben‘ und lesa ‚lesen‘ und eine runische (runacy) mit entsprechenden Verben rísta ‚ritzen‘ und ráða ‚deuten‘ (vgl. Spurkland 1994, 2004, 2005).
Ähnliche Dichotomien konnte ich in meiner Lizentiatsarbeit zur Terminologie und Mentalität der Schriftlichkeit in der Sturlunga saga feststellen (vgl. Müller 2018), welche den Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit bildet. So lassen sich die verba scribendi der Sturlunga saga nach den Konzepten SCHREIBEN, mit rita, ríta ‚schreiben‘ oder skrásetja ‚auflisten‘, und VERFASSEN, mit segja fyrir ‚vorsagen, diktieren; verfassen‘ oder setja saman ‚zusammensetzen; verfassen‘, gruppieren. Bezüglich runacy ist hingegen einzig das Verb rísta nachweisbar. Das Lesen lässt sich in ein lautes, mit den verba scribendi lesa oder lesa upp, und ein stilles, mit sjá und líta á, unterteilen. Die Bedeutung einzelner Verben konnte aber wegen der teilweise dünnen Beleglage in der Sturlunga saga nicht zweifelsfrei erörtert werden.
Das Gegenüber von Mündlichkeit und Schriftlichkeit wurde zwar schon früh mit der Vokalität verbunden (vgl. Schaefer 1992, Glauser/Heslop 2018), dieses Konzept wurde aber in der oben erwähnten Forschung kaum berücksichtigt. Jüngere Arbeiten zur Medialität haben den engen Blick auf die Mündlichkeit und Schriftlichkeit weiter geöffnet, was neue Erkenntnisse zu den Schreib- und Lesepraktiken ermöglichte. So erweiterte Glauser (2010) die Perspektive auf zahlreiche andere Aspekte wie Körper, Gedächtnis, Visualität, Materialität, Autorität, Rhetorik oder Sprache. Er nennt dazu auch entsprechende Lexeme, es fragt sich aber aus semantischer und lexikalischer Perspektive, inwiefern diese Aspekte in die Konzepte SCHREIBEN und LESEN gehören. Die übrige Forschung der vergangenen Jahre bezog diverse ähnliche Aspekte mit ein (vgl. u.a. Lutz et al. 2010, Schnyder 2006, Teuscher 2007), jedoch fehlt auch in diesen Arbeiten meist ein direkter Bezug zum Wortschatz. Es stellt sich daher im Hinblick auf die oben aufgeführten Beispiele zu Dichotomien wie scribere und dictare die Frage, ob diese nicht vielmehr die Fragestellung der jeweiligen Forschungsrichtung als tatsächliche Aspekte der mittelalterlichen Schriftlichkeit widerspiegeln. Es steht ausser Frage, dass Schreiben einen Körper, Materialien und eine Sprache beansprucht. Statt den Wortschatz und die Bedeutung den Dichotomien der jeweiligen Fragestellung unterzuordnen, erscheint es in einem ersten Schritt sinnvoller, den Wortschatz und die Bedeutung linguistisch zu analysieren. Dies könnte von der einseitigen Betrachtung von Wortpaaren, binären Merkmalen und einzelnen Textstellen wegführen und die Perspektive auf andere Aspekte des Schreibens und Lesens öffnen. Darauf aufbauend wäre es möglich, neuen Fragestellungen nachzugehen.
Dies führt letztlich zu der Frage, wie ein mittelalterlicher Wortschatz verstanden werden kann. In den meisten Fällen handelt es sich, wie oben anhand der Beispiele skrifa und lesa gezeigt, um Sprachstufen, die in der Moderne eine Fortsetzung haben. Die Konzepte der modernen Lexeme müssen jedoch auf den historischen, soziokulturellen Kontext der jeweiligen Sprachstufe bezogen werden. Dabei spielt nicht nur der soziokulturelle Hintergrund, sondern auch der sprachliche Kontext des Belegs eine Rolle, da konzeptuelle Verschiebungen die Regel sind, wie beispielsweise Lebsanft (2006) am Beispiel von afrz. aventure oder Lenerz (2006) mit mhd. mære gezeigt haben (s.a. Kap. I.2.). Dies gilt auch für das polyseme Verb aisl. lesa, dessen Bedeutungen sich in den Kollokationen lesa bók ‚ein Buch lesen‘ oder lesa ber ‚Beeren lesen‘ grundlegend unterscheiden. Die konzeptuellen Unterschiede äussern sich bei diesen Beispielen in den Kollokationen. Die Methode des Kollokationenvergleichs ermöglicht es, solche Unterschiede zu erörtern (vgl. Fritz 2005: 23–27, Fritz 2006: 13, 95, 132). Wie können aber diese syntagmatischen Relationen auf der Ausdrucksseite auf die Inhaltsseite übertragen werden? Ein Modell, das diese beiden Seiten des sprachlichen Zeichens in Beziehung setzt und sich auf das Verstehen ausrichtet, ist die Framesemantik. Die Anwendung der Frametheorie befindet sich in der Semantik zwar noch in ihren Anfängen, bietet aber ein konkretes und differenziertes Modell und ermöglicht klare Aussagen über die Zusammensetzung und Struktur von Konzepten (vgl. Löbner 2015: 368). Der theoretische Hintergrund wie auch das methodische Vorgehen werden im nächsten Kapitel (s. Kap. I.2.) noch eingehender erläutert. Die syntagmatischen Relationen eines Lexems widerspiegeln also die Strukturen des Konzepts, so dass umgekehrt über diese Relationen die Strukturen erkennbar sind. Daraus ergeben sich für die Analyse des Konzepts folgende drei Fragen: 1. Welche syntagmatischen Relationen weist ein Lexem auf? 2. Auf welche Stellen des Frames passen die jeweiligen Relationen? 3. Wie ist das Konzept strukturiert? In Anbetracht des Wortschatzes stellt sich noch eine weitere Frage: Welche paradigmatischen Relationen bestehen zwischen den Lexemen?
Diese Fragen lassen sich aber nur auf Basis eines geeigneten Korpus beantworten, was zur nächsten Frage führt: Welches Korpus ist überhaupt geeignet? In der bisherigen Forschung wurden verschiedene altnordische Texte analysiert wie Prologe zu verschiedenen Sagas (vgl. Glauser 2010), ein einzelner Text mit der Sturlunga saga (vgl. Müller 2018), verschiedene Handschriften von Königssagas (vgl. Spurkland 2000) oder auch das Korpus der norwegischen Runeninschriften (vgl. Spurkland 1994). Die Prologe reflektieren zwar die Schriftlichkeit auf vertiefte Weise, sind aber als Texte sehr kurz und in der Überlieferung äusserst heterogen, was die lexikalische und semantische Analyse erschwert. Ein einzelner Text wie die Sturlunga saga ist hingegen im Wortschatz und in den Belegen begrenzt, und die Ergebnisse haben nur für diesen einen Text Geltung. Der Vergleich unterschiedlicher Handschriften demonstriert, dass sie sich im Wortschatz unterscheiden. Ein umfassendes Korpus wie im Fall der Runenschriften ermöglicht die Analyse des Wortschatzes in einem grösseren Rahmen, jedoch existieren für altisländische Texte noch keine geeigneten Korpora, weil diese entweder nicht auf kritischen Editionen basieren oder noch zu wenig Texte enthalten. Für das Korpus der vorliegenden Arbeit muss wegen der manuellen Auswertung eine eingeschränkte Auswahl grösserer Texte getroffen werden, welche die Sturlunga saga, Jóns saga helga und Laurentius saga biskups und somit wichtige, kritisch edierte Quellen für die isländische Schriftkultur der Zeit vom 12. bis 14. Jahrhundert umfasst. Dieses Korpus enthält eine grössere Menge an Belegen als in den Prologen und der Sturlunga saga und repräsentiert einen anderen sprachlichen und sozialen Hintergrund als die norwegischen Runenschriften und Königssagas, nämlich Island. Die einzelnen Sagas streuen sich zudem zeitlich über das ganze Mittelalter. Die Zusammensetzung des Korpus wird im Kapitel I.3. noch genauer dargelegt.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist somit, den Wortschatz der Konzepte SCHREIBEN und LESEN in diesem Korpus aus der Perspektive der Framesemantik zu analysieren. Die Ausgangslage der Analyse bilden hierfür einerseits die Ergebnisse der bisherigen Forschung, welche eine Vielzahl von Lexemen zum Schreiben und Lesen untersucht hat, von denen jedoch im Zuge dieser Arbeit nicht alle im vorliegenden Korpus nachgewiesen werden konnten. Deshalb werden andererseits auch spezifische Belege der bisherigen Forschung untersuchten Quellen berücksichtigt und mit der Methode der vorliegenden Arbeit neu beleuchtet. Im Laufe des Exzerpierens kamen noch einige wenige weitere Lexeme hinzu, welche unter eines der beiden Konzepte fallen, die in den jeweiligen Analysekapiteln reflektiert werden (s. Kap. II.1. und III.1.).
An die Analyse der Lexeme schliessen sich vier weitere Fragen an: 1. In welchem Verhältnis stehen diese Konzepte zu den Erkenntnissen der bisherigen Forschung und 2. welche neuen Erkenntnisse können sie bieten? Aus linguistischer Warte stellen sich zwei zusätzliche Fragen: 3. Welcher lexikalische und semantische Wandel hat im Laufe des Mittelalters stattgefunden und 4. wie repräsentativ ist das untersuchte Korpus überhaupt?
Entlang dieser Fragen bewegt sich der weitere Verlauf der vorliegenden Arbeit. Das folgende Kapitel I.2. widmet sich, wie bereits erwähnt, der Theorie und Methode, wie die Bedeutung eines Lexems systematisch im Kontext analysiert werden kann. Das nachfolgende Kapitel I.3. beschreibt die Bildung und Zusammensetzung des Korpus. Auf diesen ersten, einführenden Teil folgen zwei gleich aufgebaute Analyseteile zum Schreiben (Teil II) und zum Lesen (Teil III). Das einleitende Kapitel widmet sich dabei jeweils eingehend der Forschung zum jeweiligen Wortschatz, dessen Zusammensetzung, den Konzepten und den möglichen Attributen des Frames. In der Folge werden die einzelnen Belegstellen nach syntagmatischen Relationen untersucht und diese den möglichen Attributen des Frames zugeordnet. Die zu analysierenden Belegstellen ordnen sich nach den Lexemen und Texten. Grössere Belegreihen werden gegebenenfalls nach Valenzen oder Kollokationen noch feiner unterteilt. Wenn in einem Kapitel zwei oder mehr Belege analysiert werden, werden sie der Übersicht halber mit Minuskeln versehen.
Die Ergebnisse zu den einzelnen Lexemen und Texten werden am Schluss der betreffenden Kapitel gesammelt, in denen versucht wird, das Konzept mit dem auf Grundlage der syntagmatischen Relationen und semantischen Beziehungen zu strukturieren und zu analysieren. Der jeweilige Analyseteil wird mit einer abschliessenden Analyse des Wortschatzes und der Konzepte abgerundet. Die Ergebnisse zu den einzelnen Lexemen werden hier gesammelt und in Beziehung gesetzt. Dies beinhaltet die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Konzepten und syntagmatischen Relationen, die paradigmatischen Relationen im Wortschatz und auch die Ergebnisse der bisherigen Forschung. Der Vergleich ermöglicht es zudem, Schlussfolgerungen zum lexikalischen und semantischen Wandel zu ziehen.
Im abschliessenden vierten Teil werden die im Laufe der Analyse gewonnenen Erkenntnisse in der Konklusion zusammengefasst und reflektiert. Dies betrifft auch die Leistungsfähigkeit der verwendeten Theorie und Methode sowie die Repräsentativität des Korpus. Zuletzt wird die Frage beantwortet, welche neuen Erkenntnisse und neue Anschlüsse diese Arbeit insbesondere im Verhältnis zur bisherigen Forschung bietet. Das anschliessende Abstract bietet zudem eine Zusammenfassung in englischer Sprache.
Weil die Zitate in der Analyse aus Platzgründen möglichst kurz gehalten und dieselben Belegstellen aus lexikalischen und syntaktischen Gründen getrennt behandelt werden, enthält diese Arbeit am Schluss einen Anhang mit allen Belegstellen des Korpus, die zur besseren Übersicht nach den Texten und Seitenzahlen geordnet sind. Dies ermöglicht, die Belege in einem weiteren Kontext und aus der Perspektive der Erzählung zu betrachten. Da die Arbeit nach den Lexemen geordnet ist, können einzelne Lexeme aus den Belegen über das Inhaltsverzeichnis gefunden werden.
Da die Texte in den Editionen grösstenteils nicht normalisiert abgedruckt sind, werden für eine bessere Lesbarkeit im Lauftext der Arbeit die Lexeme, Konstituenten und Kollokationen normalisiert. Altisländische Namen behalten die Endung -r (z.B. Guðmundr), im Genitiv wird sie aber weggelassen (z.B. Guðmunds). Beinamen werden nicht übersetzt und klein geschrieben. Alle Texte des Korpus sind bisher nicht vollständig ins Deutsche übersetzt worden. Deshalb stammen die Übersetzungen der zitierten Stellen vom Autor der vorliegenden Arbeit (gekennzeichnet durch „KM“) und bewegen sich der Transparenz der Analyse wegen möglichst nahe am Wortlaut der Originalsprache, wofür stilistische Kriterien unter Umständen zurückgestellt werden mussten.