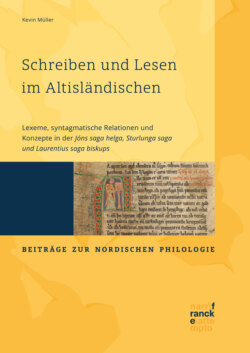Читать книгу Schreiben und Lesen im Altisländischen - Kevin Müller - Страница 23
3.2.4. rita e-t ‚etw. schreiben‘
ОглавлениеVon den acht Belegen in den jeweiligen Sagas sind zwei transitiv. Der erste aus der Prestssaga Guðmundar Arasonar erinnert sehr stark an zwei Belege aus der Jóns saga helga (vgl. Kap. II.3.1.1. g. und 3.1. 2.a.):
a) Hann tok heim til kenzlo clerca, oc var þat at-havpn hans dagliga tiþa i millom at kenna oc rita. Hann var oc at kirkio micinn lvta natta bæþi ondverþar nætr oc ofanverdar, enn gecc til scripta iafnan, er hann naþi cenne-monnum. Hann rannsacaþi bæcr manna oc hendir af hvers bocvm, þar er hann kemr, slict er hann hafði eigi adr (StS1 148).
Er [= Guðmundr prestr] begab sich nach Hause zum Unterricht der Kleriker, und es war sein Vorhaben, täglich zwischen den Gottesdiensten zu lehren und zu schreiben. Er war auch einen grossen Teil der Nächte in der Kirche, sowohl am Anfang als auch am Ende der Nächte. Und er ging ebenso zur Beichte, als er zu den Geistlichen gelangte. Er erforschte die Bücher der Leute und nimmt aus eines jeden Buch, an das er herankommt, was er vorher noch nicht hatte (Übers. KM).
Rita/ríta ist bei diesem Beleg Teil eines Infinitivsatzes, so dass kein Subjekt vorhanden ist. Das Agens ergibt sich aus dem Possessivpronomen hans ‚sein‘ im Hauptsatz, welches auf den Priester Guðmundr Arason verweist. Der Codex Resenianus weist zu dieser Stelle keine wesentlichen Abweichungen auf (vgl. StS1 148). Das Akkusativobjekt fehlt zwar, aber es gibt eine Temporaladverbiale tíða í millum ‚zwischen den Gottesdiensten‘ im Hauptsatz, welche auf das Attribut ZEIT verweist. Wie in der Jóns saga helga wird Schreiben wie das Lehren und das Studium der Bücher als alltägliche Arbeit eines Geistlichen beschrieben, so dass man auch bei diesem Beleg annehmen muss, dass es sich um das Abschreiben geistlicher Texte im Dienste Gottes und der Buchproduktion handelt. Das Agens steht für das Attribut SCHREIBER mit dem Wert prestr. Für das SKRIPT muss hingegen über die Werteconstraints mit dem Attribut LESER ein Wert inferiert werden. Der Wert prestr deutet auf liturgische Bücher hin. Dieser Wert schränkt wiederum die Werte der Attribute SCHRIFTTRÄGER und INHALT ein.
Der zweite Beleg aus der Íslendinga saga sticht heraus, weil dort das Skript wörtlich zitiert wird: b) „Ok var þat saugn Arnfinnz, at hertuginn gę́fi Snorra iarls nafn, ok sua hefir Styrmir hinn fróði ritað ‚aártið Snorra folsnar-iarls‘“ (StS1 540). ‚Und Arnfinns Bericht war, dass der Herzog Snorri den Jarlstitel gegeben habe, und so hat Styrmir der Kluge geschrieben: „die Jahrzeit des Jarls Snorri von Fólgsn1“‘ (Übers. KM). Der Schreiber und das Subjekt von rita ist Styrmir hinn fróði, ein Gesetzessprecher und vier Jahre nach Snorris Tod (1241) Prior des Klosters Viðey (vgl. Lönnroth 1968: 85). Die Interpunktion stammt vom Editor Kristian Kålund, d.h. es ist seine Interpretation, dass „»aártið Snorra folsnar-iarls«“ ein Zitat von Styrmis Eintrag in ein Jahrzeitbuch ist. Grundsätzlich ist es möglich, dass es einfach das Akkusativobjekt von rita darstellt, so dass Styrmir die Jahrzeit Jarl Snorris von Fólgsn schriftlich festgehalten hat. Wenn es sich tatsächlich um ein Zitat handelt, wäre es ein Wert zum SKRIPT, wenn nicht, einer zum INHALT. Das Lexem ártíð ‚Jahrzeit‘ als Wert egal welchen Attributs schränkt gleichzeitig auch jenen des SCHRIFTTRÄGERS ein, weil dann ein Jahrzeitbuch zu erwarten wäre.
Die Ergänzungen dieser beiden Belege sind eher dürftig. Die Berücksichtigung des Kontexts, des Frames und der Constraints helfen diverse Leerstellen zu füllen. Wenn andere Konzepte dieses semantischen Netzwerkes besser bekannt wären, könnten noch mehr Antworten geliefert werden. Es lässt sich soweit festhalten, dass der Frame auch hier aus SCHREIBER, SKRIPT, INHALT und SCHRIFTTRÄGER besteht. Hinzu kommt noch das Attribut ZEIT, dessen Wert tíðir ebenfalls entscheidend ist.