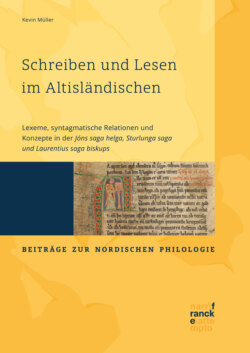Читать книгу Schreiben und Lesen im Altisländischen - Kevin Müller - Страница 20
3.2.1. Der sogenannte Prolog
ОглавлениеIn einem längeren Kommentar des Kompilators vor der Prestssaga Guðmundar Arasonar, dem sogenannten Prolog, ist rita/ríta viermal belegt:
Margar saogor verda her samtiða, oc ma þo eigi allar senn rita: saga Thorlacs biskups hins helga, oc Gvdmundar enns goþa Ara sonar, þar til er hann var vigdr til prests; saga Gvdmvndar hins dyra hefz III vetrvm eptir andlat Sturlu, oc lycr þa er Brandr biskup er andaþr, enn Gvdmunþr enn goþi er þa vigdr til biskups; saga Rafns Sveinbiarnar sonar oc Þorvalðz Snorra sonar er samtiða sogo Gvdmundar hins goþa, oc lycz hon eptir andlat Brandz biskups, sva sem Sturla Þorþar son segir i Islendinga sogvm. Flestar allar sogor, þær er her hafa gorz a Islandi, voro ritadar adr Brandr biskup Semunðar son anðaðiz. Enn þær sogor, er siþan hafa gorz, voro lit ritaþar aðr Sturli skalld Þorþar son sagði fyrir Islendinga sogor, oc hafdi hann þar til visindi af froþvm monnum, þeim er voro a avndverþvm davgom hans, enn svmt eptir brefvm þeim, er þeir ritvþv, er þeim voro samtiþa, er sogornar erv fra. Marga lvti matti hann sialfr sia, þa er a hans davgvm gerdvz til stortiþinda (StS1 119f.).
Viele Geschichten geschehen hier gleichzeitig, und man kann trotzdem nicht alle zugleich schreiben: Die Geschichte von Bischof Þorlákr und jene von Guðmundr góði Arason, bis er zum Priester geweiht wurde. Die Geschichte von Guðmundr dýri beginnt drei Winter nach Sturlas Tod und endet, als Bischof Brandr verstirbt, und Guðmundr der Gute wird dann zum Bischof geweiht. Die Geschichten von Hrafn Sveinbjarnarson und Þorvaldr Snorrason sind gleichzeitig wie die Geschichte Guðmunds des Guten und sie endet nach dem Tode Bischof Brands, wie Sturla Þórðarson in den Isländergeschichten erzählt. Die allermeisten Geschichten, welche hier in Island geschehen/entstanden sind, waren aufgeschrieben worden, bevor Bischof Brandr Sæmundarson verstarb. Aber jene Geschichten, welche danach geschehen/entstanden sind, wurden ein wenig früher aufgeschrieben, als der Dichter Sturla Þórðarson die Isländergeschichten diktierte, und er hatte dafür das Wissen kluger Leute, welche in seinen frühen Jahren lebten, und manches aus den Briefen, welche jene schrieben, welche in der Zeit lebten, aus der die Geschichten stammen. Viele Dinge konnte er selbst sehen, denn zu seiner Zeit geschahen grosse Ereignisse (Übers. KM).
Der erste Beleg rita/ríta ist aktiv, das Subjekt fehlt jedoch, so dass der SCHREIBER eine Leerstelle bildet. Das Pronomen allar ‚alle‘ im Akkusativobjekt kongruiert mit den davor genannten sǫgur ‚Sagas, Geschichten‘. Daneben gibt es noch das Temporaladverb senn ‚zugleich‘ (Baetke 2002: 526) als Ergänzung. Die Gleichzeitigkeit bezieht sich einerseits auf die Handlungszeit der Geschichten und andererseits auf die chronologische Einordnung in der Kompilation. Da die Sturlunga saga eine Kompilation aus bereits bestehenden Sagas ist, auch wenn die wenigsten ausserhalb dieser Kompilation erhalten sind, muss es sich bei diesen sǫgur um Skripte handeln, die für diese Kompilation abgeschrieben werden, d.h. es werden nach der Vorlage wiederum Skripte erstellt. Das Lexem saga wäre damit ein Wert zum Attribut SKRIPT in doppeltem Sinn, als Vorlage und Abschrift. Die Inhalte dieser Skripte werden im Prolog als Genitivattribute mit den Hauptpersonen bei der Aufzählung der einzelnen Sagas erwähnt. Der INHALT ist hier bei rita eine Leerstelle, die aber aus dem Kontext füllbar ist. Im sogenannten Prolog wird nicht gesagt, wie das Problem der chronologischen Einordnung zu lösen ist, die Lösung ist aber in der Sturlunga saga zu sehen, in der Teile der einen Saga in die andere integriert werden (vgl. Thorsson 1988: III, xxxf.).
Zwei weitere Belege von rita sind gleich strukturiert mit der Diathese Passivum und sǫgur als Subjekt. Die sǫgur sind ausserdem Subjekt des polysemen, mediopassiven Verbs gerask, das zwei Bedeutungen laut Baetke (2002: 193) hat: 1. ‚gemacht werden, entstehen‘ und 2. ‚geschehen‘. Diese sind in diesem Kontext relevant und heben zwei Aspekte des Konzepts von saga hervor: 1. den Text bzw. das Skript und 2. die Geschichte bzw. das Ereignis. Das Lexem saga kann folglich als Wert für die Attribute SKRIPT, TEXT und INHALT stehen.
Der vierte Beleg (rita) ist aktiv mit dem Pronomen þeir ‚sie (m. Pl.)‘ im Subjekt und der Relativpartikel er im Akkusativobjekt, welche auf bréfum ‚Brief (Dat. Pl.)‘ im Hauptsatz verweist. Briefe sind Teil der Korrespondenz, so dass das Subjekt nicht nur der SCHREIBER, sondern auch der ABSENDER sein kann. Es werden aber keine BOTEN, EMPFÄNGER oder SIEGEL erwähnt. Es bleibt an dieser Stelle offen, ob rita bréf den Schreib- oder den Korrespondenzframe evoziert, weil die Briefe in diesem Kontext primär als Quelle dienen.