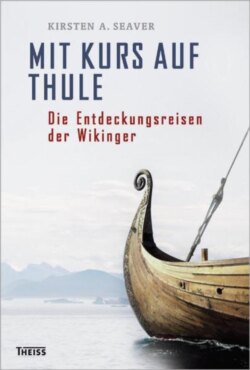Читать книгу Mit Kurs auf Thule - Kirsten A. Seaver - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Nordmänner in Grönland – eine schwierige Spurensuche
ОглавлениеEs zeugt von gewaltiger Energie und Dynamik, dass Island und Grönland vergleichsweise schnell besiedelt wurden, noch während die Nordmänner ihren Zugriff auf Irland, England und Schottland verstärkten. Schon unter den frühesten Siedlern Islands waren Nordmänner von diesen Inseln; andere kamen direkt aus Skandinavien, vor allem aus Gebieten Westnorwegens, die ihre wachsende Bevölkerung nicht mehr ernähren konnten. Dazu gehörte auch Jæren im Südwesten, wo offenbar Eirik »der Rote« Thorvaldsson aufwuchs.2
Eirik war Initiator und Anführer des nordmännischen Vorstoßes nach Westen und der Besiedlung Grönlands kurz vor 990 n. Chr. Die beiden dort gegründeten Kolonien sollten etwa fünf Jahrhunderte Bestand haben. Über alles, was im Laufe dieses halben Jahrtausends in Grönland geschah, wird heute intensiv diskutiert, denn zu diesem komplexen Thema können sowohl moderne archäologische Forschungen als auch eine Vielfalt früher Schriftquellen etwas beitragen.
So beginnt das Íslendingabók (Buch der Isländer) von Ari dem Gelehrten mit der Besiedlung Islands um 870 n. Chr. Es enthält auch einen kurzen Bericht über die Kolonisation Grönlands, die älteste bekannte Erwähnung der gewagten Unternehmung Eiriks des Roten überhaupt. Die Schilderung basiert auf den Erzählungen von Aris Onkel Thorkell Gellison, dem er mit gutem Grund vertrauen konnte.
Das Land, welches Grönland genannt wird, wurde von Island aus entdeckt und besiedelt. Erik der Rote hieß der Mann, ein Breidifjörder, der von hier dorthin fuhr und dort Land nahm, wo es seitdem Eriksfjord heißt; er gab dem Land den Namen und nannte es Grönland; das, meinte er, würde den Leuten Lust machen hinzufahren, wenn das Land einen schönen Namen hätte. Sie fanden da menschliche Wohnungen sowohl im Osten wie im Westen des Landes, auch Reste von Fellbooten und Steinwerkzeuge, woraus man entnehmen kann, dass hierher Menschen solcher Art gekommen waren, wie sie Vínland bewohnen, die die Grönländer Skrälinge nennen.
Es war dies aber vierzehn oder fünfzehn Jahre, bevor das Christentum hier nach Island kam, als er das Land zu besiedeln begann, nach einer Angabe, die Thorkel Gellissohn auf Grönland von einem erhielt, der selbst mit Erik dem Roten hinausgefahren war. 3
Wie vielen anderen isländischen Sagas liegen auch unseren beiden wichtigsten Quellen zu diesem Thema – der »Saga von Eirik dem Roten« und der »Saga von den Grönländern« – mündliche Überlieferungen zugrunde. Beide wurden erst im frühen 13. Jahrhundert niedergeschrieben.4 Das wirft die Frage auf, wie zuverlässig die mündliche Überlieferung der nordischen Geschichte nach zwei Jahrhunderten noch war, zumal beide Sagas auch Einflüsse intellektueller Strömungen aus der Zeit der anonymen Verfasser aufweisen. Glücklicherweise hat sich immer deutlicher gezeigt, dass die Nordmänner Genealogien und Familienüberlieferungen mündlich offenbar über viele Generationen hinweg weitergeben konnten. Ein gutes Beispiel dafür ist eine prahlerische Runeninschrift im Megalithgrab Maeshowe auf den Orkneys: »Diese Runen wurden eingemeißelt vom besten Runenmeister des westlichen Ozeans, mit einer Axt, die einst Gauk Trandilsson im Südteil des Landes [Island] gehörte.« Die Inschrift stammt aus dem Winter 1153/1154, als eine Gruppe nordischer Plünderer, die auf den Hebriden ihr Unwesen getrieben hatten, in dem Ganggrab Zuflucht suchte, und die Prahlerei war das Werk von Thorhall Ásgrimsson, dem Urururenkel des Mannes, der laut »Njáls Saga« für den Tod Gauk Trandilssons verantwortlich war.5
Kommentare zu dem spärlichen Quellenmaterial, mit dem wir arbeiten müssen, sind ebenso zahlreich vorhanden wie schnell veraltet. Glücklicherweise verändern sich die Primärquellen selbst nicht, sondern nur das Licht, in dem jede neue Wissenschaftlergeneration sie liest. Eine eindeutige Unterscheidung zwischen Kommentaren und Quellen hätte wahrscheinlich dazu beitragen können, die heute vorherrschenden Meinungsverschiedenheiten im wissenschaftlichen Diskurs, die über die Nordmänner in Grönland und Nordamerika bestehen, zu minimieren. Wer sich mit der nordischen Besiedlung Grönlands beschäftigt, merkt schnell, dass zahlreiche dieser Missverständnisse auf die Antiquitates Americanae zurückgehen, die bereits in der Einleitung erwähnte Quellensammlung von Carl Christian Rafn und Finn Magnusen aus dem Jahr 1837. Sie wurde völlig zu Recht auf beiden Seiten des Atlantiks begrüßt, ermutigte aber leider auch Wissenschaftler wie Laien gleichermaßen, ziemlich frei über die Nordmänner in Nordamerika und Grönland zu spekulieren. So hatten die Herausgeber etwa behauptet, ein alter Rundturm in Newport, Rhode Island, sei als mittelalterliche nordische Kirche errichtet worden und zeige so eine erfolgreiche und dauerhafte nordische Präsenz in diesem Gebiet über das ganze Mittelalter hinweg.6 Dieser Turm und andere angeblich nordische Schöpfungen nährten eine offenbar unausrottbare, weil wunderschöne, Geschichte. Das »Postskriptum« behandelt sie in Verbindung mit der Vínland-Karte und anderen zweifelhaften Leistungen, die man den mittelalterlichen Nordmännern zugeschrieben hat.
Probleme ergeben sich auch daraus, dass Archäologen, die heute in Grönland arbeiten – meist unter sehr schwierigen Bedingungen –, zusätzlich mit unfachmännischen frühen Grabungen an nordischen Stätten zurechtkommen müssen. Als etwa durchsickerte, dass es in Herjolfsness (dem südlichsten Ausläufer der größten nordischen Siedlung) einen alten nordischen Friedhof gebe, grub ein dänischer Handelsassistent namens Ove Kielsen dort im Jahr 1839 zweieinhalb Tage lang die Erde um und fand ein paar Holzkreuze, einen Schädel, an dem noch blondes Haar klebte, sowie ein Kleidungsstück, das zunächst als »Matrosenjacke« identifiziert wurde, sich später jedoch als Teil eines mittelalterlichen Männergewands entpuppte. Nachdem er für seine schon geleistete Arbeit vier Pfund Sterling Lohn erhalten hatte, heuerte Kielsen vierundzwanzig Mann an, die weitere fünf Tage schaufelten und einen großen Teil des Friedhofs bis zu einem Meter tief aushoben. Durch ihre Bemühungen, die man nach heutigen Standards nur als reinen Vandalismus einstufen kann, kamen einige bescheidene, mehr oder weniger gut erhaltene Gegenstände ans Tageslicht, die die Fachleute in Kopenhagen für wertlos hielten.7
Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ist durch umfangreiche Forschungsarbeit nachgewiesen, dass sich trotz des mittelalterlichen Ausgriffs der Nordmänner auf den Nordatlantik, der zur Besiedlung Grönlands führte, eine bemerkenswerte kulturelle Verwandtschaft unter allen nordischen Gesellschaften rund um den Nordatlantik und die Nordsee erhielt. Gleichzeitig betrachteten sich die Siedler auf ihren verschiedenen Inseln sehr schnell als Bürger ihrer neuen Heimatländer, nicht mehr als Norweger. Diese zweischneidige Situation verleiht den zeitgenössischen Kommentaren zu Grönland in der Historia Norvegiæ und auch Aussagen im Konungsskuggsjá (Königsspiegel) zusätzliche Bedeutung – auf beide wurde bereits im Kapitel »Zu den Quellen« hingewiesen.
Beide Texte verweisen darauf, dass die Gefahr, auf hoher See ins Nichts zu fahren, eines der Hauptrisiken war, die ein Seefahrer in jener Zeit einging. Die Historia Norvegiæ berichtet, wie einige isländische Seeleute auf der Rückreise von Norwegen in dichten Nebel gerieten und so weit vom Kurs abgetrieben wurden, dass sie gar nicht mehr wussten, wo sie sich befanden. Als das Wetter schließlich aufklarte, sahen sie angeblich Land zwischen Grönland und Biarmaland, der nordischen Bezeichnung für die Region des Weißen Meeres, und jenseits davon. Dort, so schworen sie nach ihrer Rückkehr, erblickten sie unglaublich riesige Menschen und sahen junge Mädchen, die angeblich durch das Trinken von Meerwasser schwanger werden konnten. Nach diesen altbekannten »Leckerbissen« aus dem mittelalterlichen Legendenschatz zur Bevölkerung fremder Länder zieht sich der Verfasser der Historia auf zeitgenössische geografische Vorstellungen zurück und erklärt, dass man jenseits jener Wunderländer und von ihnen durch Eisberge getrennt das von Isländern besiedelte Grönland finde. Grönland bilde Europas äußerste Grenze nach Westen, so schreibt der Autor, und erstrecke sich bis hin zu den afrikanischen Inseln, wo der Große Ozean münde. Außerdem, so fügt der Chronist hinzu, lebe weit nördlich der nordischen Siedlungen in Grönland ein Stamm kleiner Menschen, von den Jägern Skraelinger genannt, die ihre Waffen aus Walrosszähnen und scharfen Steinen herstellten, da sie kein Eisen hätten.8 In Kapitel Fünf werden wir uns ausführlich mit diesen Skraelingern befassen.
Nachdem der Vater im Königsspiegel seinen Sohn ermahnt hat, ein aufstrebender Kaufmann müsse auf alle Wechselfälle des Lebens gefasst sein, auf See wie auch in heidnischen Ländern, liefert er eine Beschreibung Irlands, die direkt aus den Schriften des Gerald von Wales (um 1146–1223) stammt. Er lobt das milde Klima der Insel, in dem die Menschen selbst im Winter keine Kleidung brauchen, und behauptet, Irland sei so heilig, dass es dort weder Schlangen noch Kröten gebe. Wer noch weiter hinausfahre, müsse allerdings aufpassen, mahnt der Vater, denn in der See um Grönland gebe es hafger∂ingar (wahrscheinlich Tsunamis) und viele Ungeheuer, darunter die margygr mit schlanken Händen und dem vollbusigen Oberkörper einer Frau, doch mit den langen Haaren und dem Bart eines Mannes. Man habe sie nicht sehr oft gesehen, so der Vater, aber »die Menschen haben etwas über sie zu erzählen, also muss sie jemand gesehen oder zumindest einen Blick auf sie geworfen haben«. Weitaus nützlicher für Händler sei das rostungr (Walross), das im Meer bei Grönland lebe und als eine Art Seehund beschrieben werde, mit zwei großen Stoßzähnen aus Elfenbein im Oberkiefer und mit einer zähen Haut, die in Streifen geschnitten starke Seile liefere. Neben anderen Tierhäuten machten diese Waren Grönland zu einem lohnenden Ziel für einen Händler, der bereit sei, den Gefahren des Nordmeeres zu trotzen, zu denen auch das entsetzliche Eis vor Grönlands Ost- und Nordostküste gehöre. Dem Vater war es dennoch wichtig, seinem Sohn mitzuteilen, dass dieses Land zwar gute Lebensbedingungen für Menschen und Tiere biete, aber nur wenige Menschen dort lebten und noch weniger das Land besuchten. Wer es tat, wollte seine Neugier befriedigen, Ruhm ernten und ein Vermögen im Handel machen, von dem man sich einen guten Gewinn versprechen könne an einem Ort, »der so fern von anderen Ländern liegt, dass die Menschen selten dorthin kommen«.9