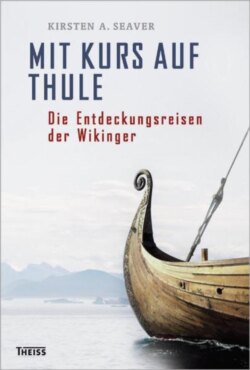Читать книгу Mit Kurs auf Thule - Kirsten A. Seaver - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление[Menü]
Zu den Quellen
Die Geschichte Grönlands im Mittelalter ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Vergangenheit den heutigen Betrachter in die Irre führen kann. Es sind nur ganz vereinzelte Schriftquellen erhalten, die zudem manchmal nicht das sind, was sie zu sein vorgeben – Dokumentenfälschungen, so zeigt sich, sind keine moderne Erfindung. Unter den authentischen Quellen findet sich kein einziges Schriftstück, das tatsächlich aus Grönland stammt, und die anderswo über Vorgänge im nordischen Grönland geschriebenen Primärquellen sind nicht nur rar, sondern oft auch missverständlich. Das liegt vor allem an den vagen geografischen Vorstellungen der Verfasser und beginnt schon mit dem frühesten bekannten Text, in dem Grönland mit Namen genannt wird – einer Bulle Papst Leos IX. vom 6. Januar 1053. Der Papst nennt den Erzbischof Adalbert von Hamburg-Bremen und dessen Nachfolger »episcopus in omnibus gentibus Suenonum seu Danorum, Noruechorum, Islant, Scrideuinnum, Gronlant et uniuersarum septentrionalium …« (mit bischöflicher Autorität über die Schweden, Dänen, Norweger, Isländer, Skridefinners, Grönländer und alle Menschen im Norden).1 Aber selbst vier Jahrhunderte später war das geografische Wissen über den hohen Norden in Rom noch immer nicht besonders gefestigt – das zeigen zwei Papstbriefe mit Bezug auf Grönland, die 1448 und 1492 unter zweifelhaften Umständen (siehe Kapitel Zwölf) geschrieben wurden.
Einem Kanoniker aus Bremen verdanken wir die älteste erhaltene Erwähnung nordischer Aktivitäten in Island, Grönland und Nordamerika wie auch eine ausführliche Beschreibung der Geografie des Nordens, wie man sie sich im 11. Jahrhundert vorstellte. Adam von Bremen, ein Bewunderer Erzbischof Adalberts, schrieb zwischen 1072 und 1085 eine Geschichte der Erzbischöfe von Hamburg-Bremen, in der er vor allem die Leistungen der Bremer Erzbischöfe bei der Christianisierung des hohen Nordens hervorhob. Deshalb verwandte er auch viel Mühe darauf, dem Leser die Geografie dieses Teils der Welt zu veranschaulichen.
Nachdem er sorgfältig die Kugelform der Erde beschrieben hatte, erklärte Adam, dass es im nördlichen Ozean zwei Inseln namens Thule gebe, von denen eine vor Kurzem in Island umbenannt worden sei. Die andere sei eine kaum bekannte Insel irgendwo in der undurchdringlichen und eisigen polaren Dunkelheit, jenseits der Inseln Vínland und Grönland, die kürzlich von den Nordmännern entdeckt worden seien. Adams Vorstellung nach lagen beide Länder im fernen Nordwesten des Atlantiks und damit knapp östlich einer unerforschten eurasischen Ostküste.2 Er schrieb außerdem:
Es gibt noch mehrere andere Inseln im Ozean; eine der größten ist Grönland; es liegt noch tiefer im Ozean, den schwedischen oder ripheischen Bergen gegenüber. Bis zu dieser Insel soll man von der norwegischen Küste aus wie nach Island in 5–7 Tagen segeln. Die Menschen dort sind bleichgrün wie das Meer, wovon das Land seinen Namen hat. Sie leben ähnlich wie die Isländer, nur sind sie rauer und mit ihren Schiffen als Räuber den Seefahrern gefährlich. Auch zu ihnen soll neuerdings das Christentum gelangt sein.
Natürlich wurde die Bekehrung jener rauen Grönländer zum Christentum dem Einfluss der römischen Kirche zugeschrieben.
Die im letzten Satz des Zitates angedeuteten Zweifel am christlichen Bekenntnis der Nordmänner in Grönland säte bei Adam wahrscheinlich sein Freund König Svein Estrithsson von Dänemark, der ihm von Island und Grönland berichtete und auch von »einer weiteren Insel … sie heiße Winland, weil dort wilde Weinstöcke wachsen, die besten Wein bringen. Nicht ausmalenden Vermutungen, sondern zuverlässigen dänischen Berichten entnehme ich auch, dass dort ohne Aussaat reichlich Getreide wächst. Jenseits jener Insel .findet sich kein bewohnbares Land in jenem Ozean, sondern alles, was jenseits liegt, ist voll undurchdringlichem Eis und Finsternis.«3
Die Wirkungsgeschichte von Adams Geschichte der Erzbischöfe von Hamburg-Bremen reicht weit über das Mittelalter hinaus. Ihre Spuren erkennt man noch auf der Vínland-Karte, einer modernen Fälschung aus dem 15. Jahrhundert, die angeblich näherungsweise Vínland, die südlichste der drei nordamerikanischen Regionen verzeichnet, die nordische Entdecker im frühen 11. Jahrhundert erreichten (vgl. hierzu ausführlich das »Postskriptum«). Und auch der isländische Historiker Ari »der Gelehrte« Thorgilsson (1068–1148) zog Adams Werk heran, als er in den 1120er Jahren auf Bitten der Bischöfe von Skálholt und Hólar eine Geschichte des isländischen Volkes schrieb (vgl. hierzu auch das Kapitel Eins). Auszüge aus Aris Schrift tauchen wiederum in zwei anderen frühen isländischen Beschreibungen der nordischen Besiedlung Grönlands und der ersten Zusammenstöße mit den nordamerikanischen Ureinwohnern auf – in der »Saga von Eirik dem Roten« und der »Saga von den Grönländern«. Diese beiden Texte ermöglichen es uns heute, die Entdeckung Nordamerikas in ihren Grundzügen nachzeichnen zu können – beide zusammen werden auch oft als die Vínland-Sagas bezeichnet (vgl. hierzu die folgenden Kapitel).
Daneben gewähren uns auch weitere Sagas kurze Blicke auf das Leben in Grönland. In Island findet man zudem eine Serie von chronologisch geordneten Annalen, die von verschiedenen Kompilatoren seit dem Ende des 13. Jahrhunderts verfasst wurden und sich sowohl ausländischer wie einheimischer Quellen bedienen. Sie sind ein so unschätzbar wertvolles Hilfsmittel der historischen Forschung, dass der norwegische Historiker Gustav Storm sie 1888 gesammelt als Islandske Annaler (Isländische Annalen) herausgab. Der Titel sollte allerdings nicht verwechselt werden mit den Grænlands annáll (Grönland-Annalen), einer Sammlung bunt gemischter Informationen über Grönland, die erstmals um 1623 von einem Anonymus zusammengestellt wurden. Der isländische Autodidakt Björn Jónsson aus Skar∂sá (1574–1655) schrieb zwei Jahrzehnte später ausführlich aus dieser Sammlung ab und fügte eigene Betrachtungen hinzu, die heute teils seltsam anmuten mögen, aber faszinierende Einblicke in die zeitgenössische Vorstellungswelt bieten. Die Islandske Annaler und die Grænlands annáll zusammen mit den Annálar 1400–1800 (oft die Neuen Annalen genannt) sind grundlegende Quellen für die Geschichte der mittelalterlichen Nordmänner im Nordatlantik, ebenso wie das Diplomatarium Islandicum, das Diplomatarium Norvegicum und andere Dokumentensammlungen, die im Laufe der Jahre herausgegeben worden sind.
Von norwegischen Autoren stammen zwei weitere wichtige Quellen: die Historia Norvegiæ (nur teilweise erhalten), geschrieben um 1170 n. Chr. von einem unbekannten norwegischen Geistlichen, und das norwegische Werk Konungsskuggsjá (Königsspiegel) aus der Mitte des 13. Jahrhunderts, dessen Verfasser ebenfalls unbekannt ist. Letzteres ist in Form eines Dialogs zwischen einem Vater und seinem Sohn geschrieben und zeugt von einer gewissen Vertrautheit sowohl mit dem norwegischen Königshof wie auch mit dem Alltagsleben der norwegischen Bevölkerung. Der anonyme Autor war außerdem gut bewandert im theologischen und weltlichen Wissen seiner Zeit und webte gelehrte Gemeinplätze in die praktischen Ratschläge, die der Vater seinem Sohn erteilte. Weder die Historia Norvegiæ noch der Konungsskuggsjá erwähnen Vínland, doch gehen beide davon aus, dass Grönland zu einer arktischen Landmasse gehörte, die mit dem äußersten Westen wie auch mit dem äußersten Osten Eurasiens verbunden war – dem einzigen Kontinent, den man außer Afrika damals kannte. In anderer Hinsicht teilen die beiden Werke viele Vorstellungen Adams von Bremen und zeigen eine ähnliche Mischung aus Fakten und konventionellem mittelalterlichen Sagengut und Aberglauben über den hohen Norden. Was konnte zum Beispiel die vielen Gefahren, mit denen Reisende in der Arktis zu Lande und zu Wasser rechnen mussten, besser erklären als das Wirken übernatürlicher Kräfte?
Mit der Veröffentlichung der Antiquitates Americanae von Carl Christian Rafn und Finn Magnusen 1837 in Kopenhagen bekam die lesende Öffentlichkeit ein größeres Quellenkompendium an die Hand. Geschrieben auf Isländisch mit lateinischen und dänischen Übersetzungen, stellte es Quellen zusammen, die nach Meinung der Autoren beim Verständnis der mittelalterlichen nordischen »Aktivitäten« in Grönland und Nordamerika helfen würden. Enthalten war auch eine englische Zusammenfassung, die den potenziellen Leserkreis enorm erweiterte. Kapitel Eins wie auch das »Postskriptum« werden allerdings zeigen, dass das unkritische Vertrauen in dieses Buch zu einigen hartnäckigen Problemen bei der Erforschung der nordischen Grönländer geführt hat.
Die professionelle Archäologie steckte noch in den Kinderschuhen, als Rafn und Magnusen die Schriftquellen zutage förderten, die in Kopenhagen verfügbar waren. Sie schufen nicht nur die Antiquitates, sondern auch das dreibändige Werk Grønlands Historiske Mindesmærker (Historische Monumente Grönlands), eine beeindruckende Arbeit, die in den Jahren 1838 bis 1845 erschien. Obwohl viele Kommentare zwangsläufig heute durch die neuere Forschung überholt sind, ist und bleibt sie immer noch nützlich.
Bis heute hält sich bei Einigen hartnäckig die Meinung, die Archive des Vatikan seien eine Fundgrube wichtiger und genauer Informationen über die mittelalterlichen Nordmänner im Allgemeinen und über die Grönländer im Besonderen – so war es auch beim norwegischen Abenteurer und Autor Thor Heyerdahl (1914–2002). All diese Dokumente seien einfach nur noch nicht entdeckt worden, so die Argumentation. Tatsächlich aber haben im 19. und frühen 20. Jahrhundert Historiker, die sich auf die Spuren der nordischen Grönländer begaben, mit großem Eifer auch die im Vatikan verwahrten Schriftstücke gesichtet und sofort veröffentlicht, was sie fanden. Es stellte sich heraus, dass der Papst und die Kurie im Mittelalter eine ebenso verworrene Vorstellung vom Norden hatten wie alle anderen Südeuropäer auch. Den Erforschern der nordischen Geschichte, die als erste Schlüsseldokumente in Archiven von Island bis Rom entzifferten und sie gedruckt allen zur Verfügung stellten, manchmal mit Kommentaren und manchmal ohne, gebührt unser aller Dank.