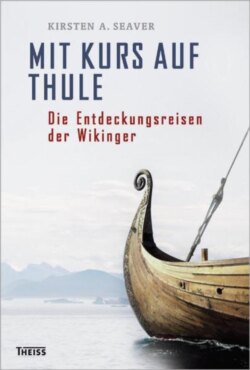Читать книгу Mit Kurs auf Thule - Kirsten A. Seaver - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wie navigierten die Nordmänner?
ОглавлениеEirik hatte die gesamte Strecke von Snæfellsness (Schneeberghalbinsel) im äußersten Westen Islands her immer geraden Kurs gehalten. Der große Gletscher, dem die Halbinsel ihren Namen verdankte, galt den nordischen Seeleuten als zuverlässige Landmarke, und Eirik wusste höchstwahrscheinlich, dass die Halbinsel auch auf einer guten Breite lag, um sich von dort aus Grönland zu nähern. Die nordischen Seeleute waren Fachleute im Breitensegeln und konnten auf einen reichen Wissensschatz über Küsten, Strömungen und Wanderungen von Vögeln, Fischen und Säugetieren zurückgreifen. Sie kannten die Bewegungen der Himmelskörper und navigierten nach dem Polarstern, wenn der Himmel dunkel genug war, um Kontrast zu bieten. In den Sommermonaten, wenn man selbst den Polarstern vor dem hellen Himmel im hohen Norden kaum sah, beobachteten sie den Lauf der Sonne am Firmament. Wie andere zuvor konnten sie die Tageszeit wie auch die Richtung in vertrauten Breiten vom Stand der Sonne am Himmel ablesen.
Die Kunst, die Zeit nach dem Sonnenstand zu bestimmen, ist eng mit der Aufteilung des Horizonts in Kompasspunkte verbunden. Dieses verbundene Wissen ist die Grundlage für die Herstellung einer Sonnenuhr oder auch einer einfachen Peilscheibe zur Navigation. Bei beiden Gerätschaften wird auf einer Scheibe der Schatten markiert, den ein lotrechter Stock (gnomon) während des Laufs der Sonne wirft, und zwar an dem Breitengrad und zu der Jahreszeit, zu der die Scheibe gebraucht werden soll. Das Prinzip kannte schon Novius Facundus, als er zwischen 13 und 9 v. Chr. das Horologium des Augustus in Rom baute, und es wäre nun wirklich überraschend, wenn die Wikinger und die nordischen Händler auf ihren Reisen in Mittelmeerländer oder auch nach England, wo um das Jahr 1000 in Canterbury eine Sonnenuhr in Gebrauch war, diese Zeitmesser nicht wahrgenommen hätten. Ebenso überraschend wäre es, wenn die Seefahrer aus dem hohen Norden es nicht geschafft hätten, mithilfe der Schattenkurve des gnomon auf See einen Kurs entlang eines bestimmten Breitengrades zu finden und zu halten.
Der englische Wissenschaftler Peter G. Foote ging als erster davon aus, dass das altnordische Wort sólarsteinn (Sonnenstein) sich auf ein Navigationsgerät bezog, das sich die Brechung des Sonnenlichts in einem Stück kristallinen Kalkstein zunutze machte.9
Das war eine geniale Idee, doch die literarischen Belege wie die materiellen Funde weisen in eine andere Richtung. Zum einen verwendeten isländische Texte das Wort sólarsteinn bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts hinein, als mechanische Uhren und Magnetkompasse im Norden in Gebrauch kamen, gleichermaßen für Zeitmess- wie für Navigationsgeräte, und Kircheninventare am Bischofssitz Hólar und in Hrafnagil bezeichnen einen gefassten Sonnenstein zur Zeitangabe als »sólarsteirn« (sic), während sie mit »kluckur« Kirchenglocken von Sonnenuhren unterscheiden.10 Vor allem aber war eine Peilscheibe mit gnomon und Ritzungen, aus Holz oder aus Stein gefertigt, so leicht zu benutzen und so billig herzustellen, dass ein nordischer Seemann des Mittelalters wenig Anreiz gehabt hätte, in einen magnetischen Kompass zu investieren, auch wenn diese weiter südlich in Gebrauch waren. Bezeichnenderweise schrieb der venezianische Mönch Fra Mauro auf seiner Weltkarte um 1450, dass die Segler auf der Ostsee »ohne Seekarte oder Kompass« navigieren, »sondern nur mit Blei und Leine«, und Olaus Magnus, der letzte katholische Erzbischof von Schweden, beschrieb noch im frühen 16. Jahrhundert Fischer in Nordnorwegen, die sich auf einen einfachen Sonnenkompass oder eine Peilscheibe verließen, um nach Hause zurückzufinden.11
Als der dänische Archäologe C. L. Vebæk 1948 die Reste eines Bauernhauses der Ostsiedlung in Uunartoq ausgrub, fand er die übrig gebliebene Hälfte einer Peilscheibe oder ein Modell zur Herstellung solcher Scheiben in einer Kulturschicht, die auf die nordische Siedlungszeit zurückging. Nachdem ein vollständiger Prototyp auf der Basis der alten Halbscheibe hergestellt worden war, testeten erfahrene moderne Segler – darunter der englische Seemann Sir Robin Knox-Johnston – das Gerät erfolgreich bei der Meeresnavigation. In jüngerer Zeit tauchte eine kleine Scheibe, für die man einen ähnlichen Einsatz bei der Navigation annimmt, in Qorlortoq in der Ostsiedlung auf. Man kann also annehmen, dass Eirik der Rote und seine Gefährten einen solchen einfachen Sonnenkompass benutzten. Mit seiner Hilfe konnten sie ihren Weg zu den »Gunnbjarnarsker« und darüber hinaus finden und nach Hause zurückkehren. Sie selbst und andere konnten ihren Weg nach Grönland so nachverfolgen.12
Die Lokalisierung von Grönland war allerdings nur eine Schwierigkeit unter vielen, denen sich jene nordischen Pioniere wohl gegenübersahen. Der Zugang zum Land war eine andere. Zu den Hindernissen, die sich vor ihnen auftürmten, zählte der beeindruckende Treibeisgürtel, der bis heute Reisende, die sich Grönlands Ostküste nähern, einschüchtert. Eirik beschloss klugerweise, sich seinen Weg nicht durch diesen Gürtel zu bahnen. Er verspürte wohl kaum den Wunsch, an dieser trostlosen Ostküste an Land zu gehen, an der etwa vier Jahre zuvor Snæbjörn galti Holmsteinsson, ein Verwandter seiner Frau, von aufgebrachten Schiffsgefährten getötet worden war. Snæbjörns düsteres Schicksal wurde sogar zur ersten in einer Reihe von nordischen Geschichten, die die abschreckende Natur der grönländischen Ostküste illustrierten, wo schiffbrüchige Seeleute erfroren oder verhungerten, bevor ihnen irgendjemand zu Hilfe kommen konnte. Der Isländer Thorgils Thordsson überlebte allerdings einen solchen Schiffbruch nach einer entsetzlichen (und irgendwie verdächtigen) Geschichte in der Flóamannasaga. Thorgils hatte seine Heimat kurz vor dem Jahre 1000 n. Chr. mit Kurs auf Grönland verlassen, als er in einen Sturm geriet und sich schließlich mit seinen Schiffskameraden gestrandet an Grönlands Ostküste wiederfand. Vier furchtbare Winter später schafften es die Überlebenden angeblich, ein Boot aus Häuten zusammenzunähen, und segelten zur Westküste Grönlands, wo inzwischen Eirik der Rote lebte.13
Auf seiner eigenen ersten Reise hinaus nach Grönland gelangte Eirik sicher an Kap Farvel vorbei und begann die Fjorde zu erkunden, die zwischen 60° und etwa 61° 30’ nördlicher Breite tief in die Südwestküste einschnitten – ein Gebiet, das bald als Ostsiedlung bekannt werden sollte. Hier, gerade noch weit genug südlich von Island, um ein paar zusätzliche Stunden Winterlicht zu genießen, ohne die »weißen« Sommernächte zu verlieren, die die Menschen im Norden so lieben, beanspruchte Eirik Land auf der Westseite des daraufhin so genannten Eiriksfjord (heute: Tunulliarfik). Die moderne Archäologie kann die Berichte der Sagas belegen, denen zufolge Eirik nach der Überwinterung das Land in Richtung Norden erkundete und bis zur Region um das heutige Nuuk und in die inneren Fjordbezirke vordrang, an denen bald die Westsiedlung entstand. Am geschützten Ende des langen Ameralik-Fjordes, den die Nordmänner Lysufjör∂r (Lebertran-Fjord) tauften, steckte Eirik weiteres Land für sich und seine Familie ab, höchstwahrscheinlich in Sandness, der besten und strategisch sichersten Lage für einen Bauernhof in diesem Gebiet. Nicht lange danach spielte Sandness auch eine Schlüsselrolle in den ersten nordischen Ausfahrten nach Nordamerika, die von Eirik dem Roten und seinem Kreis streng kontrolliert wurden.
In beiden Regionen Grönlands, die Eirik vor mehr als einem Jahrtausend erkundete, gibt es an den Enden der Fjorde noch heute üppig grüne Gebiete, die einen krassen Gegensatz zu den Gletschern und den massiven Granitgraten im Binnenland wie auch zum blankgewaschenen Granit der äußeren Küsten bilden. Die Gewässer, die Eirik und seine Gefährten durchfuhren, wimmelten von Fischen, Robben und Walen; auch die Binnenseen waren voller Fisch; im Hinterland beider Regionen gab es Rentiere und kleineres Jagdwild; eine Unmenge von Vögeln versprach Eier, Fleisch, Federn und Daunen. Die natürlichen Ressourcen der beiden potenziellen Siedlungsgebiete unterschieden sich dennoch in einigen Punkten, und diese Unterschiede bezog Eirik auch eindeutig in seine frühen Siedlungspläne mit ein.
In der Westsiedlung, etwa fünfhundert Kilometer nördlich der Ostsiedlung gelegen, waren die Winter härter. Sie hatte weniger Weideland als die Hauptkolonie weiter im Süden, lag aber wesentlich günstiger für einen frühen Beginn jener hocharktischen Jagdexpeditionen, die bald zu einem wesentlichen Teil der Ressourcenausnutzung der nordischen Grönländer werden sollten. Auf diesen arktischen Beutezügen trafen die nordischen Siedler auch zum ersten Mal auf arktische Ureinwohner, zunächst auf Menschen der Dorset-Kultur und dann auf Thule-Eskimos, die Vorfahren der heutigen Inuit. Weiter im Süden, wo die Nordmänner siedelten, stießen weder Eiriks Aufklärungstrupp noch die frühen Siedler auf Einheimische. Sie fanden nur verstreute Reste einer früheren menschlichen Besiedlung, wie Ari in seinem kurzen Bericht festhält. Auf Island, wo den Nordmännern offenbar nur ein paar irische Mönche zuvorgekommen waren, war die Kolonisation ebenso problemlos und ohne Begegnung mit feindlichen Ureinwohnern vonstattengegangen.14