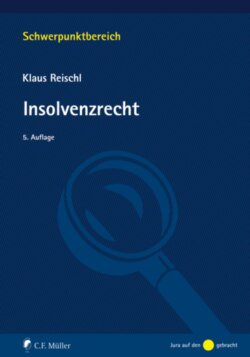Читать книгу Insolvenzrecht - Klaus Reischl - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Die insolvenzrechtliche Haftungsordnung
Оглавление7
Die Beschlagnahmewirkung der Insolvenzeröffnung (§ 80 InsO) realisiert den haftungsrechtlichen Charakter des Insolvenzrechts, das dem Schuldner die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über seine Vermögenswerte zwangsweise entzieht und sie dem Insolvenzverwalter zuweist, der sie nunmehr für die Gläubigergemeinschaft ausübt. Zum Zwecke der bestmöglichen Gläubigerbefriedigung begründen die Vorschriften der Insolvenzordnung eine spezifische insolvenzrechtliche Haftungsordnung. Diese weicht mitunter von den materiell-rechtlichen Vorgaben des BGB ab, was zur Verdrängung schuldrechtlicher und dinglicher Rechtspositionen führen kann.
8
Gesetz und Rechtsprechung lassen sich dabei von der Erkenntnis leiten, dass man zur haftungsrechtlichen Erfassung der Insolvenzsituation die Rechtsbeziehungen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachten muss. Eine ebenso charakteristische wie lehrreiche Ausprägung der insolvenzspezifischen Vermögenszuordnung ist die in §§ 47, 51 Nr 1 InsO getroffene Unterscheidung von Eigentumsvorbehalt auf der einen und Sicherungseigentum auf der anderen Seite. Während der Vorbehaltseigentümer seine Sache vom Insolvenzverwalter in natura herausverlangen darf (§ 47 InsO), vermitteln die in § 51 Nr 1 InsO aufgezählten Sicherungsrechte, vor allem Sicherungsübereignung und Sicherungszession, lediglich sog. Absonderungsrechte am Erlös (vgl Rn 406 ff); die Einzelzwangsvollstreckung könnte der Sicherungsnehmer gemäß § 771 ZPO verhindern.
9
Die unterschiedliche Behandlung im Insolvenzverfahren beruht auf der geringeren Schutzwürdigkeit des Geldkreditgebers (Sicherungseigentümer, -zessionar, § 51 Nr 1 InsO) gegenüber dem Warenkreditgeber (Vorbehaltsverkäufer, § 47 InsO); während der Letztere die Sache aus der Hand gegeben und wenig andere Sicherungsmöglichkeiten hat als sich die Rückholung vorzubehalten, hat der Erstere ein breiteres Spektrum an Kreditsicherheiten[6]. Diese wirtschaftlich geprägte Differenzierung führt beispielsweise dazu, dass ursprüngliches Vorbehaltseigentum (§ 47 InsO) durch Übertragung an einen Geldkreditgeber seine Aussonderungskraft verliert und bei Letzterem zum bloßen Absonderungsrecht herabsinkt[7].
10
Eine weitere haftungsrechtliche Besonderheit stellt die insolvenzrechtliche Anfechtung (§§ 129 ff InsO) dar, die in der InsO eine gewichtige Ausprägung erhalten hat. Dieses Rechtsinstitut soll dem Umstand Rechnung tragen, dass die materielle Zugehörigkeit zur Insolvenzmasse nicht erst durch die Verfahrenseröffnung, sondern bereits durch den wirtschaftlichen Krisenbeginn begründet wird; vertypisiert wird diese Situation durch die Erfüllung der einzelnen Anfechtungstatbestände (§§ 130 ff InsO; vgl dazu Rn 571). Zwischenzeitlich erfolgte Vermögensbewegungen sind danach unbeschadet ihrer materiell-rechtlichen Wirksamkeit rückgängig zu machen (vgl § 143 Abs. 1 S. 1 InsO).
11
Das wirtschaftliche Ergebnis für die Insolvenzmasse prägt nicht nur die Vermögenszuordnung, sondern ist sogar als Richtschnur für die Auslegung insolvenzrechtlicher Vorschriften anzusehen. So steht etwa der Schutz einer aus der Masse erbrachten Gegenleistung (vgl Rn 514) sowohl bei der Beurteilung des Zeitpunktes des Ausscheidens von Vermögenswerten aus dem Schuldnervermögen (§ 91 InsO; vglRn 320 ff), als auch bei der Anfechtung der Herstellung einer Aufrechnungslage (vgl Rn 601) sowie der Werthaltigmachung einer abgetretenen Forderung (vgl Rn 602) jeweils im Vordergrund.
12
Bei der Befassung mit dem Insolvenzrecht ist also zu beachten, dass wirtschaftliche Erwägungen (anders im BGB) relevante Zuordnungs- und Abgrenzungskriterien darstellen können. Man muss im Insolvenzrecht immer damit rechnen, dass zivilrechtliche Rechtspositionen dort anders bewertet werden als im materiellen Recht.
§ 1 Einführung in das Insolvenzrecht › I. Das Insolvenzverfahren › 4. Insolvenzrecht als Querschnittsmaterie