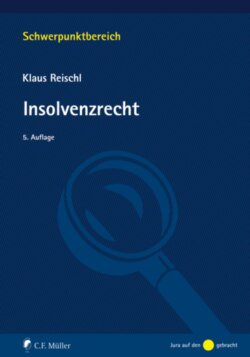Читать книгу Insolvenzrecht - Klaus Reischl - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III. Chronologischer Ablauf eines Insolvenzverfahrens
Оглавление29
[Bild vergrößern]
30
Die InsO unterscheidet zwischen dem (Regel-)Insolvenzverfahren und dem Insolvenzplanverfahren, wobei beide von einem Insolvenzverwalter abzuwickeln sind. Während das Regelverfahren streng nach den verfahrens- und materiell-rechtlichen Vorgaben der InsO durchgeführt werden muss, haben die Gläubiger im Insolvenzplanverfahren bei der Gestaltung der Abwicklung weitgehende Vertragsfreiheit (vgl § 217 S. 1 InsO). Als Alternative zu diesen beiden Abwicklungsformen steht das Verfahren der Eigenverwaltung zur Verfügung, in dem der Schuldner sich selbst verwaltet. Anstelle des Insolvenzverwalters ist daher ein Sachwalter vorgesehen, der den Schuldner bei der eigenen Verwaltung zu überwachen hat (vgl § 270 Abs. 1 S. 1 Hs. 1 InsO).
31
[Bild vergrößern]
32
Das Regelverfahren ist in mehrere Abschnitte unterteilt. Das Insolvenzeröffnungsverfahren (einschließlich des vorläufigen Insolvenzverfahrens und der vorläufigen Eigenverwaltung) wird durch eine entsprechende Antragstellung (§§ 13 f InsO) in Gang gesetzt und begründet für den Schuldner über die Auskunftspflicht hinausgehende Rechtsfolgen nur bei besonderer Anordnung durch das Gericht (§§ 21 ff InsO). Das (endgültige) Insolvenzverfahren wird sodann nicht automatisch eröffnet, sondern das zuständige Insolvenzgericht (§ 2 InsO) prüft vorher von Amts wegen (§ 5 Abs. 1 InsO) die Zulässigkeit (§§ 13, 14 Abs. 1 InsO) und Begründetheit (§ 16 InsO) des Antrags sowie die Deckung der Verfahrenskosten (§ 26 InsO). Vom Antragseingang bis zur Eröffnungsentscheidung können durchaus mehrere Monate vergehen, wenn die Ermittlungen aufwändig, die Verhältnisse undurchsichtig oder Unternehmen fortzuführen sind. Im Vorfeld der Verfahrenseröffnung kann auch ein sog. Schutzschirmverfahren (§ 270b InsO) beantragt und durchgeführt werden, das die Ausarbeitung eines Insolvenzplanes durch den Schuldner zum Ziel hat, der binnen drei Monaten beim Insolvenzgericht vorgelegt werden muss.
Im eröffneten Insolvenzverfahren wird ein Insolvenzverwalter bestellt (und ggf. ein Gläubigerausschuss eingesetzt), die Forderungen der Gläubiger können „zur Tabelle“ angemeldet, werden geprüft und eingetragen (§§ 174 ff InsO), ferner wird das Vermögen des Schuldners vom Insolvenzverwalter nach Weisung durch die Gläubiger verwertet (§ 159 InsO) und gemäß dem auf der Grundlage der Tabellenergebnisse aufzustellenden Schlussverzeichnis quotal verteilt (§§ 187 ff InsO). Abschließend wird das Verfahren aufgehoben (§ 200 InsO) und es tritt die Nachhaftungsphase ein, in der die Gläubiger ihre Tabellenforderungen (abzüglich der erhaltenen Quoten) wieder gegen den Schuldner vollstrecken können (§ 201 Abs. 1 InsO).
33
Ist der Insolvenzschuldner eine natürliche Person, kann sich jedoch ein Restschuldbefreiungsverfahren anschließen, §§ 287 ff InsO. Wenn der Schuldner die Restschuldbefreiung beantragt, sich ab Verfahrenseröffnung redlich um Arbeit bemüht, seine pfändbaren Bezüge an den Insolvenzverwalter bzw Treuhänder abführt und auch seine sonstigen Obliegenheiten (§ 295 InsO) nicht verletzt, erlangt er trotz Aufhebung des Insolvenzverfahrens die sog. Restschuldbefreiung. Bei voller eigener Kostentragung beträgt der Zeitraum hierfür ab Insolvenzeröffnung fünf Jahre; kann aus der Masse zudem eine 35%-ige Quote ausgeschüttet werden, reduziert sich dieser Zeitraum auf drei Jahre (§ 300 Abs. 1 InsO). Die Erteilung der Restschuldbefreiung sperrt dauerhaft und umfassend die Durchsetzbarkeit aller Restforderungen gegenüber allen Insolvenzgläubigern. Insbesondere gilt dies auch für Gläubiger, die nicht am Verfahren teilgenommen haben (vgl § 301 Abs. 1 S. 2 InsO), vorbehaltlich etwaiger Schadensersatzansprüche wegen Verschweigens von Gläubigern (s Rn 808).
34
Alternativ zu diesem Ablauf steht das Insolvenzplanverfahren offen (§§ 217 ff InsO; dazu Rn 812 ff), das eine vom gesetzlichen Regelverfahren abweichende Verfahrensgestaltung ermöglicht. Damit können zum Beispiel variierende Quoten, Teilverzichte oder längerfristige Ratenzahlungen vereinbart werden, die mittels Sanierung und Weiterführung des schuldnerischen Unternehmens zu erwirtschaften sind. Erklärtes Ziel des ESUG war es, das Insolvenzplanverfahren attraktiver zu machen, indem zum Beispiel lästige Behinderungen durch obstruierende Kleingläubiger erschwert (§ 251 InsO) oder die sog. „Debt-Equity-Swaps“ (also die Umwandlung von Forderungen in Unternehmensanteile, § 225a InsO) erleichtert werden. Ein ebenso instruktiver wie lehrreicher Sachverhalt aus dem Spannungsfeld zwischen Gesellschaftsrecht und Insolvenzrecht ist der sog. „Suhrkamp-Fall“, der über Jahre hinweg die deutschen Gerichte sowie die einschlägige Literatur beschäftigt hat[18].
§ 1 Einführung in das Insolvenzrecht › IV. Die Verfahrensprinzipien