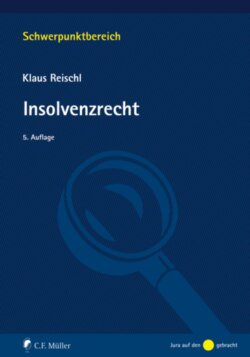Читать книгу Insolvenzrecht - Klaus Reischl - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Insolvenzrecht als Querschnittsmaterie
Оглавление13
Während das Insolvenzverfahrensrecht fast ausnahmslos in der Insolvenzordnung geregelt und der streitigen Gerichtsbarkeit zuzuordnen ist[8] (vgl § 4 InsO), wird das materielle Insolvenzrecht hingegen aus der Summe aller Rechtssätze gebildet, mit deren Hilfe beim wirtschaftlichen Zusammenbruch des Schuldners subjektive Rechte zu Gunsten der Verfahrensziele durch Auslösung besonderer Rechtsfolgen realisiert werden[9]. Als Beispiele hierfür sind insbesondere die Abwicklung gegenseitiger Verträge (vgl § 103 InsO), das Insolvenzanfechtungsrecht (vgl §§ 129 ff InsO) und die Wirkungen von Insolvenzplänen (vgl § 254 InsO) zu nennen.
14
Dabei ist zu beachten, dass das Insolvenzrecht Tatbestände mit Doppelwirkung kennt[10]. Zum Beispiel enthalten die Frage der Massezugehörigkeit, die Rechte und Haftung des Insolvenzverwalters, die Aufrechnung, die Anfechtbarkeit oder die Unwirksamkeit von Rechtshandlungen sowohl verfahrensrechtliche wie materiell-rechtliche Aspekte. Das führt im nationalen Recht zu Überschneidungen zwischen Verfahrensrecht und materiellem Recht, im Internationalen Insolvenzrecht zwischen Verfahrensrecht und Kollisionsrecht (vgl Rn 913).
15
Das Insolvenzrecht ist also nicht nur als eigenes Verfahrens- und Haftungsrecht zu verstehen, denn es gibt zahlreiche Wechselwirkungen und Bezüge zu anderen Rechtsgebieten. Beispielsweise gibt es insolvenzspezifische Vorschriften im Sozialrecht oder im Strafrecht (§§ 283 ff StGB). Ferner entstehen bei Unternehmensinsolvenzen rechtliche Verflechtungen mit dem Steuerrecht, dem Arbeitsrecht, dem Bankrecht sowie dem Gesellschaftsrecht. Die im Jahre 2008 durch das MoMiG vorgenommene Deregulierung des sog. Eigenkapitalersatzrechts ist ein Beleg dafür, denn die Gesellschafterdarlehen (vgl §§ 39 Abs. 1 Nr 5, 44a, 135 InsO) wurden gemeinsam mit den Insolvenzantragspflichten (§ 15a InsO) nunmehr im Insolvenzrecht verortet. Um ein vollständiges Bild vom Insolvenzrecht zu gewinnen, genügt demnach der Blick in die InsO nicht, vielmehr muss man die involvierten Rechtsgebiete gemeinsam betrachten; das Insolvenzrecht erweist sich somit als Querschnittsmaterie.
16
Für die sachgerechte Bearbeitung von Insolvenzverfahren sind also fundierte Kenntnisse in allen diesen Rechtsgebieten sowie der Buchführung und Bilanzierung erforderlich. Auf Seiten der Insolvenzverwalter wird diesen Anforderungen Rechnung getragen, indem in der Regel nur solche Personen als geeignet und geschäftskundig im Sinne von § 56 InsO angesehen werden, die eine erfolgreiche Fachanwaltsausbildung (vgl § 14 FAO) nachgewiesen haben. Um die Justiz „auf Augenhöhe“ zu halten, hat der Gesetzgeber in § 22 Abs. 6 GVG einschlägige Qualitätsanforderungen vorgeschrieben, die auch von Insolvenzrichtern „belegbare Kenntnisse“ in den genannten Bezugsdisziplinen abverlangen. Trotz Kritik seitens des Bundesrates, der darin einen Bruch mit dem in § 5 Abs. 1 DRiG normierten Ausbildungsprinzip des Einheitsjuristen sieht (vgl BT-Ds 17/5712, S. 98 ff), hat die Bundesregierung hieran festgehalten, nicht zuletzt weil Kenntnisse im Steuerrecht und Rechnungswesen in der juristischen Ausbildung meistens nicht vermittelt werden (vgl BT-Ds 17/5712, S. 121 f).
§ 1 Einführung in das Insolvenzrecht › I. Das Insolvenzverfahren › 5. Die Insolvenzrechtsreformen