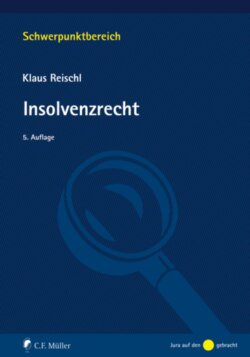Читать книгу Insolvenzrecht - Klaus Reischl - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
c) Fortbestehende Privilegien
Оглавление40
Der Gleichbehandlungsgrundsatz ist in der Insolvenzordnung jedoch nicht als unterschiedsloses Verteilungskriterium ausgestaltet worden, denn wie immer gebieten verschiedenartige Interessen entsprechende Differenzierungen, die im Ergebnis für Einzelne privilegierend wirken. So genießen zum Beispiel die Arbeitnehmer vertraglichen Bestands- und Forderungsschutz (§§ 108, 55 Abs. 1 Nr 2 Var. 2 InsO), ihre Arbeitsverhältnisse und Lohnansprüche bleiben also von der Insolvenzeröffnung zunächst einmal unberührt, insbesondere ist die Betriebsstilllegung in der Insolvenz kein außerordentlicher Kündigungsgrund (vgl Rn 551).
Freilich wird sie der Insolvenzverwalter in massearmen Verfahren sofort von der Arbeitspflicht freistellen, so dass sie in der Befriedigungsrangordnung des § 209 InsO hinter die Verfahrenskosten und Neumasseverbindlichkeiten fallen (vgl Rn 776) und erst einmal auf Arbeitslosengeld angewiesen sind. Im eröffneten Verfahren hat der Insolvenzverwalter die Kündigungserleichterung nach § 113 InsO. Im Falle der Sanierung durch Übertragung auf einen anderen Rechtsträger gibt es ebenfalls diverse Möglichkeiten zum Abbau von Arbeitsplätzen (vgl Rn 552). Derartige Erleichterungen sind erforderlich, weil die Sanierung eines Unternehmens nur gelingen kann, wenn die strategischen Fehler der bisherigen Unternehmensführung schnell und kostenschonend korrigiert werden können; zu den Krisenauslösern gehört vor allem das zu lange Festhalten an unrentablen Unternehmensbereichen und damit an unproduktiven Arbeitnehmern.
41
Die Restitution der staatlichen Privilegien ist seit deren (wohldurchdachten und ausführlich begründeten) Abschaffung durch die Einführung der InsO erklärtes und wiederholtes Ziel fiskalischer Begierden[22]. Seit jeher fühlen sich vor allem die Sozialversicherungsträger als über Gebühr in Anspruch genommene Anfechtungsgegner. Richtig daran ist, dass diese sehr häufig erhebliche Beträge an die Insolvenzmasse erstatten müssen. Es ist aber zu bedenken, dass für die Sozialversicherungsträger die sich beim Schuldner abzeichnende Finanzkrise frühzeitiger als für Privatgläubiger erkennbar ist. Und solange beim Schuldner noch Geld vorhanden ist, können die Sozialversicherungsbehörden dieses mittels selbst ausgestellter Titel und eigener Vollstreckungsbeamten schneller abgreifen als private Gläubiger. Wer in der Krise schneller ist als andere, muss zwangsläufig nach Insolvenzeröffnung mehr zurückerstatten als die anderen Gläubiger, zumal es sich hier um ungerechtfertigte Sondervorteile handelt, denn der Regelgläubiger kann seine Forderungen nicht selbst titulieren. Gleichwohl ist es den Sozialversicherungsträgern gelungen, über eine Hintertüre im Jahre 2007 (nach einem bereits gescheiterten Versuch in 2006) mit § 28e Abs. 1 S. 2 SGB IV eine vermeintliche Anfechtungssperre bezüglich der Arbeitnehmeranteile ins Gesetz zu bringen. Demnach sollten die vom Arbeitgeber direkt abzuführenden Anteile der Arbeitnehmer an den Sozialversicherungsbeiträgen der späteren Anfechtung dadurch entzogen werden, dass sie als aus dem Vermögen des Arbeitnehmers erbracht gelten. Der Bundesgerichtshof hat jedoch diesen (fehlgeschlagenen) Versuch zur Umsetzung des „verschleierten Ziels des Schutzes vor Beitragsrückgewähr in der Insolvenz von Arbeitgebern“[23] entlarvt: „Ergibt sich demnach aus einer gesetzlichen Fiktion nicht die Rechtsfolge, auf die es der Gesetzgeber abgesehen hat, so kann der Richter ihn vor seinem Rechtsirrtum nicht schützen“[24]. Diese Episode zeigt, dass man das ausgewogene Anfechtungssystem nicht durch Sonderprivilegien stören sollte, schon gar nicht durch übereilte und ohne Sorgfalt ausgearbeitete Regelungen.
Ein weiterer (fiskalisch bedingter) offener Bruch mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz ist in § 55 Abs. 4 InsO enthalten, der eine Aufwertung von Steueransprüchen zu Masseansprüchen bei Geschäften vorsieht, die während der Einsetzung eines vorläufigen Insolvenzverwalters mit Zustimmungsvorbehalt getätigt werden. Damit soll verhindert werden, dass im Insolvenzeröffnungsverfahren weitere Steuerrückstände als Insolvenzforderungen (§ 38 InsO) entstehen, die später nur quotal befriedigt werden. Dabei ist zwar zu bedenken, dass sich der Fiskus (anders als private Gläubiger) als Zwangsgläubiger seine Kunden nicht aussuchen kann und die finanziellen Folgen ihrer Ausfälle auf die Allgemeinheit abgewälzt werden müssen[25]; aber der verfassungsrechtlich adäquate Weg hierfür ist eine allgemeine Steuererhöhung. Die Umschichtung von im Eröffnungsverfahren vereinnahmten Umsatzsteuern zu Insolvenzmasse ist gerade im Hinblick darauf gerechtfertigt, dass Insolvenzverfahren nicht nur den betroffenen Gläubigern dienen, sondern einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Volkswirtschaft leisten (vgl Rn 6), der Staat steht daher in der Finanzierungsverantwortung. Die Nichtabführung von vereinnahmten Umsatzsteuern im Insolvenzeröffnungsverfahren hatte sich dabei als wichtiger Kalkulationsfaktor der insolvenzrechtlichen Betriebsfortführung etabliert, dessen Wegfall die weitere Unternehmensfinanzierung gefährdet und damit die vom Gesetzgeber (v.a. durch das ESUG) bezweckte Stärkung der Sanierungsmöglichkeiten geradezu konterkariert[26]. Auch die Diskussion zu § 55 Abs. 4 InsO ist rechtspolitisch davon geprägt, auf wessen Seite man steht. Die angeblichen Steuerausfälle, mit denen man die Einführung des § 55 Abs. 4 InsO begründet hat, sind lediglich vom Bundesrechnungshof behauptet und bislang weder durch verifizierbare Zahlen noch durch Saldierungen mit anderweitigen Vorteilen belegt worden. Im Ergebnis ist aber bereits festzuhalten, dass § 55 Abs. 4 InsO gegen Verfassungsrecht (Art. 3, 14 GG) verstößt[27]. Freilich, anders als in dem oben zitierten zu § 28e Abs. 1 S. 2 SGB IV ergangenen Urteil, ist bei § 55 Abs. 4 InsO zumindest die Rechtsfolge klar geregelt worden. Das hat zur Folge, dass der Leitsatz des BGH zutrifft, wonach lediglich dann, wenn der fingierte Tatbestand selbst auslegungsbedürftig und auslegungsfähig ist, der Richter die Auslegung des bindend unterstellten Sachverhalts so vornehmen könne, dass der Zweck einer Fiktion nach den allgemeinen Gesetzen möglichst erreicht wird[28] (s auch Rn 404).