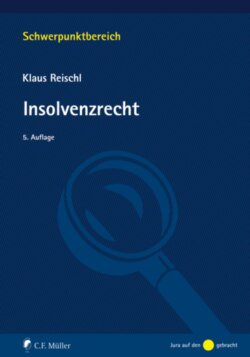Читать книгу Insolvenzrecht - Klaus Reischl - Страница 36
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Exkurs: Antragspflicht
Оглавление71
Ist der Schuldner eine natürliche Person, kann man davon ausgehen, dass er in der Krise einen Insolvenzantrag stellen wird, schon um der weiteren Behelligung durch Gläubiger und Gerichtsvollzieher zu entgehen. Bei solchen Schuldnern ist zu Gunsten der Gläubiger auch ein gewisses Maß an Transparenz der Vermögensverhältnisse gegeben, zudem gibt es keine Haftungsbegrenzungen. Anders ist es bei juristischen Personen als Schuldner oder bei Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit (KG, OHG), bei denen keine natürliche Person persönlich haftet. Da hier (zunächst) keine natürlichen Personen in der persönlichen Haftung stehen und der Gläubigerzugriff rechtlich auf das Stammkapital (soweit vorhanden) begrenzt ist, fehlen häufig sowohl das Verantwortungsbewusstsein als auch die Transparenz der Vermögensverhältnisse. Nicht zuletzt um die (potenziellen) Gläubiger vor Geschäften mit insolvenzreifen Gesellschaften zu schützen, hat der Gesetzgeber daher Antragspflichten für juristische Personen geschaffen, die zur Steigerung des Antragsdrucks auch mit empfindlichen Strafen bewehrt sind. Da die strafbewehrte Antragspflicht lediglich das Korrelat zur fehlenden persönlichen Haftung bildet, gilt sie nicht bei Gesellschaften ohne Haftungsbeschränkungen wie GbR, oHG und KG (anders aber bei der GmbH & Co KG), wenn dort zumindest eine natürliche Person in der gesellschaftsrechtlichen Haftung ist.
72
Der Gesetzgeber hat zwar mit dem in 2007 in Kraft getretenen EHUG eine Veröffentlichungspflicht für Bilanzen eingeführt, die kostenlos und online im sog. Unternehmensregister einsehbar sind. Das hat die Transparenz der Vermögensverhältnisse zwar erhöht. Es ist aber zu beachten, dass die dort publizierten Bilanzen aus Vorjahren stammen und bei den meisten Gesellschaften nicht geprüft sind, also weder den aktuellen bzw tatsächlichen Vermögensstatus abbilden und zudem den Liquiditätsstatus kaum erahnen lassen, Außerdem können sich Krisen oftmals recht plötzlich entwickeln, so dass sie anhand der publizierten Bilanzen extern nicht erkennbar sind.
73
Die früher in Einzelvorschriften (§§ 64 Abs. 1 GmbHG, 92 Abs. 1 S. 2 AktG, 130a Abs. 1 HGB, 99 Abs. 1 GenG, jew. aF) verstreute Antragspflicht ist heute einheitlich und rechtsformneutral in § 15a InsO geregelt, wo auch die ehemals auf Spezialgesetze verteilten Strafsanktionen konzentriert wurden. Danach gilt die Antragspflicht für die Organträger aller juristischer Personen (einschließlich der GmbH & Co KG), soweit sie dem Regime des deutschen Insolvenzrechts unterliegen. Damit wurde die Antragspflicht dem Insolvenzrecht zugewiesen, so dass sich die Antragspflicht auch für die Organvertreter formal ausländischer Gesellschaften nach deutschem Recht beurteilt, insbesondere auch für den director einer englischen plc (Limited)[53]. Die Antragspflicht endet für den Organträger zwar mit Niederlegung des Amtes, jedoch nur ex nunc.
74
Weiterer Druck zur Insolvenzantragstellung wird durch die zivilrechtlichen Haftungssanktionen aufgebaut, die den Verantwortlichen bei verspäteter Insolvenzantragstellung drohen[54]. Systematisch ist hier zwischen der spezialgesetzlichen Innenhaftung gegenüber der Gesellschaft (v.a. § 64 GmbHG)[55] und der Außenhaftung gegenüber den Gläubigern wegen betrügerischer Masseschmälerung und Insolvenzverschleppung (§ 823 Abs. 2 iVm §§ 15a InsO, 266a StGB[56], 826 BGB) zu unterscheiden. Im eröffneten Insolvenzverfahren ist zu beachten, dass sowohl die Innenhaftung als auch die Außenhaftung vom Insolvenzverwalter geltend gemacht werden, die Letztere jedoch nur, soweit es sich um einen Gesamtschaden im Sinne von § 92 InsO handelt, die der Insolvenzverwalter sodann in Prozessstandschaft für die geschädigten Gläubiger einzuziehen hat; die Klagen einzelner Gläubiger sind insoweit unzulässig. Dabei ist nach hM zu unterscheiden: Einen Gesamtschaden iSv § 92 InsO erleiden nur diejenigen Gesellschaftsgläubiger, die bei Eintritt der Insolvenzreife bereits Forderungen gegen die Gesellschaft hatten (Altgläubiger). Gläubiger, deren vertragliche Ansprüche gegen die Gesellschaft erst nach Insolvenzreife entstanden sind (Neugläubiger), können zwar ebenfalls einen Quotenschaden erleiden, wenn nach Vertragsschluss ihre Befriedigungsaussichten weiter verschlechtert worden sind; hierbei handelt es sich aber um einen Individualschaden, der nicht unter § 92 InsO fällt[57]. Da der Insolvenzverwalter nur aufgrund einer verfahrensrechtlichen Ermächtigung tätig wird, kann er über diese Ansprüche nicht materiell verfügen, also weder aus eigener Kompetenz freigeben noch den Ertrag der Masse einverleiben, vielmehr ist die Bildung einer Sondermasse erforderlich. Die Entscheidung über die gerichtliche Verfolgung trifft der Insolvenzverwalter also auf eigenes Risiko (vgl § 60 InsO). Andererseits muss er in die Lage versetzt werden, beispielsweise bei betrügerischen Insolvenzen im Kapitalanlagebereich mit Hunderten von Geschädigten nicht auf dem Einschätzungsrisiko sitzen zu bleiben. Es wird daher überwiegend vertreten, dass er die Freigabe ausnahmsweise wirksam erklären kann, wenn die Erfolgsaussichten ungünstig sind und die Prozessführung wirtschaftlich nicht vertretbar ist[58]. Dem ist zuzustimmen, aber es ist darauf zu achten, dass die Freigabe gegenüber jedem potenziellen Einzelgläubiger erklärt wird; da diese Ansprüche nicht massezugehörig sind, ist eine entsprechende Erklärung gegenüber der Gläubigerversammlung nicht ausreichend. Auch die persönliche gesellschaftsrechtliche Haftung (§ 93 InsO) ist vom Insolvenzverwalter geltend zu machen, die vorstehenden Ausführungen gelten hierfür entsprechend.
75
In zeitlicher Hinsicht müssen die Antragsverpflichteten gemäß § 15a Abs. 1 S. 1 InsO spätestens drei Wochen nach objektivem Eintritt der Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit Insolvenzantrag stellen. Es ist nicht zu übersehen, dass diese Zeitspanne an sich zu knapp ist, um eine Sanierung umzusetzen, Neukredite zu bekommen oder eine Kapitalerhöhung durchzuführen[59]. Zur Erfüllung der jeweiligen formalen Anforderungen genügen drei Wochen auch bei zügigem Vorgehen und bestehender Kreditwürdigkeit regelmäßig nicht. Damit etwa eine Bank die Finanzierungsentscheidung treffen kann, müssen Gutachten erstellt und extern geprüft, Verträge abgeschlossen und Sicherheiten bestellt werden, dabei werden die Entscheidungen ab einer gewissen Größenordnung in Kollegialgremien getroffen, die nur periodisch tagen. Aber durch die Geltung der Dreiwochenfrist sollen die Verantwortlichen angehalten werden, Risikoerkennungsmechanismen zu etablieren und frühzeitig zu agieren, zumal sich wirtschaftliche Krisen in der Regel langfristig abzeichnen. Die Antragspflicht erlischt durch Erfüllung mittels eines vollständigen Antrags, oder wenn der Insolvenzgrund nachhaltig beseitigt wird[60].
Schließlich läuft die Dreiwochenfrist nur für diejenigen, die tatsächlich Sanierungschancen haben und diese auch zu realisieren versuchen, ansonsten besteht ohnehin sofortige Antragspflicht[61]. Die Strafsanktion (§ 15a Abs. 4, 5 InsO) trifft vor allem auch denjenigen, der saniert und Schulden abbaut, dabei aber die Dreiwochenfrist überschreitet, was manchen Geschäftsführer überrascht. Befremdlich ist die (ernsthaft geführte) Diskussion über die Frage, ob sich der Steuerberater, der für den Schuldner trotz Kenntnis von dessen Zahlungsunfähigkeit weiterhin die Buchhaltung erstellt, wegen psychischer Beihilfe zur Insolvenzverschleppung strafbar macht, weil der Schuldner dadurch im Weiterwirtschaften bestärkt werde. Selbst eine andauernde Insolvenzverschleppung befreit den Schuldner aber nicht von seiner gesetzlichen (und ebenfalls strafbewehrten, § 283b StGB) Pflicht zur Führung der Handelsbücher. Mit dem Argument der „psychischen Bestärkung“ könnte man auch alle Lieferanten und Arbeitnehmer des Schuldners bestrafen, wenn diese trotz Kenntnis von Zahlungsschwierigkeiten des Schuldners weiterhin aktiv bleiben.
§ 2 Die Zulässigkeit des Insolvenzantrags › VI. Glaubhaftmachung