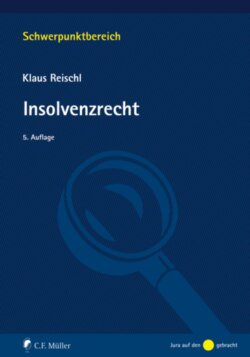Читать книгу Insolvenzrecht - Klaus Reischl - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III. Internationale Zuständigkeit
Оглавление54
Zum Internationalen Insolvenzrecht (siehe unten § 13) gehört neben dem Kollisionsrecht auch das Internationale Verfahrensrecht, das neben den Anerkennungsvoraussetzungen vor allem Zuständigkeitsregelungen enthält. Sobald der Insolvenzantrag in einem EU-Mitgliedstaat gestellt wird und aufgrund der Schuldneraktivitäten Auslandsbezüge (nicht zwingend zur EU, vgl Rn 916) bestehen (zB Schuldnervermögen, Zweigstelle oder Gläubiger im Ausland), ist die Zuständigkeit für die Eröffnung und Durchführung des Insolvenzverfahrens nach Art. 3 EuInsVO zu bestimmen[18]. Die in Art. 7 EuInsVO enthaltene Kollisionsnorm verweist dann bezüglich des im Insolvenzverfahren anwendbaren Rechts auf das Insolvenzrecht des Eröffnungsstaates (lex fori concursus, s dazu Rn 932 ff). Die EuInsVO ist durch die Verordnung (EU) 2015/848 des Europäischen Parlaments und des Rates, die am 25. Juni 2015 in Kraft getreten ist (s dazu Rn 914), auch bzgl der Zuständigkeitsregelungen reformiert worden. Dem bisherigen (aber überarbeiteten) Art. 3 EuInsVO hat man zur Erleichterung der Prüfung der der internationalen Zuständigkeit die neuen Art. 4–6 EuInsVO beiseite gestellt. Davon ist insbesondere Art. 6 EuInsVO hervorzuheben, der eine Zuständigkeitskonzentration im Insolvenzeröffnungsstaat begründet, indem er dort eine umfassende Annexzuständigkeit auch für die sich aus dem Insolvenzverfahren ergebenden Klageverfahren begründet. Diese Neufassung der EuInsVO gilt gem. Art. 84 EuInsVO für alle Verfahren, die nach dem 26. Juni 2017 eröffnet worden sind; für ältere Verfahren gilt weiterhin die VO 1346/2000.
Die internationale Zuständigkeit ist von den Insolvenzgerichten schon bisher von Amts wegen im Rahmen der Zulässigkeit des Insolvenzantrags vor der endgültigen Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu prüfen. Sicherungsmaßnahmen wie die vorläufige Insolvenzverwaltung (dazu unten § 4) können schon vor letzter Gewissheit über die eigene Zuständigkeit angeordnet werden, denn gerade in diesem Stadium besteht ein Bedürfnis nach Sicherung der künftigen Insolvenzmasse (wo auch immer diese letztlich zuständigkeitsmäßig zu verorten ist)[19]. Die Einleitung solcher Maßnahmen sperrt vorerst die Zuständigkeit später angerufener Gerichte in anderen Mitgliedsstaaten. Art. 5 VO schreibt jetzt vor, dass jeder Gläubiger (auch aus einem andern als dem Eröffnungsstaat) die insolvenzspezifischen Entscheidungen aus Gründen der internationalen Zuständigkeit angreifen können muss. Für das deutsche Recht hat dies zur Folge, dass über § 34 InsO hinaus auch jeder nicht antragstellende Gläubiger die fehlende internationale Zuständigkeit rügen kann; Ferner, dass ein entsprechender Rechtsbehelf auch gegen Sicherungsmaßnahmen geschaffen werden muss, da diese bereits als Entscheidungen iSv Art. 3 EuInsVO anzusehen sind (Rn 928)[20].
55
Wird in einem Mitgliedsstaat ein Insolvenzantrag bei einem Insolvenzgericht gestellt, muss dieses gemäß Art. 4 EuInsVO von Amts wegen prüfen, ob es nach Art. 3 EuInsVO zuständig ist. Das richtet sich danach, wo der Schuldner sein sog. center of main interests hat; auch im deutschen Sprachgebrauch wird dies mit der Abkürzung COMI belegt[21]. Als Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen sollte bereits gemäß Erwägungsgrund 13 der bisherigen EuInsVO (VO 134672000) der Ort gelten, an dem der Schuldner gewöhnlich seine Verwaltung hat und seinen Interessen so nachgeht, dass dies für Außenstehende feststellbar ist.
Bei natürlichen Personen kommen dafür entweder der tatsächliche Aufenthaltsort (bei Nichtselbstständigen) oder der Ort in Betracht, an dem ein Selbstständiger seiner Tätigkeit nachgeht. Für Grenzgänger, die in einem anderen Staat abhängig arbeiten, ist der COMI somit am Wohnort anzusiedeln[22]. Bei Gesellschaften und juristischen Personen wird gemäß Art. 3 Abs. 1 UAbs. 2 S. 1 EuInsVO bis zum Beweis des Gegenteils vermutet, dass der Mittelpunkt ihrer hauptsächlichen Interessen der Ort des satzungsmäßigen Sitzes ist. Bestehen an dieser Verortung im Hinblick auf die vorgenannten Erwägungen begründete Zweifel, ist nachzuforschen und zu ermitteln, wo die operative Leitung (zB Ein- und Verkäufe, Personaleinstellungen) umgesetzt wird; um die Gläubiger zu schützen, kommt es darauf an, ob und wie dies nach außen für Dritte erkennbar bzw feststellbar ist. Letzteres entsprach bereits bisher der Rechtsprechung des EuGH (s Rn 57) und ist jetzt in Art. 3 Abs. 1 S. 2 EuInsVO klargestellt worden. Im Rahmen der Freizügigkeit und Niederlassungsfreiheit innerhalb der EU ist eine Verlagerung des COMI immer dann als missbräuchlich anzusehen, wenn sie gezielt erfolgt, um das Insolvenzrecht des Zielorts zur schnelleren Entschuldung (zB in England: 1 Jahr nach Antragstellung) auszunutzen, beispielsweise bei einer nachweisbaren von vornherein bestehenden Rückkehroption[23]. Art 3 Abs. 1 UAbs. 3 und 4 EuInsVO haben hierzu Neuregelungen getroffen, wonach der COMI einer natürlichen Person am aktuellen Ort des gewöhnlichen Aufenthalts vermutet wird, sofern der Wechsel dorthin binnen drei Monaten bei Unternehmern bzw sechs Monaten bei Verbrauchern vor Antragstellung erfolgte (s Rn 930).
56
Befindet sich der COMI des Schuldners im Antragsstaat, bejaht der Insolvenzrichter die internationale Zuständigkeit. Es ist aber zu beachten, dass die Zuständigkeitsvorschriften der EuInsVO nur die internationale Zuständigkeit festlegen, während sich die örtliche Zuständigkeit des eröffnenden Insolvenzgerichtes nach dem nationalen Recht richtet. Aufgrund der Zuständigkeitserstreckung auf Annexverfahren besteht jedoch eine Lücke, wenn zB für die Anfechtungsklage für den Gegner kein Gerichtsstand in Deutschland eingreift, insbesondere weil keine Vermögenswerte iSv § 23 ZPO feststellbar sind. Dieser Fall ist denkbar, denn die Zuständigkeit für Annexverfahren muss nicht mit derjenigen zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens übereinstimmen[24]. Müsste die Annexklage sodann trotz bestehender internationaler Zuständigkeit der deutschen Gerichte wegen fehlender örtlicher Zuständigkeit als unzulässig abgewiesen werden, würde dies in europarechtswidriger Weise gegen Sinn und Zweck des Art. 3 Abs. 1 EuInsVO verstoßen, zumal die hiernach gegebene internationale Zuständigkeit ausschließlicher Natur ist; dieser Fall ist durch die analoge Anwendung des § 19a ZPO zu lösen[25]. Dies gilt auch im Fall eines in einem Drittstaat ansässigen Anfechtungsgegners[26].
Befindet sich der COMI in einem anderen Staat als dem der Antragstellung, ist der Insolvenzantrag als unzulässig abzuweisen. Aufgrund der hohen tatsächlichen Anforderungen an die Verlegung des COMI eines lebenden Unternehmens (s Rn 57) ist die Gefahr des forum shoppings insoweit nicht allzu hoch[27]. Hält sich das deutsche Gericht hingegen für zuständig, eröffnet es ein sog. Hauptinsolvenzverfahren (vgl Art. 3 Abs. 1 S. 1, 34 S. 1 EuInsVO), das in allen Mitgliedstaaten anerkannt wird, vgl Art. 19 EuInsVO. In den anderen (Mitglied)Staaten kann dann nur noch ein sog. Sekundärinsolvenzverfahren nach Maßgabe der Art. 34 ff EuInsVO eröffnet werden (vgl dazu Rn 923).
57
Lösung Fall 4 (Rn 44):
Im Fall 4 ist die Eurofood Ltd eine Tochtergesellschaft, deren satzungsmäßiger Sitz (Irland) in einem anderen Mitgliedstaat liegt als derjenige der Konzernmuttergesellschaft (Italien). Man muss also entscheiden, in welchem dieser beiden Staaten der COMI der Schuldnerin liegt. Auszugehen ist von der in Art. 3 Abs. 1 UAbs. 2 S. 1 EuInsVO aufgestellten Vermutung, wonach auch eine Tochtergesellschaft den Mittelpunkt ihrer Interessen in demjenigen Mitgliedstaat hat, in dem sich ihr satzungsmäßiger Sitz befindet, hier also Irland. Diese Vermutung lässt sich nur widerlegen, wenn sich aus den objektiven und für Dritte feststellbaren Umständen ergibt, dass die wirtschaftlichen Aktivitäten in Wirklichkeit woanders zu verorten sind[28]. Um die Gläubiger in ihrem Vertrauen darauf zu schützen, gegen die Schuldnerin in dem Land gerichtlich vorgehen zu können, hat man darauf abzustellen, wo die wirtschaftlichen Tätigkeiten nach außen entfaltet werden und für Dritte feststellbar sind (s auch Art. 3 Abs. 1 S. 2 EuInsVO).
Im Fall 4 hat die Eurofood Ltd ihren satzungsmäßigen Sitz in Irland, wo sie auch wirtschaftlich agiert. Zum Schutz ihrer dort ansässigen Gläubiger reicht daher die Tatsache, dass ihre wirtschaftlichen Entscheidungen von einer Muttergesellschaft mit Sitz in Italien kontrolliert werden oder kontrolliert werden können, nicht aus, um die mit Art. 3 Abs. 1 S. 2 EuInsVO aufgestellte Vermutung zu entkräften[29]. Anders wäre es nur, wenn die Eurofood Ltd in ihrem Sitzstaat Irland keine wirtschaftlichen Aktivitäten entfalten würde oder wenn die wesentlichen Funktionen des Konzerns (zB Planung der Konzernpolitik, Finanzen, Controlling, Marketing, Kommunikation, Presse) nach außen für Dritte erkennbar von Italien aus wahrgenommen würden[30]. Das ist hier jedoch nicht der Fall, so dass im Fall 4 über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Irland zu entscheiden ist.
58
Lösung Fall 5 (Rn 45):
Wegen der Verfahrenseröffnung vor dem 26. Juni 2017 gilt im Ausgangsfall noch die EuInsVO idF der VO 1346/2000, die (noch) keine eigene Regelung für die internationale Zuständigkeit für Annexklagen enthält. Möglicherweise folgt die Zuständigkeit der deutschen Gerichte im Ausgangsfall bereits aus Art. 3 EuInsVO. Da in der Fallfrage nicht nach der Zuständigkeit für die Eröffnungsentscheidung, sondern für die Anfechtungsklage (§§ 129 ff InsO) gefragt wird, ist zu prüfen, ob man diesen Rechtsstreit unter den Begriff des Insolvenzverfahrens im Sinne von Art. 3 Abs. 1 S. 1 EuInsVO subsumieren kann.
Aus dem Wortlaut ergibt sich dies zwar nicht, aber Art. 3 Abs. 1 EuInsVO könnte insoweit Konzentrationswirkung haben und neben der Eröffnungsentscheidung auch alle insolvenztypischen Streitigkeiten als sog. Annexverfahren erfassen.
Anlass zu dieser These gibt der Erwägungsgrund 6 der EuInsVO (VO 1346/2000), der von einer Zuständigkeit des Eröffnungsstaates für alle Entscheidungen spricht, die „unmittelbar aufgrund des Insolvenzverfahrens ergehen und im engen Zusammenhang damit stehen“. Eine Klage, die derartige Merkmale aufweist, fällt demnach nicht in den Anwendungsbereich dieses Übereinkommens. Gleichwohl fehlt eine ausdrückliche Regelung dieser sog. Annexverfahren im Verordnungstext. Somit kann man eine planwidrige Lücke diagnostizieren und diese durch eine Einbeziehung aller mit dem Insolvenzverfahren typischerweise zusammenhängenden Klagen in den Anwendungsbereich des Art. 3 Abs. 1 S. 1 EuInsVO im Wege autonomer Lückenfüllung schließen[31]. Der BGH hat diese (damals sehr umstrittene) Frage im Jahre 2007 dem EuGH zur Entscheidung vorgelegt[32]. Der EuGH hat Art. 3 EuInsVO zu Gunsten einer effektiven Verordnungswirkung sowie der Verbesserung und Beschleunigung von Insolvenzverfahren als Annexkompetenzvorschrift interpretiert[33]; insolvenzspezifische Rechtsstreitigkeiten können somit im Eröffnungsstaat entschieden werden. Die mit der EuInsVO unter anderem bezweckte Verfahrenskonzentration im Insolvenzrecht wird damit gefördert, sowohl dem forum shopping (vgl Erwägungsgrund 4) als auch negativen Kompetenzkonflikten (keines der angerufenen Gerichte hält sich für zuständig) wird vorgebeugt.
Die Gerichte des Mitgliedstaats, in dessen Gebiet das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist, sind demnach auch für eine Anfechtungsklage gegen einen Anfechtungsgegner zuständig, der seinen satzungsmäßigen Sitz in einem anderen Mitgliedstaat hat. Im Fall 5 ergibt sich also gem. Art. 3 Abs. 1 EuInsVO (VO 1346/2000) ein ausschließlicher Gerichtsstand in Passau. Dieses Ergebnis ergibt sich für alle nach dem 26. Juni 2017 eröffneten Verfahren unmittelbar aus dem neuen Art. 6 Abs. 1 EuInsVO, der die Anfechtungsklagen ausdrücklich als Annexklagen definiert und der internationalen Zuständigkeit gem. Art. 3 Abs. 1 EuInsVO zuordnet.
Im Rahmen der Prüfung der Begründetheit der Anfechtungsklage hat das deutsche Gericht gem. Art. 7 Abs. 2 S. 2 lit. m EuInsVO grundsätzlich deutsches Recht anzuwenden, hier also die §§ 129 ff InsO. Für die Anfechtbarkeit ist allerdings die (systemwidrige) Ausnahmeregelung des Art. 16 EuInsVO zu berücksichtigen. Danach ist die Klage unbegründet, wenn die benachteiligende Rechtshandlung, auf die die Anfechtungsklage gestützt wird, nach dem Heimatrecht des Anfechtungsgegners nicht angreifbar ist. Dieser Einwand der Nichtanfechtbarkeit nach dem Heimatrecht ist jedoch eine prozessuale Einrede, die das Gericht nicht von Amts wegen prüft, sondern die vom Anfechtungsgegner vorgetragen und bewiesen werden muss[34].
§ 2 Die Zulässigkeit des Insolvenzantrags › IV. Die Insolvenzfähigkeit des Schuldners