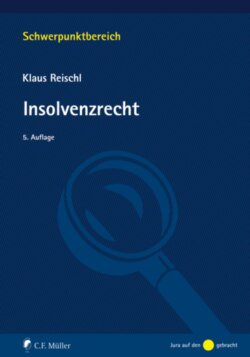Читать книгу Insolvenzrecht - Klaus Reischl - Страница 43
На сайте Литреса книга снята с продажи.
§ 3 Die Begründetheit des Insolvenzantrags
ОглавлениеInhaltsverzeichnis
I. Zahlungsunfähigkeit
II. Drohende Zahlungsunfähigkeit
III. Überschuldung
87
Fall 6:
S verfügt am 1.7. noch über Barvermögen in Höhe von € 5000. Er schuldet der Steuerberaterin G für Steuerberatungsleistungen seit dem 1.6. noch € 25 000, bei der Bank B steht sein (unbefristeter und ungekündigter) Kontokorrent bei minus € 5000 (vereinbartes Limit € 25 000), dem V schuldet er aus in Rechnung gestellten Warenlieferungen € 25 000. G, die von den finanziellen Schwierigkeiten des S weiß, hat vorerst noch keine förmliche Rechnung gestellt und S mündlich eingeräumt, er könne zahlen, sobald es ihm möglich sei. Außerdem wurde S kürzlich zur Zahlung von € 50 000 an B verurteilt. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar, aber B hat keine Sicherheit erbracht und S hat dagegen Berufung eingelegt. V will jetzt wissen, ob ein Insolvenzantrag gegen S Aussichten auf Erfolg hat. Rn 99
88
Fall 7:
Bauunternehmer S hat fällige Verbindlichkeiten in Höhe von € 150 000 beim Finanzamt, € 75 000 bei der AOK sowie € 15 000 beim Betonlieferanten B, einem finanzkräftigen Großunternehmen. Derzeit hat S nur noch € 25 000 Barmittel zur Verfügung, aber spätestens in zwei Monaten ist mit einem durch Bankbürgschaft absicherten Zahlungseingang in Höhe von € 250 000 aus einer geprüften und freigegebenen Schlussrechnung zu rechnen. Als das Finanzamt Insolvenzantrag stellt, beauftragt das Insolvenzgericht den Rechtsanwalt R als Sachverständigen mit der Prüfung der Begründetheit des Insolvenzantrags. Zu welchem Ergebnis wird R kommen? Rn 107
89
Erweist sich der Insolvenzantrag als zulässig, geht das Insolvenzgericht zur Prüfung der Begründetheit über. Die Zulassung des Antrags ist ein gerichtsinterner, nicht gesondert beschwerdefähiger (§ 6 Abs. 1 S. 1 InsO) Vorgang, der nur mit der Eröffnungsentscheidung angreifbar ist (§ 34 InsO)[1]. Während für die Zulässigkeit des Antrags die Glaubhaftmachung des Eröffnungsgrundes ausgereicht hat, muss im Rahmen der Begründetheit des Insolvenzantrags festgestellt werden, ob der Eröffnungsgrund tatsächlich erfüllt ist, § 16 InsO.
90
Bei der Prüfung der Begründetheit ist die Aufgabenstellung des Insolvenzverfahrens vor dem Hintergrund ihrer einschneidenden Wirkungen für den Schuldner zu beachten: Es soll nur und erst eröffnet werden, wenn die Einzelvollstreckung keinen Erfolg mehr verspricht und somit das vollstreckungsrechtliche Prioritätsprinzip vom Grundsatz der Gläubigergleichbehandlung abgelöst wird. Je geringer der Umfang der Unterdeckung der Verbindlichkeiten ist, desto eher kann man den Gläubigern ein einstweiliges Abwarten zumuten, denn das Geschäftsleben ist davon gekennzeichnet, dass sich Phasen mit guter und schlechter Umsatz- und Ertragslage abwechseln[2]. Deshalb müssen klare Kriterien zur Bestimmung der Insolvenzreife vorgegeben werden, um die Eröffnungsentscheidung mit ihren einschneidenden Wirkungen für den Schuldner justiziabel (vgl § 34 Abs. 2 InsO) zu machen.
91
Der allgemeine Insolvenzgrund ist die Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO). Zu deren Ermittlung betrachtet man ausschließlich das liquide Barvermögenspotenzial des Schuldners und prüft, ob er damit seine kurzfristigen Zahlungspflichten erfüllen kann; gebundene Vermögenswerte, die nicht kurzfristig realisiert werden können (zB Immobilien, Anlagen, langfristige Forderungen) bleiben dabei außer Betracht. Bei juristischen Personen (sowie in Nachlassinsolvenzverfahren, § 320 S. 1 InsO) ist auch die Überschuldung (§ 19 InsO) ein Insolvenzeröffnungsgrund. Im Unterschied zur Zahlungsunfähigkeit wird hier das gesamte Aktivvermögen bewertet und geprüft, ob sich damit alle bestehenden Verbindlichkeiten (auch langfristige) abdecken lassen.
92
Das Insolvenzverfahren ist immer zu eröffnen, wenn der Schuldner zahlungsunfähig ist. Dem Schuldner hilft also werthaltiges gebundenes Aktivvermögen nichts, wenn ihm derzeit die Barmittel fehlen, um die fälligen Verbindlichkeiten (zB Löhne, Sozialversicherungsbeiträge, Warenlieferungen) bezahlen zu können. Werthaltige Grundstücke, die der Schuldner nicht mehr kurzfristig beleihen kann, ändern also nichts an einer mangels Liquidität bestehenden Zahlungsunfähigkeit. Andererseits führen (langfristige) Verbindlichkeiten, die zwar das Aktivvermögen bilanziell übersteigen aber erst viel später oder in Raten fällig werden (va Bankkredite), nicht zur Zahlungsunfähigkeit, wenn der Schuldner seine aktuellen Zahlungsverpflichtungen bedienen kann. In diesem Fall kann das Insolvenzverfahren (zB zu Sanierungszwecken) aber auf Schuldnerantrag hin wegen drohender Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO) eröffnet werden. Der Schuldner kann sich in dieser Situation auch zur Vorbereitung einer Sanierung unter den Schutz des § 270b InsO begeben, um in Ruhe einen Insolvenzplan auszuarbeiten (siehe Rn 876).
§ 3 Die Begründetheit des Insolvenzantrags › I. Zahlungsunfähigkeit