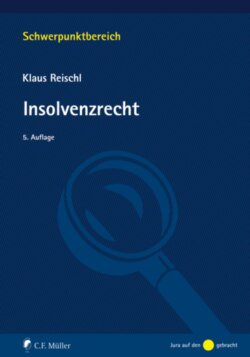Читать книгу Insolvenzrecht - Klaus Reischl - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5. Die Insolvenzrechtsreformen
Оглавление17
Die InsO hat mit ihrem Inkrafttreten am 1. Januar 1999 gleich drei Gesetze abgelöst[11], nämlich die Konkursordnung (KO), die Vergleichsordnung und die Gesamtvollstreckungsordnung (ein Relikt aus der Zeit des geteilten Deutschlands). Die KO ist im Rahmen der Reichsjustizgesetze am 10. Februar 1877 zusammen mit GVG, ZPO und StPO in Kraft getreten. Sie war vorrangig auf Liquidierung des Schuldnervermögens ausgerichtet, einvernehmliche Regelungen gab es nur in Form des sog. Zwangsvergleichs innerhalb des Konkursverfahrens (§§ 173 ff KO). Am 26. Februar 1935 ist schließlich die Vergleichsordnung (VerglO) in Kraft getreten, um die durch Krieg und Wirtschaftskrisen bedingten Zusammenbrüche an sich lebensfähiger Betriebe außerhalb des Konkursverfahrens steuern zu können[12]. Auslöser für das bereits in 1978 (mit der Einsetzung einer Kommission für Insolvenzrecht) begonnene Reformprojekt war der Umstand, dass unter dem Regime von KO und VerglO eine notorische Massearmut zu beklagen war. Bedingt unter anderem durch das Vorrecht des Fiskus konnte man in den seltensten Fällen das Insolvenzverfahren durchführen, da es an Masse fehlte. Statistisch konnte 1975 in ca. 45% und 1996 in ca. 75% der Fälle das Verfahren mangels Masse gar nicht erst eröffnet werden, in ca. 20% aller eröffneten Verfahren erfolgte später die Einstellung mangels Verfahrenskostendeckung.
Da die Eröffnung oder Aufrechterhaltung eines Insolvenzverfahrens unterbleibt, wenn Verfahrenskosten nicht aus dem Schuldnervermögen gedeckt werden können, musste der Gesetzgeber der InsO für größeres Massepotenzial sorgen. Dazu hat man Vorrechte abgeschafft, die Verwertung der Absonderungsrechte dem Insolvenzverwalter gegen Kostenpauschale übertragen und die Anfechtungsmöglichkeiten gestärkt. Bereits im Jahr nach dem Inkrafttreten der Insolvenzordnung war ein Anstieg der Eröffnungen um 25% zu verzeichnen, die Zahl der Verbraucherinsolvenzen nicht mitgerechnet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es nach 2000 aus konjunkturellen Gründen einen explosionsartigen Anstieg der Unternehmensinsolvenzen gab; Entsprechendes gilt für die Verbraucherinsolvenzen zur Restschuldbefreiung, die überhaupt erst seit 1999 möglich sind. Im Zuge der sog. Wirtschaftskrise haben die Zahlen im Jahre 2010 mit 168 458 (davon 31 998 Unternehmensinsolvenzen) einen Rekordstand erreicht, seit 2011 sind aber jeweils deutliche Rückgänge zu verzeichnen; zuletzt sind die Insolvenzverfahren auf einen Rekordtiefstand von 109 584 (davon 19 302 Unternehmensinsolvenzen) zurückgegangen[13]. Wenngleich man aus Statistiken im Einzelnen nicht viel herauslesen kann[14], zeigt sich zumindest, dass die Einführung der Insolvenzordnung einiges bewegt hat.
18
Eine wichtige Zäsur in der Geschichte der InsO bedeutete das Inkrafttreten des ESUG im Jahre 2012. Der Gesetzgeber stärkte damit vor allem die Mitbestimmungsrechte der Gläubiger durch die Etablierung eines vorläufigen Gläubigerausschusses und die Übertragung von vielfachen Entscheidungskompetenzen auf diesen Ausschuss, zB über die Auswahl des zu bestellenden Insolvenzverwalters. Besonders öffentlichkeitswirksam waren jedoch die Stärkung von Eigenverwaltung und Insolvenzplanverfahren sowie die Einführung des sog. Schutzschirmverfahrens (§ 270b InsO), das eine Möglichkeit der eigenverantwortlichen Vorbereitung eines Insolvenzplanverfahrens bietet; alle diese Neuerungen wurden wiederum mit weitreichenden Mitsprachrechten des (vorläufigen) Gläubigerausschusses versehen. Trotz der erheblichen Schwierigkeiten, die mit der praktischen Anwendung der gesetzestechnisch teilweise misslungenen Vorschriften des ESUG verbunden sind, ist diesem Vorhaben zu attestieren, aufgrund seiner Öffentlichkeitswirksamkeit die Wahrnehmung der (auch vorher schon effektiven) Sanierungsinstrumentarien der InsO bei Schuldnern und Gläubigern positiv geprägt zu haben. Die insolvenzrechtlichen Sanierungsoptionen, die mit dem ESUG neu justiert wurden, können nur dann etwas bewirken, wenn die Betroffenen diese frühzeitig als Chance zur Rettung des Unternehmens erkennen und nicht mehr (wie bisher) als Stigma fürchten. Man kann festhalten, dass das ESUG insoweit einen Richtungswechsel bewirkt und dazu geführt hat, dass sich die Betroffenen frühzeitiger als bisher mit insolvenzrechtlichen Szenarien befassen.
19
Zum 1. Juli 2014 sind zahlreiche Neuregelungen im Restschuldbefreiungsverfahren (für natürliche Personen) in Kraft getreten (s ausf Rn 790 ff). Die Anzahl der Insolvenzverfahren von Einzelpersonen war schon immer sehr hoch. Ob die nunmehr eingeführten Möglichkeiten der abgestuften Reduzierung der Laufzeit der sechsjährigen sog Wohlverhaltensperiode (fünf Jahre bei vollem Kostenausgleich, drei Jahre bei zusätzlich 35%-iger Quotenzahlung, s dazu § 300 Abs. 1 InsO) die erwünschten volkswirtschaftlichen Effekte hervorruft, wird beobachtet: Die Bundesregierung hatte dem Bundestag hierüber bis zum 30. Juni 2018 zu berichten (Art. 107 EGInsO). Laut diesem Bericht ist der Anteil der Schuldner, die eine vorzeitige Restschuldbefreiung erlangen konnten, jedoch weit hinter den damaligen Erwartungen von mindestens 15 % geblieben, nämlich bei deutlich unter 2 % (vgl BT-Ds 19/4000,7). Vor dem Hintergrund, dass die durchschnittliche Restschuldbefreiungsdauer europaweit bei 4 Jahren liegt, erweist sich also die deutsche Regelung weiterhin als überlang.
Zuletzt wurde auch das Anfechtungsrecht einer Reform unterzogen, die von (einseitig) interessierten Beteiligten (Industrie, Handwerk, Sozialversicherungsträger und Fiskus als potenzielle Anfechtungsgegner) seit Langem gefordert wurde (s auch Rn 40 f). Am 5. April 2017 ist das „Gesetz zur Verbesserung der Rechtssicherheit bei Anfechtungen nach der Insolvenzordnung und dem Anfechtungsgesetz“ in Kraft getreten; gem. Art. 103j EGInsO gelten die Änderungen für Insolvenzverfahren, die nach dem 5. April 2017 eröffnet worden sind. Dass die gesetzgeberischen Aktivitäten, vor allem zu § 133 InsO, sich bei sorgfältiger Analyse der einschlägigen Rechtsprechung des BGH (nach wie vor) als überflüssig erweisen, ist ebenso bekannt[15] wie der Befund erheblicher handwerklicher und systematischer Fehler[16].
Die vielfache Kritik an der (gesetzeskonformen) Fokussierung der Insolvenzverwalter auf das jeweilige Einzelunternehmen bei Konzerninsolvenzen hat zum „Gesetz zur Erleichterung der Bewältigung von Konzerninsolvenzen“ geführt, das nunmehr für alle Insolvenzverfahren gilt, die nach dem 21.4.2018 beantragt wurden. Neben der Möglichkeit einer Zuständigkeitskonzentration von mehreren Insolvenzverfahren einer Unternehmensgruppe an einem Gruppen-Gerichtsstand (§§ 3a ff InsO) sind in den §§ 269a ff InsO auch verfahrensübergreifende Koordinationsmechanismen etabliert worden. Danach werden entweder die Insolvenzverwalter, Gerichte und Gläubigerausschüsse der Insolvenzverfahren gruppenangehöriger Schuldner untereinander zum freiwilligen Informationsaustausch und zur Kooperation angehalten (§§ 269a-c InsO) oder es wird (freilich nur bei größeren Unternehmensgruppen) ein formales Koordinationsverfahren eingeleitet (§§ 269d ff InsO), für das ein unabhängiger Verfahrenskoordinator bestellt wird.
§ 1 Einführung in das Insolvenzrecht › II. Insolvenzverfahren und Zivilprozessverfahren