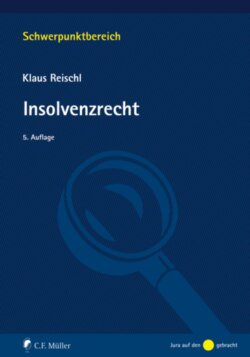Читать книгу Insolvenzrecht - Klaus Reischl - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Insolvenzverfahren als privatisierte Haftungsverwirklichung
Оглавление20
Im Zivilprozess wird der Inhalt der Entscheidung vom Gericht in einem kontradiktorischen Verfahren nach den Erkenntnisregeln der ZPO festgelegt. Im Insolvenzverfahren hingegen werden die Ansprüche auf kurzem und meist einseitigem Wege in dem von der Gläubigerschaft dominierten Forderungsfeststellungs- oder Insolvenzplanverfahren erörtert und geprüft (§ 176 InsO), das Gericht hat nur sehr geringe Einflussnahmemöglichkeiten, es verharrt hier eher in der Rolle eines Moderators. Während also das Zivilprozessverfahren (unbeschadet der Dispositionsmaxime, die nur den Umfang vorgibt) rein hoheitliche Erkenntnistätigkeit ist, ist das Insolvenzverfahren Ausdruck einer ausgeprägten Gläubigerautonomie bezüglich der Rechtsverwirklichung.
21
Dieser strukturelle Unterschied ist Zeichen einer weitgehenden Privatisierung der Verfahrenssteuerung im eröffneten Insolvenzverfahren. Dabei ist die Zäsur der Eröffnungsentscheidung zu beachten (siehe dazu das Schaubild Rn 29): Nach Eingang eines Insolvenzantrags prüft das Insolvenzgericht im sog. Eröffnungsverfahren, ob der Insolvenzantrag zulässig und begründet ist. In diesem Stadium gilt hinsichtlich der Prüfung der Eröffnungsvoraussetzungen sogar der Amtsermittlungsgrundsatz (§ 5 InsO), denn aufgrund der einschneidenden Auswirkungen (vgl nur § 80 InsO) muss der Schuldner vor unbegründeten Verfahrenseröffnungen geschützt werden, vor allem wenn der Antrag von einem Gläubiger gestellt worden ist. Sobald das Insolvenzverfahren eröffnet ist, gibt das Gericht die Verfahrensherrschaft jedoch weitgehend an die Gläubigerschaft ab (vgl §§ 74 ff InsO), die nunmehr als Herrin über den weiteren Verlauf des Verfahrens bestimmt (vgl zB §§ 157, 160, 162 InsO). Alternativ zum Regelverfahren können die Gläubiger für ein Insolvenzplanverfahren (vgl §§ 1, 235 InsO) oder ein Verfahren in Eigenverwaltung (§ 270 Abs. 3 S. 2 InsO) votieren und damit ein autonomes Verfahren durchführen, bei dem man vom gesetzlichen Ablauf eines Regelinsolvenzverfahrens abweichen kann.
22
Die in Gläubigerversammlung und (vorläufigem) Gläubigerausschuss institutionalisierte Gläubigerschaft gibt im Insolvenzverfahren die Art und Weise der Haftungsumsetzung, den Ablauf sowie das Ziel des Verfahrens (Zerschlagung oder Sanierung, Art der Sanierung) vor. Die Forderungen werden in Eigenregie durchgesetzt, wobei der Insolvenzverwalter lediglich als operatives Organ der Gläubigerschaft agiert. Demgegenüber sind die Aufgaben und Befugnisse des Insolvenzgerichts auf Sitzungsleitung, Protokollierung, Kontrolle und Bekanntmachung begrenzt, lediglich im Insolvenzplanverfahren sind (beschränkte) materielle Prüfungskompetenzen vorgesehen, vgl § 250 InsO. Soweit die Gläubigerautonomie durch Verwalterbefugnisse sowie Verfahrensrechte anderer Beteiligter beschränkt ist, stellt dies nur eine unumgängliche Konsequenz der Kollision einer Vielzahl involvierter grundrechtlicher Gewährleistungen dar[17].
23
Zu beachten ist aber, dass die Verwertung sowohl im Zivilprozessverfahren als auch im Insolvenzverfahren auf der Grundlage eines vollstreckbaren Titels erfolgt. Im (privat gesteuerten) Insolvenzverfahren wirkt jedoch bereits die Eintragung der Forderung in die Tabelle für festgestellte Forderungen wie ein rechtskräftiges Urteil (§ 178 Abs. 3 InsO). Damit hat der Gläubiger einen Titel, aus dem er nach der Verfahrensaufhebung (wie aus einem vollstreckbaren Urteil) die Zwangsvollstreckung betreiben kann, soweit die Quote im Insolvenzverfahren (wie fast immer) hinter dem festgestellten Betrag zurückgeblieben ist, vgl §§ 201 Abs. 1, 257 Abs. 1 S. 1 InsO. Diese Nachhaftung besteht also in Höhe der Differenz zwischen festgestellter Forderung und ausgezahlter Quote. Aufgrund der (regelmäßig in Anspruch genommenen) Möglichkeit der Restschuldbefreiung für natürliche Personen (§§ 201 Abs. 3, 286 InsO) sowie der Zwangsauflösung juristischer Personen (vgl etwa § 60 Abs. 1 Nr 4, 5 GmbHG) ist aber nur selten mit erfolgreichen Vollstreckungen zu rechnen. Ebenso begründen Insolvenzpläne die Schuldbefreiung (vgl § 227 InsO), so dass auch hier eine Nachhaftung regelmäßig ausscheidet.
§ 1 Einführung in das Insolvenzrecht › II. Insolvenzverfahren und Zivilprozessverfahren › 2. Vor- und Nachteile des Insolvenzverfahrens