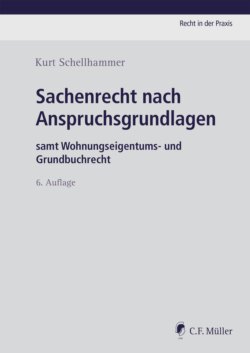Читать книгу Sachenrecht nach Anspruchsgrundlagen - Kurt Schellhammer - Страница 54
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Besitz und Eigentum
Оглавление22
§ 854 I definiert den Besitz als „tatsächliche Gewalt“ über eine Sache[1]. Besitzen kann man nur Sachen, also „körperliche Gegenstände“ (§ 90), weder Rechte noch ganze Vermögen.
Die tatsächliche Sachherrschaft des Besitzers unterscheidet sich fundamental von der rechtlichen Sachherrschaft des Eigentümers, der nach § 903 S. 1 mit seiner Sache machen darf, was er will. Auch wenn der Volksmund den Besitz noch immer mit dem Eigentum gleichsetzt und den Eigentümer meint, wenn er vom Grundstücks- oder Haus- oder Autobesitzer spricht, trennt das geltende Recht scharf zwischen Besitz und Eigentum. Denn der Besitz hat andere Voraussetzungen und andere Rechtsfolgen als das Eigentum. Das 3. Buch „Sachenrecht“ des BGB regelt deshalb im 1. Abschnitt mit den §§ 854-872 vorweg den „Besitz“ und erst im 3. Abschnitt mit den §§ 903-1011 das „Eigentum“. Diese Trennung ist schon deshalb richtig, weil nicht jeder Besitzer zugleich Eigentümer und nicht jeder Eigentümer zugleich Besitzer ist. Besitzer sind der Mieter, der Finder und der Stehler, Eigentümer hingegen ist keiner der drei. Mieter und Finder haben immerhin ein Recht zum Besitz, der Dieb hat nichts dergleichen, sondern nur die nackte tatsächliche Sachherrschaft, die aber lässt sich nicht bestreiten.
Schon stellt sich die Frage, ob denn der Besitz ein Recht sei. Die Antwort sollte nicht schwer fallen. Die tatsächliche Sachherrschaft bar jeder Berechtigung, wie der Dieb sie an sich reißt, ist das Gegenteil eines Rechts, ist grobes Unrecht, erst das Recht zum Besitz aus Eigentum, Pfandrecht oder Miete macht aus der tatsächlichen Sachherrschaft auch eine rechtliche.
Der Jurist muss deshalb nicht nur Besitz und Eigentum, sondern auch berechtigten und unberechtigten Besitz auseinander halten.