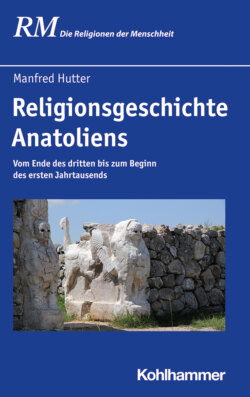Читать книгу Religionsgeschichte Anatoliens - Manfred Hutter - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4 Methodische Folgen für die Beschreibung von Religionen in Anatolien
ОглавлениеDie oben genannten Quellen und die Forschungssituation zu den Religionen in Anatolien sind für den Zeitraum vom Ende des 3. Jahrtausends bis in die ersten Jahrhunderte des 1. Jahrtausends keineswegs ausgewogen verteilt. Obwohl das Buch chronologisch aufgebaut ist, kann keine Religionsgeschichte im strengen Wortsinn vorgelegt werden, da der Kenntnistand für einzelne Zeiten unterschiedlich ist. Methodisch bedeutet dies, dass ich eine Darstellung wähle, die ich als »fragmentierten« Zugang (anstelle eines »harmonisierten« Zugangs) bezeichne.58 Es geht nicht darum, das (religionsphilosophische) Wesen der Religionen Kleinasiens zu rekonstruieren, sondern es sollen die verschiedenen Formen religiöser Praktiken in ihrer jeweiligen historischen und gesellschaftlichen Verortung dargestellt werden, wobei auch lokale und individuelle Formen der Religionsausübung soweit wie möglich berücksichtigt werden müssen.
Dieser »fragmentierte« Zugang bzw. die nur »fragmentiert« mögliche Rekonstruktion erlaubt – aufgrund der Quantität der Quellen – in der hethitischen Großreichszeit folgende drei Ebenen der Betrachtung von »hethitischer« Religion.59 Am besten ist im hethitischen Schrifttum die »politische Religion des hethitischen Staates« mit den großen Festen und Ritualen dokumentiert, die für die Götter des »Staatspantheons« ausgerichtet wurden.60 Auf dieser Ebene wird Religion als gesellschaftsstabilisierender Faktor deutlich, wobei – entsprechend der Expansion des Hethiterreiches – das Staatspantheon sowie Rituale durch die Übernahme »fremder« Traditionen erweitert oder auch verändert wurden. Dabei handelt es sich um additive Prozesse, durch die das »Fremde« dann auch zum »Eigenen« wurde; pointiert gesagt heißt dies aber zugleich, dass diese Religion(swelt) immer ein Konglomerat sehr unterschiedlicher Traditionen war. Als zweite Ebene kann man die »dynastische Religion des Königshauses« benennen, auf die zu Recht nachdrücklich P. Taracha als von der »politischen Religion des Staates« bzw. von einer »Staatsreligion« unterschieden hingewiesen hat.61 Diese Ebene der Religion ist unmittelbar mit hurritischen Göttern und Ritualen, die aus Kizzuwatna ins hethitische Kernland importiert wurden, verbunden. Dabei ist diese »dynastische Religion« zwar von der »politischen Religion des Staates« zu unterscheiden, da aber auch letztere eng mit dem König verbunden ist, sind Überlappungen zwischen beiden Ebenen vorhanden. Die dritte zu unterscheidende Ebene bezeichne ich als »Religion der allgemeinen Bevölkerung«, wobei diese fast nur indirekt aus den Quellen des »Staatskults« zu erschließen ist, da wir nur wenige Zeugnisse für solche Formen von Religion im allgemeinen Alltag besitzen. Diese Ebene von Religion kennt dabei kaum umfangreiche organisatorische Strukturen, wie sie im Fall der politischen Religion des Staates gut ausgeprägt sind. Zweierlei macht diese Ebene jedoch religionsgeschichtlich m. E. besonders interessant: Einerseits zeigt sie, dass Formen der politischen Staatsreligion – teilweise in vereinfachter Form – in alltäglichen religiösen Praktiken durchgeführt oder »nachgeahmt« wurden,62 und andererseits sind auf dieser Ebene auch die lokalen Religionsformen – luwischer, hurritischer und hattischer Provenienz – einzuordnen, soweit diese nicht aus politischer Räson in die politische Staatsreligion einbezogen wurden.
Die Beachtung dieser drei Ebenen macht die Pluralität der Religionswelt der hethitischen Großreichszeit deutlich, so dass dies der methodische »Leitgedanke« in der Beschreibung der religiösen Strukturen und Praktiken sein soll. Anhand der Darstellung von Göttern und Kultstädten lassen sich Strukturen politisch-offizieller (und dynastischer) Religion darstellen, um daran anschließend – auch meist auf der Ebene der »politischen« Religion bleibend – Praktiken des Umgangs mit den Gottheiten zu beschreiben, ehe Religion als Faktor des (auch alltäglichen) Zusammenlebens thematisiert werden soll. Diese Gliederung kann dabei der Überlappung der drei Ebenen Rechnung tragen, erlaubt aber auch, die »offizielle und öffentliche« Seite von Religionen wenigstens teilweise von der »privaten und alltäglichen« Seite von Religion zu unterscheiden. Es kann aber nicht verschwiegen werden, dass diese ideale Beschreibung und die methodische Annäherung auf ein Hindernis stoßen. Denn die zur Verfügung stehenden Quellen – als Ergebnis der bewussten Tradierung zur Stützung »offizieller« Religion, aber auch wegen der Zufälligkeit des Erhaltungszustandes – erlauben kein systematisches Ausarbeiten der Religionen nach diesen Parametern. Einigermaßen möglich ist es für die Zeit des hethitischen Großreiches (von der Mitte des 14. bis zum Beginn des 12. Jahrhunderts), anhand dessen Material dieser methodische Zugang entwickelt wurde. In den anderen Kapiteln (bzw. zeitlichen Abschnitten) lässt sich dieser Aufbau nicht immer in gleicher Weise durchführen. Denn die Funde aus Alaca Höyük (Mitte 3. Jahrtausend) sowie die Quellen aus der Periode der altassyrischen Handelskolonien (20. bis 18. Jahrhundert) gewähren nur (zufällige) Einblicke in einzelne Bereiche von Religion, für die altassyrische Handelsperiode vor allem zu den Gottheiten. In der Behandlung der althethitischen Zeit (Mitte des 17. bis Ende des 15. Jahrhunderts) ist zu beachten, dass manche damaligen Vorstellungen nur aus der Perspektive der Veränderungen der hethitischen Großreichszeit erschlossen werden können, wobei die für solche Rekonstruktionen notwendige Analogie zu jüngeren Vorstellungen immer auch die Gefahr einer Fehldeutung birgt.
Nach dem Untergang des Hethiterreiches sind die religiösen Vorstellungen nicht verschwunden, aber durch neue Organisationstrukturen re-interpretiert worden. Durch Verschiebungen von Bevölkerungselementen, durch Austausch von Gedanken und Überlieferungsgut sind die überlieferungswürdigen Inhalte einer Veränderung gegenüber den früheren Epochen unterworfen. Dadurch stellen sich die religiösen Vorstellungen, die in den Texten und Bildern der so genannten neo-hethitischen (Klein-)Staaten in Zentral- und Süd(ost)anatolien bis zum Ende des 8. Jahrhunderts dokumentiert sind, in einem jeweils eigenen Gepräge dar – mit Kontinuität und Eigengut. Auch wenn die Quellen für die Erschließung der religiösen Verhältnisse in diesen Staaten nicht allzu umfangreich sind, bleibt es trotzdem möglich, in einem »fragmentierten« Zugang wenigstens Grundzüge zu Gottheiten, zu Aspekten des umfangreichen Bereichs des Kults sowie zur Verflechtung von Religion und Gesellschaft zu skizzieren. In den anderen politischen Größen der ersten Hälfte des 1. Jahrtausends – im Flächenstaat der Phryger (10. bis 7. Jahrhundert), in den Herrschaftssitzen der Lyker, Karer und Lyder im Süden und Südwesten Kleinasiens (7./6. bis 4. Jahrhundert) – dominiert dabei der Anteil an »Neuem« gegenüber der Bewahrung oder Rezeption von Traditionen des 2. Jahrtausends. Daher wird am Ende des Bandes nur kurz auf diesen Raum hingewiesen, ohne die dort fassbaren Religionen weiter zu behandeln. Dies soll jedoch nicht heißen, dass diese Religionen nicht mehr zur Religionsgeschichte Anatoliens gehören würden. Denn Religionsgeschichte ist nie abgeschlossen, so dass man letztere Religionen – trotz der Veränderungen, die sie zeigen – als Beispiel der Dynamik, die allen Religionen und der Religionsgeschichte innewohnt, sehen muss, deren detaillierte Analyse in einem anderen Kontext Fortsetzung verdient.