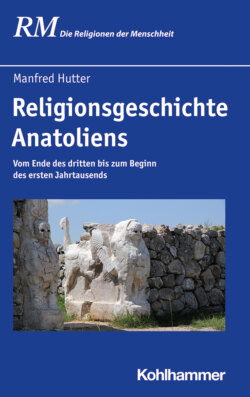Читать книгу Religionsgeschichte Anatoliens - Manfred Hutter - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 Quellenvielfalt und Varietät
ОглавлениеDie umfangreichste schriftliche Überlieferung stammt aus dem Hethiterreich. Diese Texte sind in einer in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts v.u.Z. aus Nordsyrien übernommenen Keilschrift geschrieben, wobei bislang rund 30.000 Bruchstücke seit 1906 gefunden wurden; wegen der Möglichkeit, einzelne Fragmente zu einem größeren Textstück zusammenzufügen, bzw. wegen laufender Neufunde liefert diese Zahl lediglich eine allgemeine Orientierung über den Umfang des Textcorpus. Der wichtigste Fundort, von dem die überwältigende Mehrheit der Textfunde aus Ausgrabungen stammt, ist Boğazkale (die hethitische Hauptstadt Ḫattuša). Auch von anderen Fundorten wie Alaca Höyük (Identifizierung mit einem hethitischen Ort ist umstritten, eventuell Arinna?), Maşat Höyük (Tapikka), Kuşaklı (Šarišša), Kayalıpınar (Šamuḫa), Oymaağaç Höyük (Nerik), Ortaköy (Šapinuwa) oder Büklükale gibt es Texte in unterschiedlich großer Zahl.2 Eine geringe Anzahl von hethitischen Texten stammt von Orten in Nordsyrien, so etwa aus Ugarit oder Emar. Diese schriftliche Überlieferung umfasst einen Zeitraum von rund vier Jahrhunderten, nämlich von der Zeit Ḫattušilis I. in der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum Untergang des hethitischen Großreiches zu Beginn des 12. Jahrhunderts. In neuerer Zeit hat Theo van den Hout sich für eine spätere Datierung ausgesprochen, derzufolge die Verschriftlichung hethitischer Texte erst im 15. Jahrhundert im großen Umfang eingesetzt habe.3
Die Texte des 2. Jahrtausends – in hethitischer, altassyrischer, hattischer, hurritischer, palaischer und luwischer Sprache – sind in Varianten der Keilschrift geschrieben.4 Die am besten bezeugte Sprache ist das so genannte Hethitische,5 eine frühe indogermanische Sprache, die bereits ein Jahrzehnt nach dem Beginn der Ausgrabungen in Boğazkale entziffert werden konnte. Quantitativ am besten vertreten sind Texte mit religiösen Inhalten, so etwa ausführliche Beschreibungen von Festabläufen und Opfergaben sowie Texte zur Organisation von Festen und Kultorten, ferner Ritualtexte und Orakelprotokolle. Ebenfalls dem religiösen Bereich kann man Texte mythologischen Inhalts, Gebete und Gelübde zuordnen. Dazu kommen – unter inhaltlichem Aspekt – Verwaltungstexte bzw. Verträge, diplomatische Korrespondenz, Erlässe und Gesetze sowie umfangreiche historiographische Texte.6 Insgesamt kann man die meisten hethitischen Texte als »Überlieferungsliteratur«7 verstehen, d. h. es ist das, was über einen längeren Zeitraum tradiert worden ist. Somit können wir nicht von »Autoren«8 im engeren Sinn sprechen, da die Texte in der Überlieferung durch viele Hände im »Schreiberkollektiv« des »Schreiberhauses« (sumerographisch: É.DUB.BA.A) gegangen sein können. Bezüglich der Aufbewahrung und des Interesses an der Überlieferung hethitischer Texte ist erwähnenswert, dass man das hethitische Schrifttum in zwei Gruppen einteilen kann: Texte, die in Inventartexten verzeichnet sind und von denen – fast immer – mehrere Exemplare erhalten geblieben sind, sowie jene Texte, die nur jeweils in einem Exemplar bekannt sind. Theo van den Hout liefert etwa folgende große Verteilung der Texte entsprechend den beiden Gruppen:9
A) Texts with duplicates: historiography, treaties, edicts, instructions, laws; celestial oracle theory; hymns and prayers; festivals; rituals; mythology (Anatolian and non-Anatolian); Hattic, Palaic, Luwian, Hurrian texts; lexical lists; Sumerian and Akkadian compositions.
B) ›unica‹: letters; title deeds; hippological texts; court depositions; non-celestial oracle theory and oracle practice; vows; administrative texts.
Texte, die man der Gruppe A zuweisen kann, sind dabei präskriptiv, d. h. ihre Überlieferung soll dazu dienen, »Überlieferungswissen« zu bewahren, Anweisungen für kultische Vorgehen zu liefern oder Grundlagen für die hethitische Gesellschaft festzuschreiben. Texte aus Gruppe B hingegen sind deskriptiv und meist nur in einem einzigen Exemplar vorhanden, da sie sich auf einen jeweiligen Einzelanlass beziehen.10 Für die Bewertung des hethitischen Umgangs mit Tradition kann man daraus auch ableiten, dass die präskriptiven Texte der Gruppe A für eine längere Überlieferung (und für eine Förderung des »kulturellen Gedächtnisses«) vorgesehen sind, weshalb der Bestand dieser Texte auch in Inventar- bzw. Katalogtexten verzeichnet wurde. Dieses aufbewahrenswerte Überlieferungsgut wurde in Bibliotheken gesammelt, während die deskriptiven Texte der Gruppe B lediglich vorübergehend in Archivräumen aufbewahrt blieben.11
Einige Anthologien zu Texten des Alten Orients machen inzwischen eine Vielzahl von hethitischen Texten auch für Nicht-Hethitologen in zuverlässigen Übersetzungen zugänglich. Wichtige Texte wurden in der durch Otto Kaiser begründeten Reihe »Texte aus der Umwelt des Alten Testaments« (TUAT), die zwischen 1982 und 2001 mit insgesamt drei Bänden und einer Ergänzungslieferung erschienen ist, sowie in der von Bernd Janowski und Gernot Wilhelm bzw. Daniel Schwemer herausgegebenen »Neuen Folge« dieser Reihe (TUAT.NF) mit neun Bänden zwischen 2004 und 2020 in deutscher Übersetzung vorgelegt. Das Spektrum der darin aufgenommenen hethitischen Texte erstreckt sich über alle Genres des hethitischen Textcorpus, so dass der Leser anhand dieser Übersetzungsbände einen leichten Zugang zu repräsentativen Texten für alle Bereiche der hethitischen Kultur erhält. Ein englischsprachiges, aber weniger umfangreiches Pendant zu diesen Bänden stellt die von William W. Hallo und K. Lawson Younger herausgegebene vierbändige Sammlung »The Context of Scripture« (CoS; 1997–2017) dar. Auch hier findet man ausgewählte hethitische Texte aller Textgenres (Mythen, Gebete, Beschwörungen, Historiographie, juridische und administrative Texte, Briefe). In monographischer Form – mit Einleitung und reichhaltigen Anmerkungen – erschließt die Reihe »Writings from the Ancient World« hethitische Texte für einen größeren Leserkreis. Bislang sind folgende Bände erschienen:12 Hethitische Staatsverträge und Texte der Diplomatie, Mythologie, Hymnen und Gebete, Briefe, die so genannten Aḫḫiyawa-Texte, Instruktionen und Dienstanweisungen sowie eine Zusammenstellung von Kultinventartexten. Anhand solcher Übersetzungsserien13 erschließt sich die hethitische Überlieferung nunmehr auch leicht den Vertretern von Nachbardisziplinen.
Auch wenn das Hethitische die am besten bezeugte Sprache Kleinasiens ist, so weisen zwei Textcorpora in unterschiedlicher Weise in die Zeit vor der Etablierung der politischen Macht der Hethiter. Rund 23.000 Tontafeln, hauptsächlich Briefe und Wirtschaftsurkunden, sind in altassyrischer Sprache überliefert.14 Sie stammen aus den assyrischen Handelsniederlassungen (kārum) in Anatolien, v. a. in Kaneš und Ḫattuša, und geben eine eigene Schreibertradition wieder. Aufgrund der Quellengattung ermöglichen die Briefe zwar nur einen geringen Einblick in religiöse Verhältnisse, zeigen aber dennoch, dass manche Vorstellungen der Hethiter schon vor der Zeit der hethitischen Texte und vor der ersten hethitischen »Staatsgründung« fassbar sind. Von größerer Bedeutung für die frühe Religionsgeschichte Zentralanatoliens sind die Texte in Hattisch, d. h. in der Sprache jener Bevölkerung, die bereits in der Zeit vor der hethitischen Staatsgründung innerhalb des Halysbogens wohnte. Allerdings stammen alle diese Texte aus der Überlieferung der Hethiter. Da Elemente des hattischen Kultes von den Hethitern rezipiert wurden, tradierte man diese Texte – manche auch als hattisch-hethitische Bilinguen – in Bereichen der Religion bis in die Großreichszeit.15 Dadurch beschränkt sich das inhaltliche Spektrum der Texte jedoch auf Rituale und Beschwörungen, Zeremonien und Festbeschreibungen im Tempel bzw. auf Anrufungen von Gottheiten sowie auf mythologische Texte.
Einen größeren Umfang haben die hurritischen Texte, die ab der Mitte des 2. Jahrtausends aufgrund der Zunahme des hurritischen Bevölkerungsanteils im Südosten des Hethiterreiches den Quellenbestand für die Rekonstruktion der religiösen Verhältnisse in Kleinasien bereichern. Ursprünglich waren die Hurriter in Nordsyrien und Obermesopotamien verbreitet, wobei hurritische Texte die Beziehungen zu diesem Raum mit seinen religiösen Vorstellungen noch erkennen lassen.16 In Kleinasien selbst war der hurritische Anteil der Bevölkerung im Südosten des Landes größer als in Zentralanatolien. Gegenüber dem Hattischen sind die in Ḫattuša und Šapinuwa gefundenen hurritischen Texte vielfältiger: Den Großteil machen Beschwörungs- und Reinigungsrituale aus, dazu kommen Festliturgien (v. a. für den Wettergott Teššub und seine Gattin Ḫebat), mythologische Texte verschiedener Art und wenige Fragmente historischen Inhalts. Auch Omentexte sind in hurritischer Sprache erhalten geblieben; allerdings handelt es sich dabei um Übersetzungen bzw. Bearbeitungen von akkadischen Vorlagen. Für die Erschließung der hurritischen Sprache bedeutsam ist ein umfangreicher epischer Text über den Wettergott sowie eine Sammlung von Parabeln, da diese Texte als Bilinguen mit einer hethitischen Übersetzung überliefert wurden.17 Mit dem Hurritischen verwandt – allerdings nicht als direkte Weiterentwicklung – ist das v. a. vom 9. bis 7. Jahrhundert überlieferte Urartäische im Bereich der heutigen Osttürkei und angrenzender Gebiete im Süden Armeniens und Nordwesten Irans.18 Die verschiedenen Texte behandeln inhaltlich vor allem zwei Themenbereiche, nämlich militärische Aktivitäten bzw. Bautätigkeiten der urartäischen Könige, daneben in einigen Texten enthaltene Opferlisten. Die Inschriften wurden meist auf Felswänden, Stelen und Mauern angebracht, im Unterschied zu den Textfunden der anderen bisher genannten Sprachen jedoch kaum auf Tontafeln.
Eine weitere mit dem Hethitischen verwandte Sprache ist das Palaische, das im Nord(west)en Anatoliens bis zur Mitte des 2. Jahrhunderts in Verwendung war, danach aber weitgehend geschwunden ist. Davon sind jedoch nur ganz wenige Texte erhalten geblieben, deren Verständnis noch sehr unvollständig ist.19
Im so genannten Keilschrift-Luwischen gibt es vor allem Ritualtexte und Beschreibungen von Festliturgien.20 Die älteste Überlieferung dieser Texte setzt bereits im 16. Jahrhundert ein, wobei der luwische Sprachraum sich zunächst über den Süden und Südwesten Anatoliens erstreckte. Das Nebeneinander des Luwischen und des Hurritischen in Kizzuwatna im Süden Anatoliens führte dazu, dass der luwische Wortschatz Wörter aus dem Hurritischen aufgenommen hat. Die erhalten gebliebenen Texte (der Großteil davon ist ins 13. Jahrhundert zu datieren) stammen aus der hethitischen Hauptstadt, wobei von der luwischen Sprache auch sprachliche Einflüsse auf das Hethitische gewirkt haben. Neben dem Keilschrift-Luwischen gibt es – aus dem 2. Jahrtausend – ein kleineres Corpus luwischer Texte, die mit einem hieroglyphischen Schriftsystem geschrieben sind, das – im Unterschied zur aus Nordsyrien importierten Keilschrift – eine genuin anatolische Erfindung ist.21 Dieses so genannte Hieroglyphen-Luwische hat dabei als Schrifttradition Kleinasiens den politischen Untergang des Hethiterreiches zu Beginn des 12. Jahrhunderts überdauert. Die hieroglyphen-luwischen Texte des 1. Jahrtausends zeigen eine – wenngleich gewandelte – kulturelle Kontinuität altkleinasiatischer Vorstellungen v. a. südlich des Halys, in Kappadokien, im Süden und Südosten der heutigen Türkei sowie in Nordsyrien bis ins 8. Jahrhundert v.u.Z. Die Texte aus der Zeit nach dem Untergang liegen in zwei Editionen leicht zugänglich vor: Halet Çambel hat 1999 die Bilingue in hieroglyphen-luwischer und phönizischer Sprache von Karatepe vorgelegt und J. David Hawkins im darauffolgenden Jahr alle weiteren damals bekannten eisenzeitlichen Inschriften – jeweils mit Einleitung, Übersetzung, sprachlichem Kommentar, Fotos und Umzeichnung der Texte.22 Inhaltlich handelt es sich – im Unterschied zum keilschrift-luwischen Corpus – um keine Texte explizit religiösen Inhalts, sondern es sind v. a. Bau-, Grab- und Memorativinschriften. Es lassen sich aus den Texten dennoch Aussagen über die Kontinuität mancher luwischer Götter vom 2. zum 1. Jahrtausend und ein Einblick in Opferpraktiken und Jenseitsvorstellungen gewinnen.23
Neben dem Hieroglyphen-Luwischen erweitern noch andere Sprachen mit ihrer schriftlichen Hinterlassenschaft die Quellensituation für eine Religionsgeschichte Anatoliens bis zur Mitte des 1. Jahrtausends, v. a. lykische, lydische, phrygische und urartäische Dokumente. Das Lykische ist mit den beiden vorhin genannten luwischen Sprachen eng verwandt. Es ist in einem vom Griechischen abhängigen Alphabet geschrieben und liegt in zwei Sprachformen vor – die Mehrheit der Texte im so genannten Lykisch A und wenige Texte in Lykisch B.24 Die rund 200 lykischen Inschriften (v. a. auf Grabfassaden und Stelen) stammen aus dem Südwesten der heutigen Türkei und wurden zwischen dem 6. und 4. Jahrhundert v.u.Z. verfasst.25 Hauptsächlich handelt es sich dabei um Grab- sowie um einige Bauinschriften. Für die Erschließung der religiösen Vorstellungen der Lyker geben diese Inschriften v. a. im Hinblick auf den Totenkult Aufschluss, während mythologische Überlieferungen und weitere Hinweise auf religiöse Praktiken aus griechischen »Fremdberichten« stammen.
Das Lydische gehört ebenfalls zu den anatolischen Sprachen, wobei das exakte Verwandtschaftsverhältnis zum Hethitischen, Luwischen oder Lykischen noch nicht ganz geklärt ist. Dies liegt vor allem daran, dass von den etwas über 100 lydischen Inschriften nur rund 30 einen größeren Umfang aufweisen und dass die Erschließung des Lydischen – im Vergleich mit den anderen anatolischen Sprachen – noch große Schwierigkeiten bereitet. Die Inschriften sind in einem vom Griechischen abhängigen eigenen Alphabet geschrieben, die Mehrheit der Texte sind wiederum Grabinschriften, daneben gibt es einige Erlasstexte. Die meisten Inschriften stammen aus der lydischen Hauptstadt Sardes im Westen der Türkei. Die Überlieferung dieser Inschriften dauert vom späten 7. bis zum 4. Jahrhundert. Auch für die lydische Kultur im Allgemeinen sind neben diesen Inschriften die Informationen, die v. a. aus der griechischen Überlieferung stammen, höchst relevant.26
Eine ebenfalls indogermanische, aber nicht dem Zweig der indogermanisch-altanatolischen Sprachen zugehörige Sprache des 1. Jahrtausends in Zentralanatolien ist das Phrygische. Die Phryger sind etwas vor 1200 vom Balkan kommend in den Nordwesten Anatoliens eingewandert und nach dem Zusammenbruch des Hethiterreiches bis in den Halysbogen vorgedrungen. Zwischen dem 8. und 5. Jahrhundert sind rund 340 so genannte altphrygische Inschriften aus den phrygischen Zentren erhalten, wobei fast drei Viertel der Texte aus Gordion stammen.27 Manche der Inschriften beziehen sich auf den Kult, andere auf politische Inhalte. Da die meisten Inschriften recht kurz sind, bleibt das Textverständnis manchmal noch unklar. Neben den phrygischen Inschriften liefern auch – wie im Fall der Lyker und Lyder – griechische literarische Texte weitere Kenntnisse zur phrygischen Religion und Mythologie.
In all diesen Sprachen sind – in unterschiedlichem Ausmaß und in sehr verschiedenen Gattungen – Texte erhalten geblieben, die gemeinsam mit Erkenntnissen aufgrund archäologischer Feldforschungen Einblick in die pluralistische Kultur Anatolien vom Ende des 3. bis zur Mitte des 1. Jahrtausends geben. Durch die Auswertung dieser Dokumente kann die Darstellung der kleinasiatischen Religionsgeschichte sowohl Kontinuitäten als auch lokale oder chronologische Veränderungen berücksichtigen.