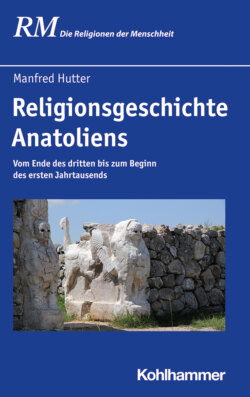Читать книгу Religionsgeschichte Anatoliens - Manfred Hutter - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 Eckpunkte der geschichtlichen Situation der althethitischen Zeit
ОглавлениеAls ersten hethitischen König am Beginn der althethitischen Zeit kennen wir Ḫuzziya, der als König von Zalpa durch Anitta besiegt und nach Kaneš deportiert worden war. Wie der Übergang bzw. der Hiatus zwischen der »Kaneš-Zeit« und der »althethitischen« Zeit vor sich gegangen ist, ist nicht völlig geklärt. Ein gewisser Ḫuzziya ist möglicherweise der direkte Nachfolger von Zuzzu von Kaneš, der eventuell seinerseits durch eine Usurpation die Herrschaft über Kaneš dem Herrscher Anitta entrissen hat. Dies bedeutet, dass der erste hethitische Herrscher zwar aus dem (erweiterten) »königlichen Kontext« von Kaneš stammt, aber nicht mit der Pitḫana-Anitta-Dynastie verbunden ist.5 Trotz dieser Verbindung mit Kaneš ist hervorzuheben, dass hattische Traditionen des nördlichen Anatoliens für die Entstehung des althethitischen Reiches einen wesentlichen Faktor bilden.6 Ob Ḫuzziya – und sein Schwiegersohn und Nachfolger Labarna I. – bereits in Ḫattuša residierten oder noch an anderen Orten, bleibt unsicher. Erst Labarna II. hat Ḫattuša neu aufgebaut und sich fortan Ḫattušili, »der (Mann) von Ḫattuša«, genannt. Ḫattušili I. stammte wohl aus Kuššara.7 Die »hethitische Hofsprache«, die spätestens unter Ḫattušili nach Ḫattuša gelangte, wäre daher nicht der hethitische Alltagsdialekt aus Kaneš, sondern die Sprache der politischen Eliten aus Kuššara. Wegen dieser Differenzierung vermutet Alwin Kloekhorst, dass zwischen den Hinweisen auf das Hethitische in den altassyrischen Texten als Dialektform in Kaneš und der Dialektform in Kuššara Unterschiede bestanden und daher die Form hethitischer Wörter in den Texten aus Kaneš und in (jüngeren) hethitischen Texten aus Ḫattuša nicht völlig gleich ist. Auch wenn Ḫattušili aus Kuššara stammt, ist fraglich, ob sich jedoch daraus eine solche sprachliche Differenzierung ableiten lässt, wie Kloekhorst vermutet.8 Denn im Selbstverständnis ihrer Sprache verwendeten die Hethiter den Begriff nišili- (bzw. auch die Variante kanišumnili-), wobei diese Bezeichnung vom Ortsnamen Kaneš und nicht von Kuššara abgeleitet ist, was man nicht unbeachtet lassen sollte.
Mit Labarna I. und Ḫattušili I. beginnt der »überregionale« hethitische Staat. Dabei geraten schrittweise unabhängige hattische Lokalherrscher unter hethitische Kontrolle. Der Ausbau der (neuen) Hauptstadt Ḫattuša unter Ḫattušili ist ein Zeichen der Konsolidierung der Macht gegenüber lokalen inneranatolischen Herrschern. Dieser Prozess der Konsolidierung der überregionalen Herrschaft ist unter Ḫattušilis Nachfolger (und Sohn?) Muršili I. zu Beginn des 16. Jahrhunderts im Wesentlichen abgeschlossen. Mit der Ermordung Muršilis setzte eine Periode innenpolitischer Unruhen und Thronkämpfe ein, über die wir aus dem Prolog des so genannten Telipinu-Erlasses informiert sind.9 Telipinu, dem es während seiner Regierung gelingt, das politische Ansehen des Hethiterreiches wieder zu stärken, skizziert in diesem Text nicht nur die politischen Morde am Königshof, sondern versucht auch, die Thronfolge auf feste und geregelte Bahnen zu lenken – allerdings mit mäßigem Erfolg, da auch wenigstens zwei seiner Nachfolger (Ḫuzziya II., Muwatalli I.) eines unnatürlichen Todes starben. Mit der Thronbesteigung von Ḫuzziyas Sohn Tudḫaliya II. im späten 15. Jahrhundert beginnt eine neue Phase der hethitischen Geschichte, die durch außenpolitische Auseinandersetzungen mit Arzawa im Westen, mit den Angriffen der Kaškäer aus dem Norden und dem zunehmenden Einfluss der Hurriter auf den Südosten geprägt ist; diese Phase bereitet bereits den Übergang zur Großreichszeit vor.
Die unterschiedliche Herkunft der ersten hethitischen Könige – Zalpa und Kaneš bzw. Kuššara – ist nicht nur eine Frage der Geographie, sondern hat Auswirkungen auf die hethitische Königsideologie, die durch hattische Traditionen des Nordens sowie durch Traditionen, die mit dem Gebiet südlich des Halysbogens verbunden sind, bestimmt wird. Ferner ist für die Ideologie des hethitischen Königtums wichtig, dass es mehrere Königtümer in Kleinasien in den ersten Jahrhunderten des 2. Jahrtausends gegeben hat, ehe es zur überregionalen politischen Einigung gekommen ist. Offensichtlich als Ergebnis dieser unterschiedlichen Traditionen gibt es seit der althethitischen Zeit die Vorstellung, dass der König seine Herrschaft von einer Gottheit erhält. Anscheinend wurde im hattischen Bereich (wahrscheinlich in Zalpa10) Ḫanwašuit (heth. Ḫalmašuit) als Throngottheit (und damit mit besonderer Relevanz für den König) verehrt. Nach einem aus dem hattischen Milieu stammenden Palast-Bauritual hat diese Gottheit eine »Zeremonialkutsche« und somit die Regierungsgewalt dem König gegeben. Meist wird dieser Ritualtext als zentraler Beleg für die göttliche Legitimierung des Königtums angesehen, allerdings sollte man darin wohl nur einen Traditionsstrang für die hethitische Königsideologie sehen. Die Beschreibung in einem junghethitisch überlieferten Text, der jedoch auf eine althethitische Vorlage zurückgeht, ist ausdrucksstark:11
Auf, wir wollen gehen! Stehe du (d. h. Ḫanwašuit) hinter den Bergen, mein Mensch sollst du nicht werden, mein Verwandter sollst du nicht werden, sei aber mein Gefährte, ja mein Gefährte. Auf, in das Gebirge wollen wir gehen; und ich, der König, werde dir eine Glasschüssel geben, und aus der Glasschüssel wollen wir essen! Du, beschütze die Berge! Mir, dem König, aber haben die Götter, nämlich die Sonnengöttin und der Wettergott, das Land und mein Haus übergeben. Und ich, der König, werde mein Land und mein Haus schützen! Komm du nicht in mein Haus. Mir, dem König, haben die Götter viele Jahre übergeben, und meiner Jahre Kürze gibt es nicht. Mir, dem König, brachte die Throngöttin (d. h. Ḫanwašuit) die Verwaltung und die ḫulukanni-Kutsche vom Meer her. Sie (Sonnengöttin und Wettergott) öffneten mir meiner Mutter Land und nannten mich, den König, Labarna. Und wiederum preise ich den Wettergott, meinen Vater.
Der Text verbindet unterschiedliche Motive. Die Rolle der Throngöttin ist ambivalent, da der König sich einerseits von ihr abgrenzt, da sie nicht in sein »Haus« kommen soll, aber er zugleich seine Verwaltung auf sie zurückführt. Diese mit dem Königtum und (lokalen) Göttern in Zalpa verbundene Legitimationslinie für das althethitische Königtum spiegeln auch einige der so genannten »Segenssprüche für den Labarna« (CTH 820) wider, vor allem KBo 21.22. Dieser Text zeigt thematische Anknüpfungspunkte an KUB 29.1.12 KBo 21.22 ii 31ff. zählt die »Gottheiten des Königs« auf, die eng mit dem Pantheon von Zalpa bzw. Nordanatoliens verbunden sind.13 Beide Texte – KUB 29.1 und KBo 21.22 (mit jüngeren Paralleltexten) – zeigen somit eine zentrale Traditionslinie von der (vorhethitischen) Königsideologie in Zalpa zum althethitischen Königtum. Für die althethitische Königsideologie spielen jedoch noch weitere Motive eine Rolle. Das in KUB 29.1 erwähnte Haus, das die Sonnengöttin und der Wettergott dem König übergeben, ist ein anderer Traditionsstrang, der eventuell ursprünglich mit der hattischen Göttin Inar verbunden ist. Am Ende des so genannten Illuyanka-Mythos, der zwar nur in einer junghethitischen Abschrift des 13. Jahrhunderts vorliegt, aber wohl aus althethitischer Zeit stammt, ist davon die Rede, dass Inar das Haus, das sie ursprünglich für den Menschen Ḫupašiya, der ihr in der Bekämpfung des Wettergottes beistand, gebaut hat, an den König übergeben hat. Dass hierin ein bereits in althethitischer Zeit verbreitetes Motiv der Übergabe der Herrschaft an den König – symbolisiert durch die Übergabe eines »Hauses« (Palastes) – vorliegt, zeigt ein kleiner althethitischer Text (KUB 36.110), der einen hymnischen Lobpreis auf den König ausdrückt, der u. a. als starke Festung beschrieben wird und dessen Haus auf einem starken Felsen die Freude seiner Nachkommen ist – im Gegensatz zum Haus seines (politischen) Feindes.14 Die Übergabe des Hauses durch Inar an den König ist – nach dem Mythos – auch eine Begründung für die alljährliche Feier des purulli-Festes, wodurch zugleich die Herrschaft gestärkt werden soll. Verschiedene Texte betonen ferner, dass der König »nur« der Verwalter des Landes für die Götter als dessen eigentliche Besitzer ist, so etwa IBoT 1.30:15
Wenn der König sich vor den Göttern verbeugt, rezitiert der GUDU12-Priester folgendermaßen: »Möge der labarna, der König, den Göttern genehm sein. Das Land gehört allein dem Wettergott. Die Heerschar des Himmels und der Erde gehört allein dem Wettergott. Doch er hat den labarna, den König, zu seinem Verwalter gemacht und ihm das ganze Land Ḫattuša gegeben, und das ganze Land soll der König für den Wettergott mit seiner Hand verwalten. Wer in den Körper und über die Grenzen des labarna, des Königs, vordringt, den soll der Wettergott vernichten.«
Der Text verwendet – als altes Erbe – den Titel t/labarna, der in der frühen Königsideologie eine wichtige Rolle spielt, allerdings lässt sich daraus kein »sakrales« Königtum ableiten und der Titel bezieht sich auch nicht ausschließlich auf die sakral-kultischen Aufgaben des Königs.16 Denn der eben genannte Text nennt auch die politischen Aktivitäten des Königs. Dazu gehören z. B. der Schutz bzw. die Ausweitung der Landesgrenzen, die Überwindung der Feinde, aber auch die Übergabe von (Kriegs-)Beute an die Tempel der Sonnengöttin und des Wettergottes. Genauso ist umgekehrt der Schutz des legitimen Herrschers durch die Götter impliziert. Daher wird im Telipinu-Erlass die Ermordung des Usurpators Zidanta auf den göttlichen Willen zurückgeführt, was zum Ausdruck bringt, dass der legitime Thronerbe von den Göttern geschützt wird.17
Zusammenfassend kann – soweit dies für die Rekonstruktion der Religion wichtig ist – Folgendes zur Entwicklung des Hethiterreiches in althethitischer Zeit gesagt werden: In vorhethitischer Zeit war der hattische Norden Kleinasiens vom Schwarzen Meer bis zum Halys zunächst durch lokale Kleinstaaten geprägt, was teilweise auch aus den altassyrischen Texten hervorgeht. Schrittweise wurden diese unter den »nördlichen« Herrschern Ḫuzziya und Labarna I. sowie dem »südlichen« Herrscher Labarna II. (Ḫattušili I.) zu einem größeren und überregionalen Flächenstaat vereinigt und die hattische Stadt Ḫattuš(a) – unter Ḫattušili I. – zur Hauptstadt des sich konsolidierenden Staates erhoben, da sich auch Ḫattušili wie seine Vorgänger für die politische Machtentfaltung auf hattische Traditionen der Idee des Königtums stützte.
Daher dominierte in althethitischer Zeit das hattische Traditionsgut die hethitische Kultur und die »Staatsreligion«, wobei die althethitische Zeit wahrscheinlich weitgehend zweisprachig war18 – mit dem Hethitischen im Bereich der politischen Oberschicht und gemeinsam mit dem Hattischen auch in der »Staatsreligion«, während weite Teile der Bevölkerung das Hattische als alltägliche Sprache nördlich des Halys verwendet haben dürften. Daneben war in nordwestlichen Bereichen des althethitischen Raumes das Palaische beheimatet und südwestlich des Halys das Luwische, das sich auch über den Fluss teilweise ins zentrale hattische Gebiet hinein verbreitete. Dieses Szenario macht aber zugleich deutlich, dass wir – für die Rekonstruktion der »althethitischen« Religion – von Beginn an mit komplexen Kontakten und wechselseitigen Beeinflussungen verschiedener Traditionen zu rechnen haben, die es im entstehenden hethitischen Staat gegeben hat.